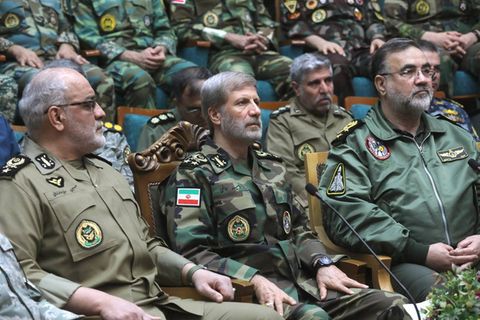Tel Aviv, eine Nacht im Juni. Die Demonstranten wischen sich Schweißperlen von den Gesichtern und schreien weiter: "Bibi, geh nach Hause!". Sie versammeln sich vor dem Verteidigungsministerium, als könne der Premierminister sie dort hören. Einige werfen Plakate auf einen Haufen, zücken Feuerzeuge – und die Bilder Benjamin Netanjahus gehen in Flammen auf. Jugendliche fächeln mit ihren Postern Luft auf die Flammen, schwarzer Rauch steigt auf.
Die Polizisten versuchen schon gar nicht mehr, die vielen Feuer zu löschen, die die Demonstranten Woche für Woche legen. Doch zurückstecken wollen auch sie nicht: Ein Dutzend Uniformierte reitet plötzlich mit Pferden auf die Menge zu, die Menschen stieben auseinander. Eine junge Frau zieht mich zur Seite: "Hierher!", ruft sie, wir laufen auf den Bürgersteig.
Die Stimmung in Israel kippt
Aufgabe von Journalistinnen und Journalisten ist es, mitten im Geschehen zu stehen. Die Pressetribüne bei Demonstrationen ist oft eher ein Hindernis dabei, mit Menschen ins Gespräch zu kommen – gut, um sich einen Überblick zu verschaffen, bevor man zurück in die Menge geht. An diesem Abend jedoch steige ich die Metallstufen zur Tribüne hinauf und betrachte die Tumulte von oben. Auch die meisten Fotografen haben sich dorthin gerettet und schauen durch ihre Objektive auf die Zusammenstöße zwischen der Polizei und der Menge.
In den ersten Tagen und Wochen nach dem 7. Oktober begegneten sich Polizisten und Demonstranten in Israel eher vorsichtig. Vereint im gemeinsamen Trauma, viele selbst mit Angehörigen oder Bekannten, die von der Hamas entführt, verletzt oder gar ermordet wurden. Oder die im Gazastreifen als Soldaten kämpften.
Ein Skandal war damals, dass Geiselangehörige von der Polizei weggedrängt wurden, da waren sich alle Lager einig. Aus diesen Tagen stammen die Plakate an vielen Autobahnbrücken mit der Aufschrift: "Vereint werden wir gewinnen." Wie ein Hohn wirken sie angesichts der Gruppen, die nun mit Wasserwerfern, Pferden oder brennenden Plakaten gegeneinander kämpfen.
Woche für Woche treffe ich auf den Demonstrationen nicht nur die gleichen Menschen mit Plakaten. Wir kennen uns, etliche Male habe ich seit den Anfangstagen mit ihnen gesprochen. Ich sehe auch oft dieselben Polizisten, weiß, welche der Presse wohlgesonnen sind. Einer hilft den Fotografen und auch mir immer wieder dabei, die Absperrungen zu überwinden. Andere beschimpfen uns und wollen uns des Platzes verweisen. Einige israelische Fotojournalisten treffen sich Samstagabends nach den Demonstrationen oft zu einem Stammtisch, zu dem ich nach wenigen Wochen auch eingeladen wurde. Sie zeigen sich gegenseitig ihre Aufnahmen, manchmal auch blaue Flecken oder die von Wasserwerfern durchnässte Kleidung. Immer wieder ist dort ein Thema: die immer aggressiver werdende Polizei.
Die Fotografen sind sich einig: Eigentlich ist die Polizei nicht der Feind. Doch seit der ultranationalistische Itamar Ben-Gvir im Dezember 2022 zum Sicherheitsminister ernannt wurde, habe sich etwas verändert. Die Demonstranten würden mehr und mehr als Staatsfeinde wahrgenommen. Immer mehr auch die Pressevertreter. "Ich habe vor allem bei jungen Polizisten das Gefühl, dass denen jedes Mittel recht ist", sagt einer der Fotografen am Stammtisch. "Die wissen, der oberste Polizeichef ist noch krasser drauf, dann können sie es ja selbst auch sein." Schon bei den Protesten um Netanjahus umstrittene Justizreform sei ihm das aufgefallen, seit ein paar Monaten aber auch bei den Protesten für die Freilassung der Geiseln.
Ein wenig Hebräisch bricht das Eis
In der Metropole Tel Aviv versammeln sich vor allem die eher links gerichteten Demonstranten, die ein Abkommen mit der Hamas fordern, um die verbleibenden 101 Geiseln aus Gaza zu befreien. Egal zu welchen Kosten.
In der Hauptstadt Jerusalem, geprägt von Religion und vergleichsweise eher konservativen Einwohnern, demonstrieren auch immer wieder Unterstützer der Regierung. Im April, bei einer ihrer Versammlungen, dröhnten Bässe über ein Meer aus Israel-Flaggen. Plakate verkündeten: "Netanjahu für immer! Du wirst niemals alleine gehen."

Die wenigsten Menschen dort sprechen Englisch. Viele Unterstützer der Regierung gehen auf religiöse Schulen, in denen keine Fremdsprachen unterrichtet werden. Das ist immer wieder eine Herausforderung bei der Berichterstattung: Wenn ich die Demonstranten auf Englisch anspreche, fragen sie oft skeptisch nach der politischen Ausrichtung meines Mediums. Dann hilft es mir, mit ihnen ein einfaches Hebräisch zu sprechen – für sie wohl ein Zeichen dafür, dass ich vertrauenswürdig bin. Immer wieder fällt auch unter Demonstranten, die keine ausländischen Medien lesen und kennen, der Satz: "Stern, das kenne ich." Der Nachname ist unter jüdischen Familien verbreitet, auch in Israel.
Immer weniger Menschen wollen ihre Namen nennen
In den ersten Monaten nach Kriegsbeginn fand ich auf Demonstrationen schnell Gesprächspartner. Egal ob Rechte oder Linke. Selbst in der Nacht, als der Iran erstmals direkt Israel beschoss, nahmen sich die Menschen Zeit für Interviews, bevor sie von der Straße zurück in ihre Häuser liefen. Viele freuten sich, dass ihre Meinung gehört wird.
Nun, fast ein Jahr nach dem 7. Oktober, erlebe ich das Gegenteil. Wer mit mir spricht, will seinen vollen Namen oft nicht mehr nennen. Dass ich Fotos aufnehme, lehnen die meisten ab. "Ich will nicht, dass Leute meine politische Einstellung sehen, wenn sie mich googeln", diesen Satz sagte mir erst vor wenigen Tagen eine Frau, die bisher bei jeder der wöchentlichen Demonstrationen für die Geiseln dabei war. Die Politik ist für sie zu einem der wichtigsten Lebensinhalte geworden. Erkennbar sein will sie trotzdem nicht.
Ebenso ein 33-jähriger Unterstützer der Regierung. Als ich ihn in Tel Aviv interviewte, senkte er die Stimme, aus Angst, dass Passanten ihn hören könnten. Sowohl die links eingestellte Frau als auch der eher rechts orientierte Mann sind überzeugt: Der politischer Gegner versucht, die öffentliche Meinung zu kontrollieren. Sie wollen sich nicht angreifbar machen.
Der Zusammenhalt der ersten Kriegswochen: Ich sehe ihn in Israel nur noch auf den alten Plakaten.