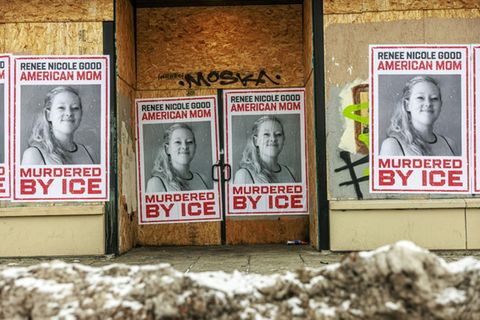Das Votum war eindeutig: Mit 378 gegen 196 Gegenstimmen fiel die Entscheidung der Europaparlamentarier gegen das umstrittene Bankdatenabkommen Swift am Donnerstag klar aus. Unerwartet klar. Danach herrschte in Straßburg kollektive Feierstimmung. Als "historischen Entscheidung für die Demokratie" bejubelten die Parlamentarier die Ablehnung, als "Kehrtwende für die Grundrechte" und den "Anfang vom Ende der Hinterzimmerpolitik".
Doch der "klare Sieg der Demokratie" war lange eine echte Hängepartie. Noch wenige Minuten, bevor das Europaparlament am Donnerstag in Straßburg das Aus für Swift besiegelte, war unklar, ob es überhaupt zu einer Abstimmung kommen würde. Auf Antrag der Fraktion der konservativen EVP wurde vor der Abstimmung über Swift nämlich darüber abgestimmt, ob die Entscheidung doch nicht lieber vertagt werden solle. Und das, sind viele überzeugt, hätte die Chancen für Swift deutlich erhöht.
Ein diplomatisches Feuerwerk der USA
In den letzten Tagen vor der Abstimmung hatten Amerikaner, der Rat und einige europäische Regierungen ein wahres diplomatisches Feuerwerk über den Europaparlamentariern abgeschossen. Ganze Heerscharen von Diplomaten zogen aus, um Widerspenstige auf noch auf Linie zu bringen und Wankelmütige für sich einzunehmen.
Es wurden alle Register gezogen. Von Drohungen, die transatlantischen Beziehungen würden sich ohne Swift in Rauch auflösen bis zu Zuweisung von Mitschuld an potenziellen künftigen Anschlägen. Alles war dabei. Im letzten Moment schaltete sich sogar US-Außenminister Hillary Clinton persönlich ein.
Und auch argumentativ fuhren Rat und Regierungen schweres Geschütz auf. Eigentlich gehe es gar nicht um die Daten der Europäer, argumentierten die Amerikaner. Der Großteil der interessanten Daten stamme aus dem Nahen Osten. Und kurz vor knapp präsentierte dann auch noch der französische Ermittlungsrichter und gefeierte Terroristenjäger Jean-Louis Bruguière eine umstrittene Liste - mit Beispielen, bei denen Swift-Daten angeblich bei der Enttarnung von Terroristen geholfen haben sollen. Allen voran führte er den Ermittlungserfolg gegen die so genannte Sauerlandgruppe auf.
Nicht wenige Parlamentarier fühlten sich erpresst. Bei vielen hinterließ die Dauerbefeuerung aber auch Spuren. Sie waren bereit, das Abkommen mit einzelnen Änderungen doch noch durchgehen zu lassen. Nur knapp sprachen sich die Abgeordneten dann doch noch für eine Abstimmung am Donnerstag aus.
Eine tiefe Kluft zwischen Europa und den USA
Und die zeigte klar: Was die Einstellung zu den Grundrechten angeht, klafft zwischen Europa und den USA eine tiefe Lücke. Ein Abkommen, bei denen die USA unbegrenzten Zugriff auf europäische Daten haben und die Betroffenen keine Möglichkeit haben, sich gegen den Eingriff in ihre Privatsphäre zu wehren, hat hier keine Chance. Das müssen auch die Amerikaner künftig respektieren.
Während die CSU-Europaabgeordnete Monika Hohlmeier nach der Abstimmung die EU aufrief, mit Hilfe der USA ein eigenes System zur Rückverfolgung verdächtiger Finanzströme zu entwickeln und bis dahin für ein entschärftes Swift-Abkommen plädierte, geht die Linke viel weiter. Sie will grundsätzlicher darüber nachdenken, wie weit Terrorfahnder gehen dürfen. "Wir müssen auswerten, was überhaupt wirksam und verhältnismäßig ist", sagte der Grünen Innenexperte Jan Philipp Albrecht stern.de. "Wir können nicht jeden unter Generalverdacht stellen." Wie es mit Swift weitergeht, bleibt also offen. Klar ist durch die Entscheidung aber eines geworden: Kommission und Regierungen können nicht länger an ihren Bürgern vorbei Entscheidungen treffen. Daran müssen sie sich erst einmal gewöhnen. Das Europaparlament ist gerade dabei, seinen Mitspracheanspruch zu verdeutlichen. Das jedenfalls hat die Entscheidung in Straßburg gezeigt.