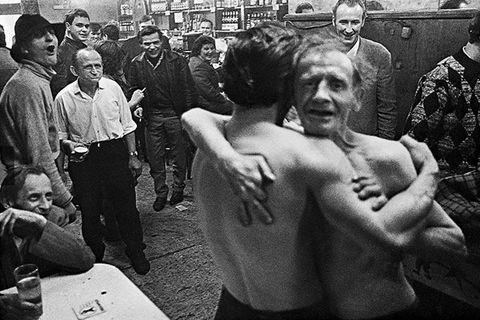Nur wenige Hamburger Lehrer wollen über das Thema reden. "Ich habe es mir anders überlegt", sagt eine junge Lehrkraft, mit Hinweis über ihre berufliche Zukunft. Andere verweigern ganz die Auskunft. Sie alle fürchten Ärger mit der Behörde für Bildung und Sport. Und dabei geht es um eine der bedeutendsten Schulreformen der Nachkriegszeit: das achtjährige Gymnasium. Man spricht von einem Maulkorberlass, und dass der Senat kritische Stimmen aus den eigenen Schulkollegien fürchte. Eines wird dadurch umso deutlicher - die G8-Reform ist ein heißes Eisen. Ob nun für Behörden, Lehrer, Eltern oder Schüler.
Hans Voß ist 59 Jahre alt und arbeitet am Hamburger Emilie-Wüstenfeld-Gymnasium als Lehrer für Biologie, Gemeinschaftskunde und Informatik. In zweiter Funktion ist er Vorsitzender des Gesamtpersonalrats an staatlichen Hamburger Schulen, und das gibt ihm eine gewisse Sicherheit. Er war der einzige Lehrer in Hamburg, der stern.de ein Interview zu diesem Thema geben wollte.
Sein Urteil zum achtjährigen Gymnasium klingt deprimierend: "Man hat die Schule um ein Jahr verkürzt, und die Inhalte nur unwesentlich gekürzt. Schüler von der siebten bis zur zehnten Klasse haben jetzt 34 Wochenstunden", sagt er. "Eigentlich bräuchten wir die Ganztagsschule, stattdessen haben wir die Schule am ganzen Tag".
Kritik an G8 wird immer lauter
So wie in Hamburg sind in den vergangenen Monaten auch in anderen Bundesländern immer mehr Klagen über das achtjährige Gymnasium zu hören gewesen. Die Reform wird langsam erwachsen. Im Jahr 2011 werden erstmals alle Schüler in zwei westdeutschen Flächenländern - Niedersachsen und Bayern - bereits nach zwölf Schuljahren Abitur machen. Baden-Württemberg und Brandenburg folgen 2012, Nordrhein-Westfalen sowie Hessen im Jahr 2013. Außer in Rheinland-Pfalz, wo die Jahrgangstufe 13 verkürzt wurde, ist die Einführung des achtjährigen Gymnasiums in allen Ländern beschlossene Sache. In Sachsen und Thüringen gibt es bereits seit DDR-Zeiten das G8.
Doch die kritischen Stimmen werden immer lauter. Vor allem die Lehrpläne stehen dabei im Mittelpunkt. Man habe versäumt, den Schulstoff von unnötigem Ballast zu befreien. Stattdessen sei vielerorts versucht worden, neun Jahre Gymnasium auch acht Jahre zu komprimieren, sagen zum Beispiel verschiedene Elterninitiativen in ganz Deutschland und die zwei großen Lehrergewerkschaften.
Arbeitszeit für Lehrer schnellt nach oben
"Zu Recht wird das Abitur als Reifeprüfung bezeichnet, da die Schülerinnen und Schüler auch Zeit brauchen, um ihre Persönlichkeit zu entwickeln", meint der Philologenverband in Rheinland-Pfalz. Die Fachgruppe Gymnasien der bayerischen Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) kommentierte die Einführung des achtjährigen Gymnasiums folgendermaßen: "Das G8 setzt die Kinder und Jugendlichen im Gymnasium unter nochmals erhöhten Lerndruck. Die Art des Lernens: die Fixierung auf Stoff, die Lehrerfixierung, die geringe Chance für die Schüler, frei zu arbeiten, wird sich nicht ändern, neuere Entwicklungen zu innerer Schulreform werden eher reduziert werden."
Hans Voß, selbst GEW-Funktionär, bestätigt das. Mit Einführung des achtjährigen Gymnasiums hätten sowohl die psychische wie auch die physische Belastung der Schüler zugenommen. Für Lehrer bedeute G8 ebenfalls erhebliche Mehrarbeit. "Konkret haben sich die Anwesenheitszeiten in der Schule ausgeweitet, weil der Nachmittagsunterricht zur Regel wird." Dieser Zuwachs entstehe vor allem durch zusätzliche Freistunden zwischen den Unterrichtseinheiten, die den Stundenplan der Lehrer auseinander reißen. Oft gebe es keine andere Möglichkeit, als diese Zeit in der Schule zu verbringen. Freistunden gelten aber als Freizeit - und werden nicht auf das Arbeitspensum der Lehrer angerechnet. "Das wäre ja alles halb so schlimm, wenn wir diese Zeit auch produktiv nutzen könnten", sagt Voß. Doch für die Korrektur von Klausuren und die Vorbereitung neuen Unterrichtsstoffs fehlten oft die Arbeitsräume. So erledigen viele Lehrer ihre "Hausaufgaben" nach Dienstschluss, und treiben damit ihre Wochenarbeitszeit auf zum Teil weit über 50 Stunden hoch.
Hinzu komme noch, speziell für Hamburg, eine neue Arbeitszeitverordnung. So bleibe kaum noch Zeit für außerschulische Aktivitäten, wie zum Beispiel die Betreuung von Arbeitsgemeinschaften oder Nachhilfestunden für schulisch Schwächere.
Schüler beklagen den hohen Stressfaktor
Eine Schülerbefragung der Sozialpädagogin Edda Georgi, Elternbeiratsmitglied einer Hamburger Schule, kam im Jahr 2006 zu dem Schluss, dass Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 15 durch das achtjährige Gymnasium hohen psychischen und physischen Belastungen ausgesetzt sind. Danach beklagen 55 bis 70 Prozent der Befragten ausgeprägte Müdigkeits- und Erschöpfungszustände. Bis zu 50 Prozent leiden unter Kopfschmerzen. Und maximal 22 Prozent beschrieben ihren körperlichen Zustand durch den Schulstress insgesamt als "erschöpft".
Der Befragung nach hat das G8-Gymnasium auch Auswirkungen auf das Sozialleben. Bis zu 76 Prozent der Schüler verzichten demnach auf außerschulische Aktivitäten und ehrenamtliches Engagement. Eine beträchtliche Anzahl der Befragten gibt ebenfalls an, der langen Unterrichtszeiten wegen keinen Musikunterricht mehr nehmen zu können oder sportliche Aktivitäten zurückfahren zu müssen. Und bis zu 55 Prozent müssen aufgrund des hohen Leistungsdrucks zusätzlichen Nachhilfeunterricht nehmen.
Keine Zeit mehr für ehrenamtliche Tätigkeiten
Zu ähnlichen Ergebnisse kommt auch eine Befragung des Gesamtelternbeirates Konstanz. Dort müssen zwei Drittel der Kinder und Jugendlichen nach Angaben der Eltern jede Woche mehr als zwei Stunden über die üblichen Hausaufgaben hinaus lernen, fast ein Viertel der Schüler sitzt sogar mehr als fünf Stunden wöchentlich hinter den Büchern - und das, wohlgemerkt, nach einem annähernd ganztägigen Unterricht. Auch für die Konstanzer Eltern bedeutet das Mehreinsatz: 38 Prozent von ihnen lernen mehr als zwei Stunden in der Woche gemeinsam mit ihren Kindern für die Schule.
"Ich habe Schüler in Medienerziehung, die gehen um zehn nach vier heim, und müssen dann noch Schulaufgaben machen", sagt Voß. Die neue Vollzeitbelastung habe nicht nur Auswirkungen auf das persönliche Wohlbefinden der Schüler. Auch er beobachtet, dass sich der Fokus der Kinder und Jugendlichen immer mehr auf den schulischen Leistungen liege. Für ehrenamtliches Engagement bleibt da keine Zeit mehr. "Wenn Jugendliche nur die Wahl zwischen Klausurvorbereitung und Kreisschülerrat haben, dann ist es doch klar, wie die meisten sich entscheiden."