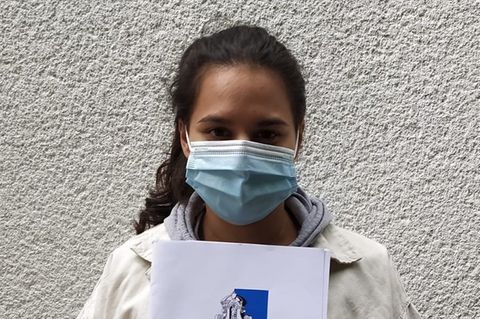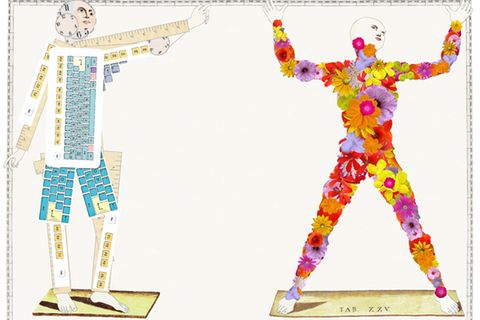Nicht erst seit der Pisa-Studie ist bekannt, wie schlecht die Aufstiegschancen für Kinder aus sozial schwachen Familien in Deutschland sind. Die erste "World Vision Kinderstudie" legt nun offen, dass nicht allein Elternhaus und Schule, sondern auch die Freizeitgestaltung der Kinder wesentlich für deren schulischen Erfolg verantwortlich ist.
Gerade in der Freizeit sammeln Kinder eigene Lern- und Sinneseindrücke. Um das zu zeigen, haben die Sozialwissenschaftler in ihrer Studie einige der befragten Kinder porträtiert. Wenn also die elfjährige Kristina aus Niedersachsen einen Nachmittag pro Woche mit Reiten verbringt und die sechsjährige Emma aus Mecklenburg-Vorpommern regelmäßig bei ihren Großeltern im Garten schaukelt, ist das für die Entwicklung der Kinder besser, als wenn sie wie Kevin aus München viel Zeit mit Computerspielen oder vor dem Fernseher verbringen.
Freizeitverhalten entscheidet über Lernerfolg
In der Freizeit entscheidet sich - so ein wesentliches Ergebnis der World Vision Kinderstudie - wie Kinder mit dem Lernen in der Schule zurechtkommen. Dabei macht es wesentliche Unterschiede, ob die Eltern etwa sportliche Aktivitäten ihrer Kinder finanzieren können oder ob Kinder mit dem relativ günstigen Freizeitvergnügen Fernsehen vorlieb nehmen müssen, schreiben die Forscher Klaus Hurrelmann und Sabine Andresen in ihrer Studie.
Wenn Kinder täglich mehr als drei Stunden fernsehen, ist das "ein absolutes Risikosignal für die gesunde und anregende Weiterentwicklung von Kindern", schreiben Hurrelmann und Andresen. Dass Fernsehen bei vielen Eltern nicht hoch angesehen ist, war vielen für die Studie befragten Kindern klar. Die Sozialwissenschaftler bekamen den Eindruck, die Jungen und Mädchen rechneten ihren TV-Konsum schön.
Kinder klagen über Zeitmangel der Eltern
Doch es sind nicht nur die finanziellen Zwänge, durch die die Kinder benachteiligt werden. Gerade Kinder, deren Eltern keiner geregelten Arbeit nachgehen, beklagen den Zeitmangel der Bezugspersonen sowie fehlende gemeinsame Gespräche und Unternehmungen. Eine Situation, mit der die betroffenen Kinder durchaus unterschiedlich umgehen, wie die Porträts einiger befragter Heranwachsender zeigen.
Kevin verfügt über einen so großen Freundeskreis, dass er auch ohne feste Freizeitaktivitäten große Freiräume hat und dort Erfahrungen und Eindrücke sammeln kann. Doch seine bisherige Schullaufbahn bereitet dem Jungen Sorgen und er wünscht sich, schlauer zu sein: "Ich bin jetzt momentan in der Hauptschule. Da kann man ja nicht viel mit anfangen, wenn man groß ist", sagt er.
"Nicht, dass ich Millionär bin, oder so"
Und während Kristina sich für ihre Zukunft gleich einen ganzen Reiterhof wünscht, bleibt der in einem Münchener Hochhaus wohnende Kevin relativ bescheiden: er will später in einem Einfamilienhaus leben. "Und das Geld passt schon. Nicht, dass ich Millionär bin, oder so", sagt er und wünscht sich schlicht einen Arbeitsplatz.
Dass sich die Lebenssituation und die Zukunftsaussichten für Kinder wie Kevin verbessern, ist eine Motivation für die Macher der Studie im Auftrag von World Vision. Sie fordern, dass für alle Kinder ein Umfeld geschaffen wird, das ihnen möglichst viel Platz für eigene Erfahrungen und Aktivitäten läßt. Hier ist auch die Bundesregierung in der Pflicht, die nach Einschätzung der Forscher nun mit Überlegungen für eine verbesserte Kinderbetreuung zaghafte Schritte in die richtige Richtung unternimmt.
Ganztagesbetreuung würde helfen
Denn eine flächendeckende Ganztagesbetreuung von Kindern würde nach Einschätzung der Soziologen nicht das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern stören, sondern vielmehr den Kindern ein anregendes Umfeld sichern und die Eltern unterstützen, die verbleibende Zeit intensiver mit ihren Kindern zu verbringen. Die Eltern brauchen dafür aber auch Arbeitsplätze, die ihnen mehr Zeit für ihre Kinder einräumen. Entscheidend sind auch ausreichende Angebote für den Nachwuchs in der Nähe der elterlichen Wohnung. Denn Hilfe, da sind sich die Forscher sicher, brauchen alle Eltern zumindest phasenweise. Und das gilt unabhängig von ihrer jeweiligen sozialen Schicht.