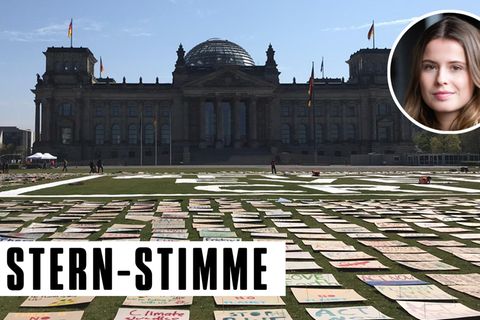Glücklich darf sich ab heute fühlen, wer kein Autohändler ist. Denn mit dem Ende der Abwrackprämie droht ein Absatzloch, in dem man sich wirtschaftlich leicht zu Tode stürzen kann. Tausende Händler könnten nach Expertenmeinung im kommenden Jahr Bankrott gehen, bis zu 100.000 Arbeitsplätze werden in ihrer Branche gestrichen werden müssen.
Die politisch Verantwortlichen dürften sich bis dahin schon ihrer Verantwortung entzogen haben. Denn bis sich die ganze Misere offenbart hat, sind die Bundestagswahlen vorbei und vermutlich gibt es viele Wähler, die dabei noch ihre Kreuzchen bei CDU, CSU und SPD gemacht haben - also exakt bei denen, die es verbockt haben. Denn was die Große Koalition mit fünf Milliarden Euro aus der Kasse von uns Steuerzahlern mit der Abwrackprämie gemacht hat, war eindeutig Schrottpolitik.
Sozialpolitik über den Automarkt
Gut daran war lediglich, dass finanzschwächere Bundesbürger ihre Rostschüsseln gegen ein neues Auto auswechseln konnten, teilweise mit einer Eigenleistung von nur wenig über 5000 Euro - Sozialpolitik über den Automarkt. Doch wer näher hinschaut, kann nur zu einer negativen Bilanz dieser Krisenaktion kommen: Ein teures ökonomisches Strohfeuer, entzündet mit dem alleinigen Ziel der Regierungsparteien, sich vor der Bundestagswahl noch einmal im wärmenden Licht zu präsentieren.
Eindrucksvoll, was alles auf der Negativseite dieser Abwrackprämie steht. Da wurden fünf Milliarden Steuergeld ohne jede ökologische Zielsetzung verbraten. Rostschüsseln gegen Benzinfresser einzutauschen, was ja möglich war, hat doch keinen Sinn. Wenigstens hätte man die Prämie auf den Kauf umweltfreundlicher Autos beschränken müssen. Unterm Strich jedoch wurde vor allem ausländischen Herstellern der deutsche Markt geöffnet, auch jenen, die kein ökologisches Bewusstsein im Tank haben.
Überkapazitäten noch vorhanden
Dass auch die deutschen Hersteller kleinerer Autos profitierten, stimmt. Man muss jedoch die dort geretteten Arbeitsplätze mit denen verrechnen, die bei den deutschen Zulieferern in der Zwischenzeit verloren gegangen sind. Die Zulieferer haben ein Umsatzminus gegenüber dem Vorjahr von gut 30 Prozent zu verkraften. Und das jetzt kommende Auftragsloch wird die roten Zahlen in ihren Bilanzen fortschreiben.
Eine ökonomische Rechtfertigung dieser Spendenaktion gibt es bis heute nicht. Die globale Krise auf dem Automarkt ist damit keineswegs ausgeräumt, unverändert sind die Produktionskapazitäten um Millionen Autos zu hoch, Opel eingeschlossen, selbst dann, wenn sich die neuen Märkte in Indien und China so massiv entwickeln sollten, wie die Hersteller hoffen.
Kein Steuervorteil für Werksangehörige
Den deutschen Kernmarken BMW, Daimler und Audi ist ohnehin kaum in der Krise geholfen worden. Sie haben von der Schrottprämie nicht profitiert. Und wenn die Politik auch nur halbwegs sozial gerecht gedacht hätte, dann hätte das Bundesfinanzministerium dafür gesorgt, dass die Werksangehörigen, die ihre Wagen mit erheblichem Preisnachlass von ihrem Arbeitgeber kaufen können, diesen geldwerten Vorteil nicht komplett versteuern müssen. Doch nichts ist geschehen. Mit Gleichbehandlung der Wähler hat das nichts zu tun. Das sollten sich die Wähler merken, wenn sie das nächste Mal ihr Kreuzchen machen.