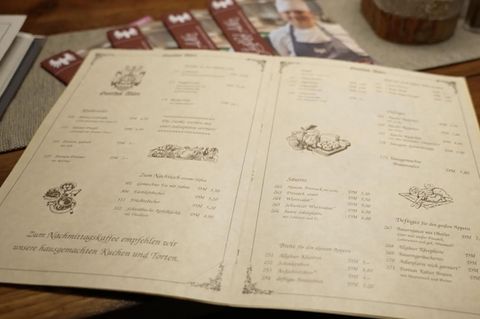Wenn man den Gazetten glaubt, dann ist der FC Bayern entweder "unter Druck", "zittert um den Titel" oder hat einen "Stotterstart" in die Rückrunde hingelegt. Dass die Deutsche Presse-Agentur Borussia Dortmund gar zum neuen Favoriten auf den Meistertitel ausruft, weil der BVB jetzt erstmals wieder auf Tabellenplatz eins steht, ist ebenfalls etwas merkwürdig, zumal nach dem Dortmunder Sieg in Nürnberg bei Bayerns gleichzeitigem Unentschieden in Hamburg.
Diese Skepsis gegenüber den üblichen Momentaufnahmen kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Münchner echte Probleme haben. Seit dem zehnten Spieltag hat der FC Bayern in der Bundesliga 19 Punkte gesammelt - Dortmund 27. Es ist also nicht an den Haaren herbeigezogen, wenn man konstatiert, dass sich etwas ändern muss, wenn der Rekordmeister am Ende der Saison an der Tabellenspitze stehen will.
Was aber sind die Probleme der Münchner genau? Dortmund spielte in Nürnberg gar nicht einmal besser als die Bayern am Folgetag. Aber die Art und Weise, in der Dortmund das erste Tor erzielte und damit den Willen einer bis dahin aufopferungsvoll kämpfenden Club-Elf brach, gibt interessante Aufschlüsse darüber, was der BVB richtig macht.
Dortmund, die Antithese zu Bayerns Spiel
Warum fällt es den Bayern so schwer, tief stehende, kompakte Gegner zu überwinden, was doch zu Saisonbeginn noch gelang? Um sich zu fragen, warum eine Standardsituation den Ausgleich in Hamburg brachte, anstatt eines herausgespielten Tors, so muss man sich ansehen, wie lange es dauert, bis der Ball von einer Spielfeldhälfte zur anderen befördert wird. Und das, so schmerzhaft es sein mag, mit dem Dortmunder Führungstor in Nürnberg vergleichen.
Kurz nach Wiederanpfiff verschob der BVB das ganze Spiel an die linke Seitenauslinie. Shinji Kagawa war aus der Zentrale dorthin gekommen und hatte Almog Cohen mit nach außen gezogen, der Markus Feulner dabei helfen wollte, Kagawa zu doppeln, falls der Japaner den Ball bekommen sollte. Weiter hinten hatten Marcel Schmelzer und Moritz Leitner eine Überzahlsituation gegen Jens Hegeler erzeugt, der ein kurzes Anspiel Schmelzers auf Leitner nicht verhindern konnte.
Timmy Simons, Nürnbergs zweiter Sechser neben Cohen, stand tief vor der eigenen Kette, die sehr weit nach rechts mit aufgerückt war. Inzwischen aber war Lukasz Piszczek ganz links aus Dortmunder Sicht nach vorne gestartet, im Rücken von Christian Eigler und auch Linksverteidiger Adam Hlousek. Weder Simons noch Hlousek wussten den Diagonalpass Leitners auf Piszczek zu verhindern.
Dominic Maroh hatte inzwischen einen impulsiven Schritt aus der Abwehr nach vorne gemacht, vielleicht, um ohne Absprache mit Philipp Wollscheid auf Abseits zu spielen, vielleicht, um den Pass Leitners noch abzufangen. In die von Maroh so verursachte Lücke stießen nun blitzschnell Robert Lewandowski und Kuba, Piszczek nahm derweils rechtsaußen den Ball an.
Drei Anspielstationen, ein fast zwingendes Tor
Auch Sebastian Kehl hatte sich, vom falsch postierten Simons, der damit beschäftigt war, sich in der plötzlich obsolet gewordenen Grundordnung neu zu orientieren, in Richtung Strafraum bewegt. Vier Dortmunder in der Vorwärtsbewegung standen nun plötzlich zwei Nürnberger Defensivspielern gegenüber, Wollscheid und Hlousek. Diese Konstellation sieht man bei den Dortmundern immer wieder, auch der HSV ließ zwei Wochen vorher oft solche Unterzahlszenen zu, weil die BVB-Mannschaft einfach so schnell auf sich verändernde Spielsituationen zu reagieren weiß.
Piszczek hatte so, als er mit dem Ball an der Grundlinie angekommen war, gleich drei mögliche Anspielstationen, die in aussichtsreicher Abschlussposition gewesen wären: Lewandowski und Kuba, die beide Richtung langer Pfosten unterwegs waren und keine direkten Gegenspieler mehr hatten, sowie Kehl, der im Slot kurz hinter der Strafraumgrenze wartete. Auf den Kapitän passte Piszczek dann auch, und Kehl traf zum 0:1 in die lange Ecke.
Nicht das Tor des Jahres, nicht das Tor des Monats, und auch nicht das schönste Tor des Spieltages - aber ein typisches Dortmund-Tor, weil die ganze Mannschaft in den Spielzug involviert war und unter Nutzung der gesamten Spielfeldbreite eine Strafraumsituation schuf, in der drei Spieler zum Torabschluss hätten kommen können. Wenn man so etwas regelmäßig macht, dann gewinnt man auch regelmäßig seine Spiele.
Ballverlust = Gegentor, so sechsmal in der Rückrunde gegen Dortmund
Beim zweiten Tor reichten dann vier Dortmunder, um aus einem Ballverlust von Simons in 4:2-Überzahl für den Club in der eigenen Hälfte auf einmal eine 2:3-Situation aus Clubsicht entstehen zu lassen, die direkt dafür verantwortlich war, dass Lucas Barrios im Nachschuss traf, nachdem Raphael Schäfer zuvor Kagawas Schuss stark pariert hatte.
Und nun noch einmal der Vergleich zum FC Bayern: Dortmund hatte in Nürnberg nur elf Torschüsse in 90 Minuten, Bayern in Hamburg doppelt so viele. Das, was man zwingende Abschlusssituationen nennt, vermag München momentan aber nicht herauszuspielen. Alle vier Rückrundentreffer der Bayern fielen nach Standards. Der BVB erzielte im gleichen Zeitraum zehn Tore, von denen neun aus dem Spiel heraus fielen, sechs von diesen als direkte Konsequenz von gegnerischen Ballverlusten, auf die die Schwarzgelben jeweils schneller reagierten als der Gegner.
Warum diese Zahlen wichtig sind? Weil selbst, wenn Bayern seine schwarze Serie gegen den BVB in der Rückrunde mit einem Sieg in Dortmund beenden sollte, der Meistertitel vermutlich in den Spielen gegen die vielen defensiver orientierten Teams der Liga entschieden wird. Und diese haben inzwischen ganz gut herausgefunden, wie man gegen Bayern spielt, vor allem zu Hause.
Auch ist Bayern zu abhängig von der Form einzelner Spieler, vor allem Franck Ribéry, Mario Gomez und Bastian Schweinsteiger. Wenn sie nicht zurecht kommen, so gibt es für einen Club dieser Größe erstaunlich wenige Alternativen. Anders in Dortmund, wo selbst Ausfälle von Mario Götze und Sven Bender gleichzeitig nichts daran änderten, dass das Mannschaftsgefüge funktionierte.
Daniel Raecke