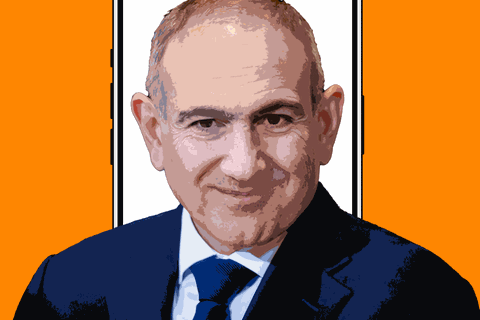Der Amerikanische Traum vom Ende der Rassentrennung in US-Schulen bleibt noch immer unerfüllt. Vor 50 Jahren ebnete der Oberste Gerichtshof in Washington mit einer Grundsatzentscheidung den Weg für die Gleichberechtigung in den Schulen. Die Trennung von schwarzen und weißen Kinder sollte 100 Jahre nach Ende der Sklaverei in den USA endlich aufgehoben werden. Aber eine jüngst veröffentlichte Studie der Harvard Universität (US-Bundesstaat Massachusetts) kommt zu einem düsteren Ergebnis: Noch immer bleiben in den USA weiße wie schwarze Schüler meistens unter sich.
Nach der Grundsatzentscheidung von 1954 gab es zunächst durchaus erfolgreiche Integrationsbemühungen - 1988 besuchten im Süden der USA immerhin 43 Prozent der schwarzen Kinder Schulen, die als "weiß" galten. Heute allerdings sei die Rassentrennung in den US-Schulen auf dem Stand von 1969, so die Harvard-Studie. Inzwischen gingen nur noch 30 Prozent der schwarzen Kinder auf "weiße" Schulen.
Sie bleiben in ihren Vierteln
Als eine Ursache nennen die Wissenschaftler ein anderes Urteil des Obersten Gerichtshofes aus dem Jahre 1991, das in manchen Fällen so genannte Nachbarschaftsschulen erlaubte. Anstelle des heftig umstrittenen "busing" - bei dem Kinder mit Bussen von Bezirk zu Bezirk gefahren wurden, um integrierte Schulen zu ermöglichen - können die Kinder seitdem in ihrem eigenen Viertel zur die Schule gehen. Damit aber bleiben die Schüler in ihrem gewohnten sozialen Umfeld - in den reichen, meist weißen Vierteln ebenso wie in den schwarzen, oft ärmeren Vororten Washingtons oder Baltimores.
"Martin Luther Kings Traum wird zwar oft gepriesen, aber die Wirklichkeit sieht ganz anders aus", sagt der Autor der Studie, Gary Ortfield, in Anspielung an den berühmten Bürgerrechtler und dessen Kampf für Rassengleichheit.
"Rassentrennung bedeutet immer auch ein finanzielles Gefälle"
Das soziale Gefälle zwischen Weißen und Schwarzen präge oft auch die Qualität der Schulen. Da sie einen Teil ihres Etats vom jeweiligen Schulbezirk bekommen, gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen örtlichem Wohlstand und schulischer Ausstattung. "Rassentrennung bedeutet immer auch ein finanzielles Gefälle", so der Bildungsdirektor der Nationalen Gesellschaft für den Fortschritt von Farbigen, John Jackson. Die Benachteiligung in der Schule setze sich dann fort: Die Chancen auf einen Platz an einer guten Universität sind schlechter, ebenso die Aussichten auf einen guten Job.
Das Einkommensgefälle zwischen den Rassen ist statistisch belegt. Weiße verdienten durchschnittlich pro Woche 633 Dollar (etwa 512 Euro), Schwarze 509 Dollar, Latinos sogar nur 444 Dollar. Die Bildungskluft sei dafür wesentlich mitverantwortlich, meint Jackson. Weitaus mehr Weiße als Schwarze haben einen Universitätsabschluss - entsprechend höher sind die Gehälter. Ein schwarzer Bürger hat im US-Durchschnitt gerade mal 56 Prozent des Vermögens seines weißen Nachbarn, so ein Bericht der Hilfs-Organisation "National Urban League".
Die erfolgreichen Schwarzen sind nicht repräsentativ
Bürgerrechtler beklagen, dass auch 150 Jahre nach der Abschaffung der Sklaverei Schwarze noch immer nicht mit den Weißen gleichgezogen haben. Zwar gebe es erfolgreiche schwarze Unternehmer, Wissenschaftler oder auch einige Politiker - wie zum Beispiel Außenminister Colin Powell oder die nationale Sicherheitsberaterin Condoleezza Rice. Aber diese seien nicht repräsentativ für die US-Gesellschaft.