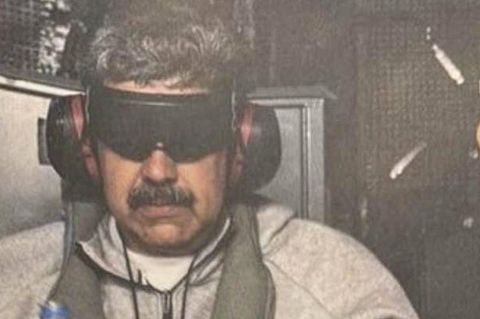"Das ist ein kritisches Signal in Richtung des Europäischen Patentamts", sagt Oliver Lorenz, Justiziar beim deutschen Softwarehersteller Magix gegenüber stern.de nach der Entscheidung des EU-Parlaments, die Softwarepatent-Richtlinie zu kippen.
"Softwarepatente sind nicht nur ein Job- und Konjunkturkiller, sondern gefährden auch die Pressefreiheit", meint Joachim Jakobs, Sprecher der Free Software Foundation.
"Wenn wir unsere Innovationen nicht schützen können, ist unser Aufwand für die Katz", warnt Herbert Heitmann vom Softwarehersteller SAP.
Drei Aussagen zum selben Thema, obwohl sie auf den ersten Blick kaum etwas miteinander zu tun zu haben scheinen. Seit dem Jahr 2001 wird in Europa um Softwarepatente gestritten, ein staubtrockenes, komplexes und kontrovers diskutiertes Sujet - mit dem die wenigsten Alltagscomputernutzer etwas anfangen können. Grund genug, ein wenig Licht in das Dunkel zu bringen.
Patent- und Urheberrecht
Zunächst gilt es zu verstehen, wofür Patente erteilt werden können. Ein Patent gewährt einem Erfinder ein Eigentumsrecht, das jeden anderen daran hindert, diese Erfindung frei zu nutzen. Es wird von einer Behörde für einen begrenzten Zeitraum eingetragen, meist für 20 Jahre. Traditionell beziehen sich Patente auf technische Erfindungen, die sich in materielle Güter überführen lassen. Natürlich werden in immer mehr modernen Produkten Prozesse per Computersoftware gesteuert.
Reine Software hingegen wird bisher in Europa durch das Urheberrecht geschützt, sie gilt als immaterielle Schöpfung, ebenso wie Literatur oder Musik. Allerdings schützt das Urheberrecht nur die konkrete Ausformung einer Software, nicht die dahinter stehende Idee. Beispiel: Der Programmcode von "Photoshop" ist urheberrechtlich geschützt, aber nicht die Idee, digitalisierte Bilder am Rechner zu bearbeiten.
Manche Aktivisten betrachten jede Software - da es sich um eine Anreihung von Zeichen handelt - als ein literarisches Werk, das durch das Recht auf freie Meinungsäußerung geschützt sei und schon deshalb nicht patentiert werden könne.
Die Lage in den USA
In den USA herrscht eine völlig andere Kultur der Patenterteilung: Seit Mitte der 90er Jahre ist es in den Vereinigten Staaten offiziell möglich, auch die Programmen zugrunde liegenden Ideen patentieren zu lassen. Seit 1999 lassen sich sogar auf Geschäftsideen Patente beantragen. Diese Möglichkeiten führten zu Auswüchsen, nämlich einer Vielzahl von Patenten, die offensichtliche oder banale Vorgänge schützen ("Trivialpatente").
Beispiele:
- Der Fortschrittsbalken, der zum Beispiel den Fortschritt beim Kopieren von Dateien oder dem Laden einer Webseite anzeigt
- Das "1-click"-Verfahren von Amazon, bei dem man mit nur einem Mausklick eine Bestellung auslösen kann, ohne noch einmal Adressen und Rechnungsdaten eingeben zu müssen
- Die British Telecom beanspruchte im Jahr 2000, ein Patent auf den "Hyperlink" im Internet zu besitzen - und zwar seit 1976. Ein New Yorker Gericht erklärte allerdings 2002, dass sich das Patent nicht auf das Internet beziehe.
Streit um Interpretationen: Europa
Das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ) regelt seit 1973 das Patentrecht innerhalb der EU und wurde nach und nach in den Mitgliedsstaaten Teil des nationalen Rechts.
"Programme für Datenverarbeitungsanlagen" sind laut EPÜ von der Patentierung ausgeschlossen. Aufgrund umstrittener Interpretationen, was Software "als solche" ist und wann sie ein "technischer Beitrag" zu einer geschützten Erfindung ist , akzeptiert das Europäische Patentamt (EPA) in München viele Anträge. Experten schätzen, dass bereits rund 30.000 Softwarepatente in Europa existieren - zum Großteil beantragt von amerikanischen und japanischen Firmen, die die entsprechenden Patente in ihren Ländern bereits besitzen. "Die meisten großen Firmen wenden ihre Patente in Europa aber nicht an, weil sie um ihr Image besorgt sind", so Jurist Lorenz.
Um die Patenterteilungspraxis in den Mitgliedsländern der EU zu harmonisieren, hat die Europäische Kommission 2002 eine neue Richtlinie für "computerimplementierte Erfindungen" vorgeschlagen. Der Begriff "Softwarepatent" wird bewusst nicht verwendet, da - wie beschrieben - ein reines Programm keine Erfindung sein kann. Der Vorschlag für die Richtlinie orientierte sich an dem umstrittenen Vorgehen des Europäischen Patentamtes. Obwohl von Anfang an die gefürchteten Trivialpatente explizit nicht vorgesehen waren, sahen viele Kritiker vielfältige Gefahren für die Software-Entwicklung in Europa.
Argumente der Befürworter der Richtlinie
Software ist das Ergebnis von Arbeit, für die Unternehmen viel Geld ausgeben. Mit Hilfe von Patenten wollen sie ihre Innovationen vor Nachahmung schützen. Die deutsche Software-Firma SAP hat in Europa bislang 24 Patente angemeldet, darunter eines für eine verlässliche Suche in großen Datenbeständen. "Wir haben da viele Mannjahre an Entwicklung reingesteckt", sagte SAP-Sprecher Herbert Heitmann der Nachrichtenagentur AP. "Wenn wir das nicht schützen könnten, wäre unser ganzer Aufwand für die Katz."
Ohne die Richtlinie befürchtet SAP eine Schwächung seiner Wettbewerbsposition in Europa gegenüber Konkurrenten aus den USA und Asien. "Die hätten dann hier ein leichteres Spiel", erklärt der SAP-Sprecher. Zugleich kritisiert er, dass es in der Debatte immer so dargestellt werde, als ob Softwarepatente nur den großen Unternehmen nützen würden. Eine selbst entwickelte Software-Lösung sei gerade für mittelständische Firmen von zentraler Bedeutung. "Wenn sie das nicht schützen können, sind sie anderen wehrlos ausgeliefert."
Argumente der Gegner
Patentierung von Software führe zu Bedingungen, die freiberuflichen Programmierern und kleinen oder mittelgroßen Firmen die Entwicklung von Programmen unzumutbar erschwere, weil
- ihnen durch Trivialpatente ständig Gefahr drohe, beim Schreiben von Code unwissentlich Patente zu verletzen;
- eine Patentsüberprüfung extrem zeit- und geldaufwändig und schwierig sei;
- Patentrechtsprozesse kleine Firmen ruinieren könnten;
- die patentinhabenden Großkonzerne eine wirksame Waffe gegen kleine Konkurrenten hätten.
Außerdem stünden Patente im Widerspruch zum Prinzip von freier Software. Die Offenlegung des Codes ist das Erfolgsgeheimnis für Open-Source-Projekte wie das freie Betriebssystem Linux. Dabei werden oft einfache Code-Schnipsel für bestimmte Funktionen wie Bausteine in größere Programme integriert. Bei einer Patentierung gängiger Funktionen fürchten die Programmierer juristische Ansprüche.
Und schließlich stehen die ersten Firmen bereit, die nichts anderes tun, als ein paar Patente zu beantragen und Geld damit zu verdienen, indem sie wegen Verstößen vor Gericht ziehen.
Die jetzt erfolgte Ablehnung der EU-Richtlinie sei, so Magix-Jurist Lorenz, nur die zweitbeste Lösung gewesen. Die beste hätte explizit ein "Verbot von Softwarepatenten" beinhaltet. Die Sorge vor amerikanischen Verhältnissen ist groß, auch wenn der Richtlinienentwurf weit davon entfernt war. "Wir dürfen die Fehler der USA nicht wiederholen", insistiert Lorenz.