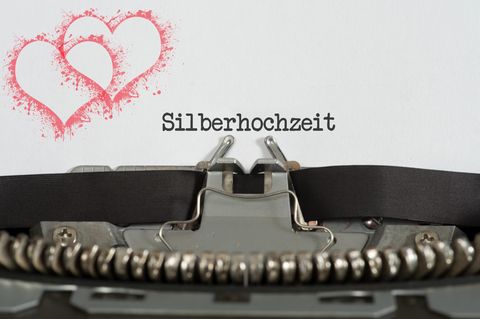Wer wurde wann von wem mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 angesteckt? Als die Corona-Warn-App vor einem Jahr veröffentlicht wurde, war die Spurensuche noch alleine Sache der Gesundheitsämter. Die App sollte es leichter machen, auch dann einen Kontakt zwischen Personen feststellen zu können, wenn die sich vielleicht gar nicht kennen. Gleichzeitig galt es aber auch, den Spagat bei der Privatsphäre zu schaffen. Konnte die App die hochgesteckten Erwartungen erfüllen? Das kommt darauf an, wen man danach fragt.
"Die Corona-Warn-App ist gut in das alltägliche Leben, die Versorgung und das Testgeschehen integriert", erklärte etwa das Gesundheitsministerium gemeinsam mit dem Robert Koch-Institut auf eine Anfrage des stern. "Und sie erfüllt ihre Funktion: Sie unterbricht Infektionsketten und dies zum einen schnell und zum anderen in vielen Fällen dort, wo Menschen das Risiko einer Infektion selbst nicht erkennen können", führt man zufrieden aus.
Das Gesundheitsministerium ist zufrieden
Dabei würde die App vor allem einen an sie gestellten Anspruch erfüllen: Sie warnt auch dann, wenn den Betroffenen der Risikokontakt gar nicht bewusst war. "Aus der Nutzerbefragung wissen wir, dass über zwei Drittel der Befragten durch die Anzeige des erhöhten Risikos überrascht werden", erklärt der Ministeriums-Sprecher. Dadurch würde sie besonders wertvoll, wenn das Risiko nicht gut kalkulierbar sei, etwa bei Kontakten außerhalb der Familie oder des Arbeitsplatzes.
Auch mit den Installationszahlen ist man zufrieden, erklärt die Behörde. Eine zu Beginn von der Uni Oxford berechnete Mindestnutzungsanzahl von 60 Prozent der Bevölkerung wurde zwar nie erreicht. Mit 28,5 Millionen Downloads ist sie aber durchaus als Erfolg zu betrachten.
Drei Millionen Warnungen vor hohem Risiko
Das würde auch beim Kampf gegen die Pandemie einen ganz konkreten Nutzen haben. "Mehr als 475.000 Nutzerinnen und Nutzer haben ihr positives Testergebnis geteilt und somit andere Nutzende gewarnt", bestätigte das Ministerium dem stern. Aus Befragungen wüsste man, dass jeder der positiv getesteten Nutzer im Schnitt sechs Menschen vor einem hohen und weitere 20 vor einem niedrigen Risiko der Ansteckung warnt. Alleine im April diesen Jahres hätte man wegen 4000 täglicher positiv eingetragener Testergebnisse mehr als 25.000 Menschen am Tag über ein hohes Infektionsrisiko informieren können.
Insgesamt seien laut Hochrechnungen mehr als drei Millionen "rote" Warnungen ausgeben worden, von denen sich dann etwa sechs Prozent im darauffolgenden Test als tatsächlich infiziert herausgestellt hätten. Demnach wären also 180.000 zusätzliche Infektionen durch die Warnungen entdeckt worden.
Schwerer Start
Das war nicht immer abzusehen. Als die Corona-Warn-App am 15. Juni 2020 endlich veröffentlicht wurde, hatte sie schon eine mächtige Entwicklung hinter sich. Zuerst von dem sperrig benannten PEPP-PT-Konsortium geplant, sollte sie eigentlich auf jedem Smartphone ständig im Hintergrund laufen und eine konstante Bluetooth-Verbindung halten. Die Vorbilder, etwa eine App aus Singapur, waren genau deswegen gescheitert: Sie hatten schlicht zu viel Akku verbraucht. "Eine App, die in wenigen Stunden den Akku des Handys leer zieht, nutzt keiner", stellte Minister Spahn passend in einem Interview damals fest.
Erst als Apple und Google gemeinsam eine datenschonende Schnittstelle anboten, die die Kontakte anonym im Hintergrund sammelte, konnte die App in der jetzigen Form entstehen. Doch die Privatsphäre- und Sicherheitsbedenken blieben zunächst. "Der größte Fehler der Regierenden war, dass sie im Vorhinein von Standortabfrage und Vorratsdatenspeicherung fantasiert haben", war sich Datenschützerin Rena Tangens vom Verein Digital Courage schon zum Start sicher.
Hart erarbeitetes Vertrauen
Das dadurch verlorene Vertrauen musste die App erst mühselig wieder aufbauen. Dabei half sicher auch das klare Urteil des Chaos Computer Clubs. Die Hacker hatten sich die App kurz vor Start ansehen können. Und ein klares Urteil gefällt: "Da kann man nicht meckern", musste CCC-Sprecher Linus Neumann zugeben – und lies an seinem Grinsen erkennen, dass er es wirklich gerne getan hätte. Die Entwicklung durch Telekom und SAP, beide nicht als CCC-Lieblinge bekannt, sei "vorbildlich gelaufen", attestierte er stattdessen.
Auch Tangens, die damals noch hart mit der App ins Gericht ging, sieht sie heute in besserem Licht. "Vieles, was wir damals bemängelt hatten, wurde im Laufe der Zeit nachgebessert", gibt sie mit Verweis auf die Regeln des Vereins zur Erstellung von guten Apps zu.
Das lange Warten
Die Weiterentwicklung der App dauerte aber deutlich länger als das von vielen erwartet wurde. Monatelang ließen selbst mit wenig Programmieraufwand umsetzbare Funktionen wie ein Kontakttagebuch auf sich warten. Der CCC änderte seine Einschätzung, "die Corona-Warn-App verliert den Anschluss", urteilte Neumann im Oktober hart. Ihm fehle vor allem die immer wieder geforderte Erkennung von Infektionsclustern, klagte er mehrfach.

Auch beim Gesundheitsministerium muss man zugeben, dass die Weiterentwicklung langsamer lief als geplant. "Die Planung und Realisierung einiger Funktionalitäten bedurften aufgrund dieser Komplexität und unserem hohen Qualitätsanspruch sicherlich mehr Zeit, als wir es uns vielleicht manchmal gewünscht hätten", gibt der Sprecher zerknirscht zu.
Platz für Konkurrenten
Die Lücke füllten dann teilweise Apps von Drittanbietern. Die von prominenten Befürwortern wie dem Rapper Smudo unterstützte App Luca etwa ermöglicht es in mehreren Bundesländern, beim Besuch in der Gastronomie oder dem Einzelhandel auf den Papierkram zu verzichten. Wegen unzureichendem Schutz der Nutzerdaten und mehreren Sicherheitslücken zieht sie aber immer wieder Ärger auf sich. "Die Corona-Warn-App ist heute in Bezug auf Datenschutz 1000 Mal besser als die Luca-App", schimpft Tangens über die Alternativ-App.
Erst seit einigen Wochen kann auch die Corona-Warn-App mit ihrer Check-in-Funktion die Lücke selbst füllen. Für den Chef der Gesellschaft für Informatik, Johannes Federrath ist das ärgerlich. "Ich habe die Notwendigkeit der Luca-App nie verstanden. Ich fand von Anfang an wichtig, die Warn-App zu erweitern, um den Menschen mehr Nutzen zu geben. Dann nutzen sie sie eben auch", sagte er dem stern. "Der Nutzen muss alltäglich gezeigt werden. So etwas wie ein Kontakttagebuch oder eben die kommende Check-in-Funktion helfen dabei."
Auch dass seit letzter Woche mögliche Einscannen von Impfnachweisen befürwortet er deshalb. "Es nutzen immer noch zu wenige Menschen die App. Das könnte sich durch die Breitenwirkung des Impfpass-Moduls ändern. Ich sehe das als möglichen Verstärkungsfaktor."
Luft nach oben
"Man hätte klar kommunizieren müssen, dass sehr, sehr viele Menschen dabei mitmachen müssen, damit diese Technologie tatsächlich auch einen Nutzen bringt", glaubt auch die Virologin Melanie Brinkmann. Ohnehin sieht sie das Potential der App noch längst nicht ausgeschöpft. "Die App wurde sehr langsam weiterentwickelt. Sie liefert bis heute nicht so viele Daten und Möglichkeiten zur besseren Pandemiekontrolle wie es möglich und wünschenswert wäre. Sprich: da besteht noch viel Luft nach oben."
Vor allem in Bezug auf epidemiologische Erkenntnisse wäre aus ihrer Sicht mehr möglich. "Ein großes Problem dieser Pandemie war und ist, dass wir nur fragmentarisch und unscharf wissen, wo Infektionen stattfinden", erläutert sie die auch von Neumann geforderte Erkennung von Clustern. "Würde die App die Kontexte aufzeichnen und anonymisiert den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zur Analyse bereitstellen, wüssten wir heute deutlich mehr über das Infektionsgeschehen und könnten viel gezielter und intelligenter agieren, um Infektionen zu verhindern."
Dafür verantwortlich sei vor allem der dezentrale Ansatz der App, der die Privatsphäre der Nutzer schützen soll. In die Privatsphäre hätte man aus Sicht von Brinkmann aber nicht generell eingreifen müssen, um mehr Nutzen aus der App zu ziehen. "Man hätte von vornherein den Nutzerinnen und Nutzern die Option zur Datenspende geben können, also ihnen anbieten sollen, ihre Daten freiwillig zur Verfügung zu stellen, um damit die Pandemiebekämpfung zu verbessern." Die Idee war zum Zeitpunkt des Erscheinens durchaus vorhanden: Mit einer eigenen App konnten die Nutzer Daten an das RKI spenden. In die Warn-App floss die Funktion aber nicht ein.