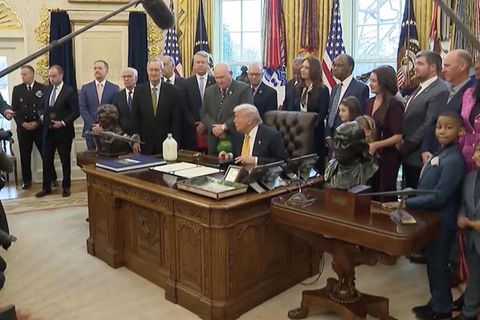"Good morning!" schallt es aus dem hellen Raum in der Berliner Kindertagesstätte Crellestraße. Die Kinder sitzen in einem Kreis, vier Jahre sind sie alt, manche sogar erst drei. Trotzdem sind sie voll bei der Sache. "Good morning!", ruft Jutta, die Englischlehrerin, "good morning!" schallt es zurück, und dann stellt sich jedes Kind vor: "My name is Julian", "My name is Marie...".
Seitdem in der Kita Englisch angeboten wird, sind die Kurse, in denen gesungen und gespielt wird, immer gut besucht. "Die Kinder saugen das alles auf wie ein Schwamm", erzählt eine Mutter. Und auch wenn anfangs nur einzelne Wörter oder Sätze hängen bleiben - die Kinder lernen zumindest, sich mit einer anderen Sprache zu befassen.
"Aufbewahrungsorte" für Kinder
Das ist nicht überall so. Denn anders als in anderen Ländern werden in Deutschland die Einrichtungen des Vorschulbereichs wie Kindergärten und Kindertagesstätten weniger als Bildungsstätten denn als soziale "Aufbewahrungsorte" für Kinder gesehen. Ein falscher Ansatz, meinen viele Experten: "Auf den Anfang kommt es an, deshalb müssen Elementar- und Primarbereich als Teil des Bildungssystems begriffen und deutlich mehr gestärkt werden", erklärt der Vorsitzende des Verbands Bildung und Erziehung (VBE), Ludwig Eckinger. Gerade nach den neuesten Ergebnissen der OECD-Bildungsstudie fordern Experten mehr Investitionen in den Bereich der frühkindlichen Bildung.
Andere Länder, die bei Bildungsvergleichen regelmäßig besser abschneiden als Deutschland und mehr Geld in die frühe Bildungsphase stecken, können dabei als Vorbilder dienen. Der Erziehungswissenschaftler Hans Brügelmann verweist auf Skandinavien oder England, wo Kinder in der Vorschule die Chance bekämen, Lernerfahrungen zu sammeln, dabei aber auf jedes Kind individuell eingegangen werde. Anders als in Deutschland, wo es keinerlei "Lehrpläne" für Kindergärten gibt, hat etwa in Schweden das Erziehungsministerium ein Curriculum für die Vorschule entwickelt.
Der Wille und Wunsch zum Lernen soll angeregt werden
"Die Neugierde, der Ehrgeiz und das Interesse des Kindes sollen bestärkt werden. Der Wille und der Wunsch zum Lernen soll angeregt werden", heißt es in dem Curriculum. Kinder sollten dabei unterstützt werden, Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten zu entwickeln, was aber immer spielerisch geschehen sollen. Außen vor bleiben dabei zweifelhafte Entwicklungen, wie sie etwa in Japan oder den USA zu beobachten sind: Teilweise werden bereits die Kleinsten mit Rechenaufgaben traktiert und Ungeborene per Taschenlampenreflexe auf das Zählenlernen vorbereitet.
Das sei der falsche Weg, betont Brügelmann: "Man sollte die kognitive Entwicklung stimulieren, aber nicht Kinder zu passiven Empfängern von isolierten Elementen machen." Die zurzeit sehr beliebte Theorie von Zeitfenstern für das Lernen, die nur eine bestimmte Zeit geöffnet seien, sei in der Hirnforschung sehr umstritten. Wichtig sei es, soziale Kompetenzen der Kinder zu fördern und sie somit auf das Lernen vorzubereiten - möglichst individuell.
Bei Lernschwierigkeiten auf eine "niedrigere" Schulart schicken
Auch in Deutschland selbst gibt es demnach genug Beispiele für eine frühe, kindgerechte Förderung. "Man kann in Deutschland nicht über 'den Kindergarten' allgemein reden, denn da gibt es ziemlich große Unterschiede", erklärt Brügelmann. "Wir haben gute Ansätze, die man nutzen sollte." So erklärt Claudia Neumann von der Kita Crellestraße ihre Aufgabe damit, Kinder spielerisch zur Schule hinzuführen: "Das heißt nicht, dass sie schon Lesen und Schreiben lernen." Aber Kinder können etwa durch Spracharbeit darauf vorbereitet werden, dass es einen Unterschied zwischen gesprochener und geschriebener Sprache gibt, wie Brügelmann erklärt.
Auch in der Schule sei dann die individuelle Förderung wichtig, betont der Erziehungswissenschaftler. Im selektiven deutschen Schulsystem tendiere man dazu, die Verantwortung auf die Schüler zu schieben und diese bei Lernschwierigkeiten auf eine "niedrigere" Schulart zu schicken. Dabei müssten Lehrer lernen, mit einer größeren Heterogenität innerhalb einer Klasse umzugehen, was gerade in der Grundschule mangels "Abschiebemöglichkeiten" gar nicht anders möglich sei.
Bis zu vier Jahre Unterschied am Schulanfang
"Kinder sind zum Schulanfang teilweise schon drei bis vier Jahre in ihrer Entwicklung auseinander", erklärt Brügelmann. Wichtig sei es deshalb, die Lernerfolge von Kindern im Hinblick auf den Ausgangspunkt zu beurteilen. Und das auch noch nach der frühen Bildungsphase, wie Eckinger erklärt: "Die heterogene Lernkultur muss auch in der Sekundarstufe bestimmend werden, wenn jeder Schüler unabhängig von seiner sozialen Herkunft seine Bildungskarriere gestalten soll."
Mirjam Mohr, AP