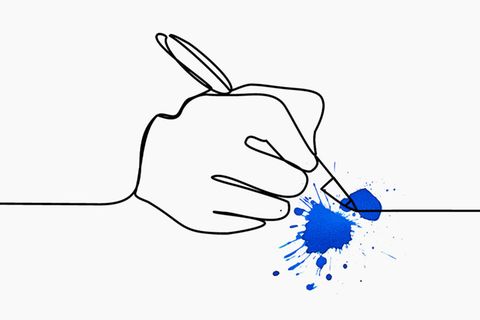Obwohl sie umstritten sind, steigt die Zahl der Kaiserschnitte. Griffen Ärzte früher nur im Notfall zum Skalpell, kommt in Deutschland mittlerweile fast jedes dritte Kind so zur Welt. Dabei gelten Kaiserschnitt-Kinder als anfälliger für Infektionen, Allergien und Asthma. Ein internationales Forscherteam hat nun eine mögliche Erklärung dafür, woran das liegen könnte. Wie Wissenschaftler um María Domínguez-Bello von der University of Puerto Rico in San Juan im Fachmagazin "PNAS" schreiben, weisen Kinder, die per Kaiserschnitt auf die Welt kommen, eine andere bakterielle Besiedlung auf als diejenigen, die auf natürlichem Weg geboren werden.
Bakterien sind nicht nur schädlich, sondern auch nützlich. Allein auf der Haut tummelt sich eine unglaubliche Anzahl: Durchschnittlich drei Millionen finden sich auf jedem Quadratzentimeter unserer Körperoberfläche, je nach Region mal mehr, mal weniger. Diese Mikroorganismen sind gleichsam Wachposten, sie schützen den Menschen vor Infektionen mit gefährlichen Keimen oder verhindern, dass sich diese vermehren. Auch für die Verdauung sind die Bakterien wichtig. Im Mutterleib wachsen Babys in einer keimlosen Umgebung heran, doch kurz nach der Geburt beginnen Bakterien mit der Besiedlung. Die Art der Mikroorganismen ist dabei abhängig davon, auf welchem Weg die Kinder auf die Welt kommen, schreiben die Wissenschaftler.
Staphylokokken statt Milchsäurebakterien
Für Ihre Untersuchung nahmen sie von neun Frauen vor der Geburt Abstriche an den Unterarmen, der Mundschleimhaut und der Vagina. Bei den zehn geborenen Babys - vier auf natürlichem Weg, sechs per Kaiserschnitt - untersuchten sie sofort nach der Geburt ebenfalls die Bakterien auf der Haut, den Schleimhäuten und im ersten Stuhl mit einer DNA-Analyse.
Dabei stellten Domínguez-Bello und ihre Kollegen fest, dass bei allen auf natürlichem Weg geborenen Kindern dort ähnliche Bakterien vorhanden sind, wie sie auch in der Vagina der Mutter vorkommen, darunter Milchsäurebakterien. Nach einem Kaiserschnitt besiedeln vor allem Hautbakterien diese Regionen. Unter ihnen auch die als Krankenhauskeime gefürchteten Staphylokokken. Eine Infektion mit dem Krankheitserreger ist äußerst schwierig zu behandeln, da viele Stämme resistent gegen die gängigen Antibiotika sind. Dies würde auch erklären, warum Kaiserschnitt-Kinder häufiger als andere Babys an einer durch diese Keime verursachten Hauterkrankung leiden. Die Bakterien, die bei ihnen gefunden wurden, stammen wahrscheinlich von Personen, die als Erstes Kontakt mit dem Neugeborenen hatten. Ob sie allerdings von Ärzten, Krankenschwestern oder auch dem Vater übertragen wurden, können die Wissenschaftler nicht sagen.
Schutz vor gefährlichen Keimen
Die direkte Übertragung der mütterlichen Vaginalflora auf das Kind diene vermutlich als Schutz vor der Besiedlung durch Krankheitsauslöser, schreiben die Forscher. Der Geburtskanal ist ein stark von Bakterien besiedeltes Ökosystem, das relativ wenige Arten beherbergt, die jedoch darauf spezialisiert sind, schädliche Krankheitserreger zu vertreiben. Zudem sorgen die Bakterien der Mutter offenbar dafür, dass sich die Darmflora des Neugeborenen entwickelt: Die wichtige Besiedelung des Verdauungstrakts durch gutartige Bakterien findet bei vaginal geborenen Babys deutlich früher statt.
Eines war allerdings bei beiden Säuglingsgruppen gleich: Im Gegensatz zu ihren Müttern waren die bei ihnen gefundenen Bakterien auf der Haut, den Schleimhäuten und im Darm verteilt. Erst später differenziert sich dies, dann kommen bestimmte Arten vor allem in bestimmten Körperregionen vor - Streptokokken zum Beispiel in der Mundhöhle, Staphylokokken auf der Haut und Milchsäurebakterien im Darm. Wie genau sich die Zusammensetzung der Bakterienkulturen auf der Haut und im Darm im Laufe des Lebens verändert und wie sich dies auf das Risiko für verschiedene Krankheiten auswirkt, ist allerdings noch unbekannt. Dies müssten zusätzliche Untersuchungen klären, schreiben die Forscher.