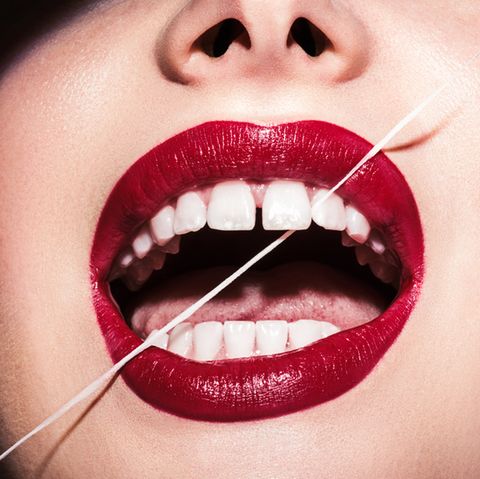Liebe Zahnärzte,
ganz ehrlich: Die zahlreichen Leserbriefe und Kommentare aus Ihrer Zunft machen mir Angst! Nicht als Journalist, sondern als Patient. Zwar bin ich bei einem Zahnarzt meines Vertrauens, doch der ist schon über sechzig Jahre alt und wird bald in Ruhestand gehen. Bald muss ich mich also in die freie Zahnarzt-Prärie begeben. Es ist ein Glücksspiel, ob ich dann wieder einen wie ihn finde oder bei einem dieser Leserbriefschreiber lande, die für berechtigte Kritik immer nur Häme übrig haben, anstatt ihr mit sachlichen Argumenten zu begegnen. Dann wäre auch ich der totalen Diagnose- und Therapie-Willkür ausgeliefert, die Zehntausende Euro kosten und Gesundheit vernichten kann. Von dieser Willkür handelte mein Artikel – und dass sie häufiger vorkommt, als Ihnen lieb sein kann, das möchte ich in diesem offenen Brief nochmal genauer belegen – mit Quellenangaben natürlich.
+++ Die stern-Titelgeschichte unseres Reporters können Sie hier noch einmal nachlesen. +++
Sie werfen mir also vor, ich hätte für den Artikel willkürlich schlimme Einzelfälle herausgegriffen, um einen ganzen Berufsstand schlecht zu machen. Der Bericht sei einseitig, reißerisch, alles sei falsch, man wisse gar nicht, wo man anfangen solle mit den Einwänden. Interessant ist nur: Niemand schreibt, was genau falsch sein soll. Halt! Es gab fachliche Kritik, die ich verifiziert habe. Kleine Fehler, die ich in der Online-Fassung korrigiert habe. Der Artikel blieb nahezu unverändert.
Schwarze Schafe
Das Große Ganze ignorieren viele von Ihnen (nicht alle: Es gab auch Zahnärzte, die dem Artikel vehement zustimmten). Warum? Weil Sie den Artikel als Generalangriff auf den Berufsstand der Zahnärzte interpretieren? Das stimmt nicht. Lesen Sie nochmal genau nach: Im Einstieg kommt an prominenter Stelle Professor Stefan Zimmer vom Lehrstuhl für Zahnerhaltung und Präventive Zahnmedizin an der Universität Witten/Herdecke zu Wort: "Es gibt einen Wandel (in der Zahnärzteschaft) hin zu minimal-invasiven Eingriffen. So können die eigenen Zähne heute länger erhalten werden." Der Artikel lässt also keinen Zweifel daran, dass viele Zahnärzte gute Arbeit leisten. Zusätzlich wird dies im Editorial von stern-Chefredakteur Christian Krug betont. Erst nach diesem Einstieg wendet sich der Text den schwarzen Schafen Ihrer Zunft zu.
Ich floh aus Zahnarzt-Praxen
Da viele Leser besonders der Satz erregt, dass ich selbst meinem Zahnarzt "blind vertraue", hier meine Patientenstory: Ich habe lange für die Zahnarztsuche gebraucht. Denn es ist fast egal, zu wem ich mich begebe, stets will man mir fünf bis zehn Zähne reparieren. Das reproduzierbar - und ich habe mich auch schon als Testpatient in den Zahnarztstuhl gesetzt, nachdem zahnärztliche Gutachter keinen Behandlungsbedarf sahen.
Früher, als ich wegen Wohnortwechseln häufig einen neuen Zahnarzt suchen musste, floh ich aus Praxen, wenn die Widersprüche zu groß waren – wenn mir also der alte Zahnarzt ein karies-freies Gebiss bescheinigt hatte und der neue die Hände über dem Kopf zusammenschlug. Wenn ich von solchen Erlebnissen auf Partys erzähle, finde ich viele, denen es auch schon so ging. Ja, ich war über Jahrzehnte Zahnarzthopper, was nicht gut ist, ich weiß, aber ich sah mich dazu gezwungen.
Dann fand ich meinen jetzigen Hauszahnarzt. Er verfolgt die Strategie des Abwartens und Beobachtens und damit fahre ich seit mittlerweile zehn Jahren sehr gut. Mein Zahnstatus war in der Jugend unterdurchschnittlich, heute liege ich laut Mundgesundheitsstudie besser als meine Altersgruppe. Ein stiller Zeuge für die Richtigkeit der Strategie Abwarten ist mein Backenzahn oben rechts, der sogenannte "Einssiebener" - den wollten in den Jahren 1988 bis 2008 insgesamt acht Zahnärzte aufgrund einer dunklen Verfärbung des Zahnschmelzes aufbohren. Die Befunde habe ich vor einigen Jahren zusammengestellt. Mein Backenzahn überlebte bis zum Jahr 2015 unbeschadet, seitdem trägt er eine einflächige Füllung.
Diagnose- und Therapiewillkür sind gut belegt
Meine Erlebnisse passen hervorragend zu dem Schlüsselsatz meines Artikels, der bei vielen zahnärztlichen Lesern zu Wutausbrüchen führte: "Diagnose- und Therapiewillkür in der Zahnmedizin sind gut belegt." Zugegeben: Ich belege diesen Kernsatz im Text nicht ausreichend, weil es ermüdend ist, immer wieder auf die gleichen Untersuchungen zu verweisen, es ist ja nicht mein erster Artikel zum Thema.
Ok: Hier finden Sie nun eine Auflistung von neun Untersuchungen wissenschaftlicher Institute, Zahnärzte, Verbraucherzentralen und Printmedien aus den Jahren 1999 bis 2015, für die insgesamt 418 Zahnärzte mit 67 Testpatienten beziehungsweise deren Befunden konfrontiert wurden. Immer waren qualifizierte zahnärztliche Gutachter beteiligt, deren Urteil für die Ergebnisse ausschlaggebend war. Die Zahnärzteschaft hat sich also selbst bewertet, und die Ergebnisse der Untersuchungen legten stets Qualitätsmängel offen.
Untersuchungen und Quellen
Prof. Hans Jörg Staehle, Direktor der Unizahnklinik Heidelberg, prüft seine Kollegen seit vielen Jahren mit der Fallgeschichte einer 59-jährigen Hausfrau, der seit jungen Jahren zwei Backenzähne fehlten und die damit nie Probleme hatte. Er fertigte Gipsmodelle des Gebisses, Fotos und ein Röntgenbild an und schickte sie Kollegen. Erstmals veröffentlichte er seine Erhebung in Ihrem Standesblatt ZM, sagte mir jedoch, dass er den Fall bis heute nutze und es weitere Publikationen gebe. Die Therapieempfehlungen, Heil- und Kostenpläne schwankten zwischen 50 und mehr als 5000 Euro, es wurden Brücken, Implantate oder Nicht-Versorgung empfohlen. Als Gründe für eine Versorgungsnotwendigkeit wurde beispielsweise angeführt, man müsse "frühzeitig implantieren, solange noch genügend Knochen da ist". Durch die Eingriffe würden Kaufunktion und Hygieneverhältnisse verbessert sowie spätere Zahnwanderungen vermieden. Staehle sagt: "Immer wieder fällt auf, dass sich die Vorschläge nicht nur am Wohl der Patientin orientieren, sondern mit der Vorliebe des jeweiligen Kollegen zu tun haben." Er selbst entschied sich fürs Abwarten und untersucht die Patientin seither regelmäßig. Es schadete nicht: "Ihre Zahnlücken stellen sich unverändert dar." (Staehle Hans Jörg, ZM 7/2010: "Die Balance zwischen Über- und Unterversorgung")
Schon die professionelle Zahnreinigung wird "in den meisten Fällen mittelmäßig bis schlecht" durchgeführt, wie Stiftung Warentest 2011 und 2015 nach zusammengenommen 15 Praxisbesuchen herausfand. Vor allem in den Zahnzwischenräumen blieb die Hälfte der Beläge haften. (Stiftung Warentest 9/2011, S.88-91: "Großputz beim Profi" sowie 7/2015, S. 87-90: "Weit aufmachen, bitte")
Grundannahmen wie "gemeinsame Befunderhebungsmethoden, gleicher Befund, gleiche Therapie, vergleichbare Heil- und Kostenpläne etc." treffen "in einem hohen Maße nicht zu", urteilten das Institut für angewandte Verbraucherforschung, IFAV, und das Wissenschaftliche Institut der AOK, WidO, im Jahr 1999 auf der Basis von 199 Zahnarztbesuchen durch 20 Testpatienten. Große Defizite traten vor allem in der Qualität der Befunderhebung auf. Die Schätzungen der Material- und Laborkosten in den Heil- und Kostenplänen waren nicht transparent. (IFAV/WIdO (Hrsg) / Bauer, Huber: "Markttransparenz beim Zahnersatz – Befunde, Therapieplände und Kostenschätzungen im Vergleich" Bonn 1999)
Die Zeitschrift Ökotest schickte im Jahr 2004 einen Testpatienten zu 20 Zahnärzten, deren Urteile von "kein Behandlungsbedarf" bis "aufwändiger Sanierungsfall" variierten und die Kosten zwischen 175 und 9131 Euro für ihre Therapievorschläge veranschlagten. (Ökotest 4/2004, S. 44-51: "Abgezockt, geschlampt und gepfuscht")
Die Zeitschrift stern in Kooperation mit der Krankenversicherung ErgoDirekt schickte vor sieben Jahren 23 Testpatienten zu 114 Zahnärzten. Das Fazit der drei Gutachter: "In mehr als 70 Prozent der getesteten Praxen wurden die Mindesterwartungen an eine sorgfältige Befund- und Beratungstätigkeit nicht erfüllt." (stern 50/2011, S. 108-118: "Mündliche Prüfung")
Die Verbraucherzentrale Hamburg schickte im Jahr 2013 eine Patientin mit Karies an einem Backenzahn sowie einer Zahnlücke zu 30 Hamburger Zahnärzten. Die Zahnlücke war laut drei Referenzzahnärzten nicht behandlungs-, sondern nur kontrollbedürftig und die Patientin wünschte keine Behandlung. Nur fünf der 30 Zahnärzte erkannten die Karies. Die Behandlungsvorschläge zur Zahnlücke variierten stark in Abhängigkeit vom Stadtviertel – im reichen Poppenbüttel rieten acht von zehn Zahnärzten zur Versorgung, während in den zwei ärmeren Vierteln immerhin sieben von zehn Zahnärzten die Präferenz der Patientin für eine Nicht-Behandlung akzeptierten. (Verbraucherzentrale Hamburg 2013: "Wenn Sie diese Zahnlücke nicht behandeln lassen, fallen Ihnen bald alle Zähne aus!")
Die Stiftung Warentest schickte im Jahr 2015 drei Testpatienten mit "komplizierten Dentalproblemen" zu 15 Implantologen. Die Behandlungsvorschläge überschritten diejenigen der Gutachter preislich um bis zu 90 Prozent (knapp 10.000 Euro). Zur Qualität der Vorschläge bemerkt Stiftung Warentest: "Nur zwei der Behandlungspläne sind einigermaßen in Ordnung, alle anderen schlecht." Außerdem würden sie "unnötige Risiken" bergen. Fünf Zahnärzte "unterließen wichtige Voruntersuchungen, etwa auf Zahnwurzelentzündung (Parodontitis)" – solche Entzündungen müssen immer vorher behandelt werden, sonst fallen später die Implantate aus, das wissen Sie ja. Zu ähnlichen Ergebnissen gelangte die Zeitschrift bereits im Juli 2014, als 21 Testpatienten mit Zahnersatz-Problemen zu 15 deutschen sowie sechs polnischen Zahnärzten geschickt wurden. (Stiftung Warentest 10/2015, S. 86-91: "Einen Zahn zulegen" sowie 7/2014, S. 86-91: "Schöne teure Lückenfüller")
Es fängt schon mit der Zahnreinigung an, bei der die Hälfte der Beläge in den Zwischenräumen haften bleibt. Es geht weiter mit der Diagnosewillkür – vorhandene Karies wird oft übersehen, dafür aber an gesunden Zähnen entdeckt. Eine große Unsicherheit scheint hinsichtlich der Beurteilung von Zahnlücken vorzuherrschen – kann man sie so lassen oder braucht der Patient dringend teure Implantate, weil sonst vielleicht bald alle Zähne ausfallen? Die zahnärztliche Urteilskraft scheint hierbei oft weniger von medizinischen Erwägungen getrieben zu sein als von persönlichen Vorlieben oder dem durchschnittlichen Einkommen der Bewohner des Stadtviertels, in dem sich die Praxis befindet. Ja, die Beratung bei Zahnersatz und die Güte der Heil- und Kostenpläne lassen offenbar oft zu wünschen übrig. Glauben Sie nicht? Einzelfälle? Dann gehen Sie bitte den Quellen nach.
Können all die Untersuchungen irren? Dann beweisen Sie es endlich!
Sie mögen dann immer noch jede einzelne dieser Untersuchungen als "nicht repräsentativ" verwerfen sowie hier und dort methodische Mängel finden. Ein Problem können Sie nicht wegdiskutieren: Andere Untersuchungen zur Qualitätssicherung in zahnärzlichen Praxen gibt es kaum – an der Situation der Versorgungsforschung in Deutschland, die der Zahnarzt Jochen Bauer, Vorsitzender der Vereinigung Demokratische Zahnmedizin, zusammen mit zwei Ko-Autoren 2009 im seinem Buch "Zahnmedizinische Versorgung in Deutschland" auf Seite 138 beschrieb, hat sich nichts geändert. Ich fordere Ihre Institutionen und Forschungsinstitute auf: Wenn Sie belegen wollen, dass all diese Untersuchungen irren, dann beweisen Sie es! Es wäre jedoch sehr überraschend, wenn ein anderes Ergebnis herauskäme.
Massive Überversorgung ist in der Humanmedizin längst Thema. Warum nicht bei Ihnen?
Denn Überdiagnostik und Übertherapie sind die großen Grundprobleme unseres Gesundheitssystems, das seit Jahrzehnten falsche Anreize setzt. Aus dem Schwesterfach Humanmedizin (das ich studiert und in dem ich gearbeitet habe) gibt es allseits bekannte Beispiele, die in der Ärzteschaft seit langem diskutiert werden - unnötige Bandscheiben-Operationen, Endoprothesen, Krebsvorsorge- und Herzkatheter-Untersuchungen mit all ihren Risiken, und natürlich die oft fragwürdigen IGeL-Leistungen. Die massive Überversorgung geschieht, damit am Ende des Jahres die Rendite stimmt. Die offene Diskussion über diese Missstände findet Niederschlag in unzähligen Fachdiskussionen, die ihren Weg längst in die Standesmedien fanden. Weltweit starteten Ärzte 2011 die Initiative "Choosing wisely" (in Deutschland: "Gemeinsam klug entscheiden"). Sie treten dagegen an, dass Patienten unnötigen und teilweise gefährlichen Prozeduren ausgesetzt werden, aus welchen Motiven auch immer.
Wo bleibt Ihre Debatte darüber? Zahnärzte sind in viel höherem Maße den Kräften des freien Marktes ausgesetzt als Ärzte, weil sie überwiegend selbstständig arbeiten und heute weitaus höhere Investitionen für repräsentative Praxisräume und technische Ausstattung tätigen müssen als vor 30 Jahren. Rendite wird zum Zwang, um den hohen Kredit abzubezahlen. Wer käme da nicht in Versuchung, an den Steigerungsfaktoren und für den Patienten nicht durchschaubaren Zusatzleistungen zu manipulieren? Wo Zahnärzte sich doch leichter als Ärzte der Kontrolle durch gesetzliche Krankenkassen und ihrer Gutachter entziehen können, wenn sie Kassenpatienten auf rein privater Basis behandeln! Wie also können Sie annehmen, dass ausgerechnet Zahnärzte unter diesen Bedingungen keine Krankheits- und Therapieerfindung betreiben?
Mehr Zahngesundheit. Mehr Zahnärzte. Mehr Einnahmen. Das geht nicht zusammen!
Die Zahlen, die dahin deuten, liegen doch auf dem Tisch, ich habe sie in meinem Artikel veröffentlicht: Die Mundgesundheit hat zugenommen, die Einnahmen der Zahnarztpraxen auch – allein um 7,4 Prozent von 2012 auf 2013, um 54,1 Prozent seit dem Jahr 2000 - so können Sie es im Statistischen Jahrbuch der BZAEK 2015/2016 auf Seite 94 nachlesen. Man müsse die Inflation herausrechnen, dann bliebe nichts übrig, schrieben mir manche Zahnärzte – als ob nicht die (abnehmende!) Krankheitshäufigkeit die Höhe der Einkünfte bestimmen sollte, sondern ähnlich wie bei DGB-Forderungen ein Anspruch auf jährliche Anpassungen des Salärs an die allgemeine Einkommens- und Preisentwicklung bestünde. Zu Ihrer Beruhigung: Auch nach Inflationsbereinigung bleibt ein Einkommenszuwachs von 24,9 Prozent seit dem Jahr 2000. Das heißt natürlich nicht, dass der Einzelne heute reicher ist – ich bekam Leserbriefe von Zahnärzten, die angeblich am Hungertuch nagen. Nein, die Einnahmen verteilen sich auf eine zuvor nie erreichte Zahl von Zahnärzten – 71.000. Das sind doch gegenläufige Entwicklungen, die für sich sprechen.
Mehr Zahngesundheit. Mehr Zahnärzte. Mehr Einnahmen. Das geht nicht zusammen. Soviel Geld wird nicht durch die professionelle Zahnreinigung und Beratung zur Kariesprävention verdient, sondern auch durch invasive Eingriffe. Und die stellen, auch wenn sie nur der Schönheit dienen, immer ein Risiko für die Gesundheit dar. Die "Todesspirale des Zahns" beginnt, wenn der Zahnarzt erstmals den Bohrer ansetzt. Einige verirrte zahnärztliche stern-Leser schrieben dieses schöne Wort meinem Erfindungsgeist zu, doch ich habe ihn aus Publikationen des Kariesforschers Falk Schwendicke von der Charité entlehnt, der minimal-invasive Zahnmedizin propagiert und mir sagte, der Begriff setze sich an den Universitäten durch.
Vernachlässigte Volkskrankheit Parodontitis
Neben der Überversorgung gibt es übrigens natürlich noch das Problem der Unterversorgung – und zwar dort, wo Zahnärzte nur wenig Geld verdienen können. So stellten die Autoren des "Barmer Zahnreports 2017" fest, dass seltsamerweise nur zwei Prozent der Zahnarzt-Patienten wegen einer Zahnbett-Entzündung (Parodontitis) therapiert werden. Dabei handelt es sich um eine häufige Krankheit, die wegen fehlender Beschwerden oft lange unbemerkt bleibt. Mehr als die Hälfte aller Deutschen leidet der aktuellen Mundgesundheitsstudie schon in mittleren Lebensjahren an einer mittelschweren oder schweren Form. All diese Menschen riskieren langfristig Zahnverlust und brauchen dann teuren Zahnersatz. Die Barmer hat keine Erklärung für den eklatanten Widerspruch zwischen vielen Erkrankten und wenigen Behandelten. Aber es liegt nahe, dass wohl nicht wenige Zahnärzte bei der Untersuchung der Zahnfleischtaschen-Tiefe schlampen - eine Untersuchung, die alle zwei Jahre von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt wird und die immerhin 50 Prozent der erwachsenen Versicherten alle zwei Jahre in Anspruch nehmen.
Eine große Debatte über Qualitätsmängel, Über- und Unterversorgung in der Zahnmedizin ist überfällig. Erste gute Ansätze sehe ich für die Kieferorthopädie. Hier wird das Treiben mancher Kollegen auch dem Vorstandsvorsitzenden der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung Wolfgang Eßer zu bunt. Im Februar 2017 fand er im Standesblatt Zahnärztliche Mitteilungen deutliche Worte zu offenkundigen Missständen, die nun auch der Bundesrechnungshof gerügt hat.