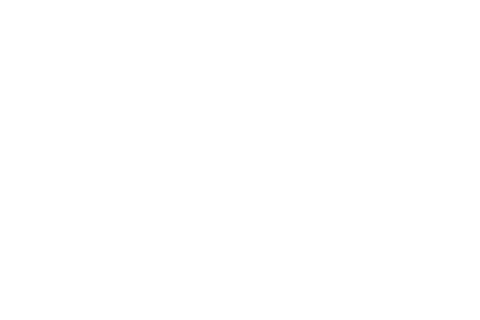Am 2. Februar landet der Airbus A321, der Irene Brady in ihre neue Heimat bringt, genau 21 Minuten früher als geplant am Stuttgarter Flughafen. Im Ankunftsbereich hält Sibylle Jerger einen Herzchenballon in der linken und ein Blatt Papier in der rechten Hand. "Mabuhay" steht in Schwarz darauf. Ein philippinischer Willkommensgruß für Irene Brady.
Langsam und etwas unsicher kommt Brady durch die Glastür. "Herzlich willkommen", sagt Jerger und nimmt Brady kurz in den Arm. "Kommen Sie, wir haben ein kleines Busle gemietet."
Die beiden Frauen haben sich bislang nur per Skype kennengelernt. Brady kann Deutsch, ein bisschen, lieber spricht sie Englisch. Sie sagt, der Tag, an dem sie von Jerger erfuhr, dass sie nach Deutschland kommen darf, war der schönste ihres Lebens. Sie sagt es, als hätte sie ein Leben in Luxus gewonnen. Dabei kommt Irene Brady nach Deutschland, um einen Job zu machen, den hier kaum jemand mehr machen will: Krankenpflegerin.
In Deutschland herrscht Pflegenotstand
In Deutschland herrscht Pflegenotstand. Schichtdienst, Stress und schlechte Bezahlung machen den Beruf für viele unattraktiv. Laut eines von Verdi in Auftrag gegebenen Gutachtens fehlen in deutschen Krankenhäusern 100.000 Pflegekräfte. Allein das Universitätsklinikum Tübingen (UKT) braucht jedes Jahr 170 neue Pflegekräfte, kann selbst aber nur 100 ausbilden.
Um diesen Notstand zu bekämpfen, haben die staatliche Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) und die Auslandsvermittlung der Arbeitsagentur das "Triple-Win-Programm" entwickelt. Sie holen Pfleger von der anderen Seite der Welt, damit die hier arbeiten können, in einem Land mit anderer Sprache, anderem Gesundheitssystem und anderer Kultur. Die Frage ist: Kann das funktionieren?

Eine Dreiviertelstunde nach ihrer Ankunft stehen Brady und Jerger vor dem Personalwohnheim der Uniklinik. Ein etwas heruntergekommener Zweckbau mit Plattenfassade und dunkler Holztür. "Hier werden Sie wohnen", sagt Jerger. "Okay", sagt Brady, lächelt müde und schleppt ihren roten Koffer in den dritten Stock. In Zimmer 103 stehen ein Holzbett, ein Schreibtisch, ein Stuhl und ein begehbarer Kleiderschrank. Ein Feuermelder hängt an der Decke und an der kahlen Wand eine Notiz: "Keine Löcher, keine Nägel".
Der Grund, warum Irene Brady nach Tübingen gekommen ist, sind 2308 Euro. So viel wird sie monatlich als Gesundheits- und Krankenpflegerin in Ausbildung am UKT verdienen. Deswegen hat sie sich beworben. Deswegen hat sie Familie und Freunde zurückgelassen und ist mehr als 14 Stunden von Manila über Istanbul nach Stuttgart geflogen. Mit dem Gehalt kann sie ihre Eltern unterstützen. 350 Euro will sie jeden Monat nach Hause schicken.
CRONA steht für Chirurgie, Radiologie, Orthopädie, Neurologie und Anästhesie
Irene Brady ist 31 Jahre alt, eine kleine, kräftige Frau. Sie war noch nie in Deutschland. Sie weiß aus dem Internet, dass es hier alte Gebäude und ein gutes Gesundheitssystem gibt. Sie hat sechs Monate Zeit, um sich die neue Welt zu erschließen, die Gänge der Klinik, die Straßen der Stadt und die Regeln der Bürokratie. Im August muss sie eine Sprach- und Examensprüfung zur Anerkennung als Krankenpflegerin bestehen. Dann darf sie bleiben.
Sibylle Jerger ist 58 Jahre alt, eine Frau mit strengen, dünnen Augenbrauen und freundlichem Lächeln. Jerger war noch nie auf den Philippinen und wohnt in einem Dorf auf der Schwäbischen Alb. Sie soll den Neuen helfen, die Klinik zu verstehen. Und Deutschland, das auch.
Der nächste Morgen, 7.45 Uhr am Wohnheim. Neben Brady stehen drei weitere Philippiner, die heute anfangen. "Haben Sie gut geschlafen?", fragt Jerger. Kopfschütteln. "Kann ich was tun? Brauchen Sie eine zweite Decke?" Kopfschütteln. Brady ist seit vier Uhr wach: der Jetlag, das Wetter, die Ruhe der Nacht. Ihrem Vater schrieb sie auf Facebook in ihrer Heimatsprache Visayan: "Gimingaw ko nimo." Ich vermisse euch sehr.

Gemeinsam gehen sie hinüber zum Krankenhaus. Es besteht aus 17 Kliniken mit 41 Abteilungen und 1559 Betten. Pro Jahr versorgen dort fast 9000 Mitarbeiter 72.900 stationäre und 355.000 ambulante Patienten. Es ist der größte Arbeitgeber der Region und eine der größten und angesehensten Kliniken der Republik.
Jerger läuft durch lange Gänge, in den Fahrstuhl, rechts, links, geradeaus, ein Labyrinth voller Abkürzungen: HNO, UKT, GZ, CRONA. Hinter ihr her trotten die vier Neuen. Jerger bleibt stehen, erklärt, geht weiter, bleibt stehen. "CRONA steht für Chirurgie, Radiologie, Orthopädie, Neurologie und Anästhesie", sagt sie. "Jaja", sagt die Gruppe und blickt sich fragend an. Manchmal übersetzt Jerger ins Englische. "Ah, okay", antworten sie dann. Jerger sagt: "Wenn Sie irgendwo stehen und nicht wissen, wo Sie sind, rufen Sie mich einfach an."
Auf den Philippinen ist Krankenpflege ein Studienfach
Weiter, raus aus der Klinik, über das Kopfsteinpflaster der Altstadt, vorbei am Gasthaus "Bären" und einem Asia-Geschäft. Zwischen den Dächern sieht man die Turmspitze von Schloss Hohentübingen. "Das älteste Kunstwerk der Menschheit liegt dort oben im Schlossmuseum", sagt Jerger. "Das Pferdle. Es bindet mich in die Welt. Und es erinnert mich daran, dass wir alle miteinander verwandt sind."
Jerger zeigt Brady und den anderen den botanischen Garten, weil sie hofft, dass er sie an die Heimat erinnert. Sie zeigt, wo im Kaufland die günstigsten Haferflocken stehen und wie man ein Busticket kauft, und sie erklärt, was der Unterschied zwischen einer Steuer- und einer Rentenversicherungsnummer ist. Was Jerger macht, nennen die Organisatoren von der GIZ "Kümmerer-Strukturen". Ohne Betreuung funktioniert das Programm nicht. Jerger war früher selbst Intensivpflegerin. "Jetzt pflege ich Pflegende", sagt sie.
Tags darauf darf sich Irene Brady ihren Mitarbeiterausweis an ihr Hemd stecken: "Irene Brady, Gesundheits- und Krankenpflegerin in Ausbildung. Neurologie". Kurz ruht ihre Hand auf dem Schildchen. "Das ging sehr schnell", sagt sie. "Alles geht jetzt sehr schnell."

Eigentlich wollte Brady nach der Schule Kunst studieren. Doch ihre Eltern waren dagegen. Ihr Vater ist Pastor in einer freikirchlichen Gemeinde, ihre Mutter Lehrerin. Brady sollte Krankenpflegerin werden, etwas Vernünftiges lernen. Sie studierte Krankenpflege an der Universität auf Cebu. Fünf Jahre Ausbildung, Bachelor und Master. "Ich wollte das nie. Ich wollte nur meine Eltern nicht enttäuschen."
Auf den Philippinen ist Krankenpflege ein Studienfach, es gibt dort mehr Absolventen als Arbeitsplätze. Wer irgendwann einen bezahlten Job ergattert, verdient höchstens 400 Euro im Monat. Doch Krankenhäuser erwarten berufliche Erfahrung für bezahlte Stellen. Nach dem Studium begann Brady, als ehrenamtliche Pflegerin zu arbeiten. Morgens fuhr der Vater sie auf dem Roller ins Provinzkrankenhaus, nachmittags holte er sie wieder ab. 50 Betten gab es, Verbandsmaterial mussten die Patienten selbst mitbringen. Erst dort, sagt sie, fing sie an, sich für den Beruf zu begeistern. "Ich entwickelte eine Leidenschaft dafür, Patienten zu helfen."
"Jedes deutsche Wort hat seine eigenen Regeln"
Nach zwei Jahren verdiente sie 4000 Peso im Monat, rund 70 Euro. Ihre Eltern unterstützten sie immer noch. "Ich wollte als Pflegerin arbeiten, aber die Umstände waren frustrierend." Eine Freundin erzählte ihr von Europa. Dass man dort Krankenschwestern sucht. 2013 bewarb Brady sich das erste Mal für das "Triple-Win-Programm" und erhielt eine Absage. "Meine Arbeitserfahrung reichte nicht."
Jeden Abend betete Brady. Sie bat Gott um einen Job in Deutschland. Im August 2016 wurde sie zum Interview eingeladen, schließlich der Anruf von Sibylle Jerger: "Frau Brady, Sie sind dabei."
Ende Februar 2017, Brady ist fast vier Wochen in Tübingen. Gesundheitszentrum, Ebene 4, Tagungsraum 1. Deutsch als Fremdsprache. Die Gruppe, alles Pflegekräfte in Ausbildung, hat sich im Kreis aufgestellt. Sie sollen Artikel üben. "Ich bin das Pflegekraft. Und du?", sagt Brady. "Es heißt die Pflegekraft" , korrigiert die Lehrerin. "Ich bin die Infusion", sagt eine Kollegin. "Fällt Ihnen noch etwas anderes ein?" – "Ich bin die Desinfektion."

Am Ende des Tages, den Kopf voll mit dreizehn Wörtern, die alle Schmerz beschreiben, mit Modalverben, deklinierter Fieberkurve, Präfixen und der Frage, wie sich senken und sinken unterscheiden, schlurft Brady zum Wohnheim. "Jedes deutsche Wort hat seine eigenen Regeln", sagt sie.
Sieben Wochen später, Mitte April, sechs Uhr morgens. Brady hat eine Übungsschicht. Friedhelm Chmell ist ihr Tandempartner, er arbeitet sie ein. Gemeinsam übernehmen sie heute eine Patientin und gehen jeden Schritt der Pflege detailliert durch. "Luxus", sagt Chmell, "mit dem Alltag hat das nichts zu tun, aber Irene muss lernen, wie die Abläufe hier sind."
Die neuen Kräfte sind eine Bereicherung und Entlastung
Brady hat sich vorgenommen, bei der Übergabe möglichst viel zu verstehen. Vor ihr liegt ein Zettel für Notizen. Die Nachtpflegerin spricht über "Medis", "Ibu und Dopa", über gerötete Augen, halluzinierende Patienten, über AvD, ZVK und DK. Nach 25 Minuten ist die Übergabe vorbei. Chmell holt sich einen Kaffee. Brady blickt verloren auf ihren Zettel. Er ist fast leer.
Friedhelm Chmell ist 40 Jahre alt, ein schlanker Mann, dessen Glatze ihn freundlich wirken lässt. Seit 18 Jahren arbeitet er als Krankenpfleger und leitet neue Kräfte an. Er erklärt besonnen. Brady nennt ihn "meinen Tandemmeister". Chmell sagt, er liebe seinen Job. "Wenn ich die Zeit habe, ihn richtig zu machen." Doch der Stress sei oft viel zu groß. "Da sind die neuen Kräfte eine Bereicherung und Entlastung."
Das größte Problem können jedoch auch die Neuen nicht lösen. Seine Station hat zehn Zimmer, insgesamt 20 Betten. Zwei examinierte Pfleger teilen sich die Station und werden jeweils von einer Hilfskraft unterstützt. Eine ungeplante Aufnahme, eine Körperwäsche, die etwas zu lange dauert – und der restliche Tag: Stress. "Wir fordern schon lange eine zusätzliche Pflegekraft pro Schicht", sagt Chmell.

Zimmer 424. Sieglinde Kugel, Jahrgang 1944, Parkinson, seit drei Wochen auf Station. Ein Infekt löste eine akinetische Krise aus. Ein lebensbedrohlicher Zustand. "Sie konnte sich nicht mehr bewegen. Es sah schlimm aus", sagt Chmell. Die Antibiotika haben zum Glück angeschlagen. Heute soll sie entlassen werden.
"Entschuldigung, guten Morgen, Frau Kugel", sagt Brady. Gemeinsam mit Chmell wäscht sie die Patientin, wechselt den Katheter, setzt sie in den Rollstuhl und hilft beim Frühstück. Brady schneidet ein Marmeladenbrot in kleine Stücke und legt sie ihr in den Mund. "Mögen Sie das?", fragt Brady. "Schleckig bin ich ned", sagt Kugel. Brady nickt und füttert. Auf dem Gang fragt sie Chmell: "Was heißt schlägich?"
Was braucht ein Patient, wenn er um "Gsälz" bittet?
Um neun Uhr wird Frau Kugel vom DRK abgeholt. "Ich mochte Frau Brady vom ersten Tag an", sagt sie. "Ich konnte Frau Kugel nur schwer verstehen", sagt Brady. "Das wird schon", sagt Chmell.
Auf den Philippinen hat Brady das Sprachniveau B1 erworben, in Hochdeutsch. Doch was bedeutet "Ich will hoam!"? Was braucht ein Patient, wenn er um "Gsälz" bittet? Und was ist ein "Schwänzle"? Brady fühlt sich sicherer auf Englisch, aber sie muss mit älteren, schwäbischen und badischen Patienten sprechen. Sie muss genau verstehen, wie sie geschlafen haben, beschreiben, wie sich das Fieber entwickelt und wie beweglich ein Patient ist. Sprache bestimmt über Medikation, über Entlassung von Patienten – am Ende über Leben und Tod. "Die Sprache ist mein größter Kampf", sagt Irene Brady.
Ende April. In den vergangenen Wochen hat sie Vokabeln und Schwäbisch geübt. "Bei der Übergabe auf Station verstehe ich immer noch fast nichts", sagt sie. In ihrem Zimmer steht nun ein kleiner Fernseher. "Aber irgendwie kann ich keinen Sender empfangen." Ein WLAN-Router liegt auf ihrem Schreibtisch. Angeschlossen ist er nicht, die Anleitung ist auf Deutsch. Und Brady hat noch immer keine freikirchliche Gemeinde gefunden, der sie sich anschließen könnte. Heute hat sie Unterricht in der Berufsfachschule. Im Klassenraum sitzen 15 Pflegekräfte aus Serbien, Indien, Nepal und von den Philippinen. Es sind nur noch drei Monate bis zu den Deutsch- und Praxisprüfungen. "Letzte Woche ist einer durchgefallen", sagt der Lehrer, "zu viele Fehler auf Station. Ihr müsst eure Aufgaben kennen und können." Während ein Serbe erklärt, wie schlecht er die Patienten verstehe, fallen draußen dicke Flocken vom Himmel. Irene Brady sieht zum ersten Mal in ihrem Leben Schnee. "Wow", sagt sie. Wenigstens eine Freude an diesem Tag.
"Diese Projekte bringen keine nennenswerte Menge an zusätzlichen Pflegefachkräften."
Praxistage, Sprachkurse, Schule. Die Ausbildung internationaler Pflegekräfte ist teuer. 4000 Euro zahlt die Uniklinik Tübingen pro Pflegekraft an die GIZ. Hinzu kommen Kosten für Sprach- und Fortbildungskurse. Seit dem Programmstart vor vier Jahren wurden 950 Pfleger nach Deutschland geholt, davon rund 270 von den Philippinen. Es könnten deutlich mehr sein. Auf jede Stelle, die von der GIZ ausgeschrieben wird, finden sich genügend Bewerber. Doch die Kliniken fordern nicht mehr an. Viele machen erst gar nicht mit. Sie scheuen Kosten und Aufwand, sie wollen sich keine Frau Jerger leisten.
Klaus Tischler, Pflegedirektor am UKT, sagt, dass es die Klinik rund 38.000 Euro koste, einen Triple-Win-Teilnehmer auszubilden. Er rechnet damit, dass philippinische Pflegekräfte nach eineinhalb bis zwei Jahren vollwertige Teammitglieder sein können. "Das lohnt sich, weil es in Deutschland nicht genügend Pflegekräfte gibt." Bisher sind alle 34 Neuen von den Philippinen bei ihnen geblieben. Aus den ersten sind mittlerweile Pflegeleiter und Praxisanleiter geworden.
Margret Steffen, Pflegeexpertin der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, sagt, das Programm sei zwar gut gemacht, doch es löse das grundlegende Problem nicht. "Diese Projekte bringen trotz eines enormen Aufwands keine nennenswerte Menge an zusätzlichen Pflegefachkräften." Man müsse die Arbeitsbelastung senken und vor allem mehr Personal einsetzen. "Das Problem ist, dass wir keine gesetzlichen Personalvorgaben für die Behandlung und Pflege auf den Stationen haben." Das könne aber nur die Politik ändern. Klaus Tischler sagt: "Auch ich hätte gern 20 Prozent mehr Pfleger." Aber erstens bezahlt sie ihm keiner. Und zweitens – gibt es ja nun mal nicht genug.
"I ka koi Schwäbisch."
Eine andere Frage ist, was die Abwanderung studierter Pflegekräfte auf den Philippinen bewirkt. Die GIZ betont, dass man dem Land nichts wegnehme. Es gebe einen Überschuss an Pflegekräften, und es gehöre dort dazu, dass junge Menschen ins Ausland gehen, um ihre Familien zu unterstützen. So ganz stimme das nicht, sagt dagegen Fely Marilyn Lorenzo, Expertin für Pflege-Migration an der Universität der Philippinen in Manila und selbst ausgebildete Krankenschwester. Die Abwerber suchten gezielt nach erfahrenem Personal. "Für die Einheimischen bleiben die jungen, unerfahrenen Pfleger zurück."
Frühmorgens, Ende Mai. Sechs Wochen nachdem sich die Arbeit auf Station 24 für Irene Brady wie die babylonische Sprachverwirrung angefühlt hat, wird es ernst. Frühschicht. Sechs Zimmer und elf Patienten werden sie und Chmell heute allein versorgen. Chmell blickt auf die große Uhr im Stationszimmer: 7.06 Uhr. "Jetzt müssen wir Gas geben", sagt er, stellt Medikamente und Akten auf einen Rollcontainer und eilt los. Brady hastet hinterher.
Zimmer 421. Hände desinfizieren, Anklopfen, Tür auf, Licht an, Tür zu. "Guten Morgen. Wie geht es Ihnen?" – "Oh, schlecht, mein Kopf." – "Sie haben Schmerzen? Wie stark, auf einer Skala zwischen eins und zehn?" – "Zeeeehn." Ein Blick in die Akte. "Hier steht nichts über Schmerzmittel", sagt Chmell zu Brady. "Wir müssen auf einen Arzt warten." Tür auf, raus, Tür zu. Hände desinfizieren. Nächstes Zimmer. 425. Hirntumor, Schluckbeschwerden, seit drei Tagen kein Stuhlgang. Brady misst Puls, Blutdruck und Temperatur.
Als sie im Pausenraum sitzen, sagt Chmell: "Endlich Frühstück." Brady kaut auf einem Nutella-Brot und blickt aus dem Fenster. Chmell sagt: "Irene, du arbeitest schon gut mit." Vier Monate lebt sie jetzt in Tübingen. Sie sagt, es habe klick gemacht. Seit drei Wochen besucht sie den Gottesdienst einer Gemeinde. Sie hat ihren Router installiert. Und wenn sie einen Patienten nicht versteht, sagt sie: "I ka koi Schwäbisch.
Brady will das Geld zurückzahlen, das ihre Verwandten in ihre Ausbildung investiert haben
Es klingelt, 421. Die Patientin klagt weiter über Schmerzen. Brady beruhigt die Frau, huscht ins Stationszimmer, bereitet eine Infusion für 422 vor und läuft weiter zur 415. Brady atmet durch, ruhig sagt sie: "Jetzt wasche ich Sie." In die Akte trägt sie ein: „Beweglichkeit normal.“
Die Pflege alter, neurologisch erkrankter Menschen verlangt viele zeitaufwendige Handgriffe. Dabei müssen Chmell und Brady genau beobachten, weil die Ärzte darauf ihre Therapien stützen. Jeder Toilettengang, jede Hilfe beim Waschen, Essen oder Gehen ist eine Analyse.
10.30 Uhr. Visite. Vier Ärzte gehen mit Chmell und Brady von Zimmer zu Zimmer und geben neue Anweisungen.
Zimmer 421 bekommt eine Infusion mit Morphin.
Zimmer 422 trinkt zu wenig und benötigt eine Infusion.
Zimmer 423 muss streng beobachtet werden, verliert der Patient das Gefühl in den Beinen, braucht er sofort eine Notoperation. Halbstündige Kontrollen. Die Klingel, wieder 421. Brady hilft der Patientin beim Mittagessen, Nudeln mit Tomatensauce und Parmesan. "Ich habe das immer so gern gegessen, aber ich kann nicht kauen und schlucken." Brady streichelt ihre Schulter und sagt: "Kein Stress. Immer mit der Ruhe." – "Sie sind so gut, Schwester!"
Bald wird Irene Brady ihre Abschlussprüfung ablegen. Wenn sie besteht, darf sie in Tübingen bleiben. Sie wird dann 500 Euro mehr im Monat verdienen. Sie will sich davon ein iPhone kaufen und das Geld zurückzahlen, das ihre Verwandten in ihre Ausbildung investiert haben. Und irgendwann im nächsten Jahr wird sie die Verantwortung über fünf Zimmer auf Station 24 übernehmen. Es fehlen in Deutschland dann nur noch 99.999 Pfleger.