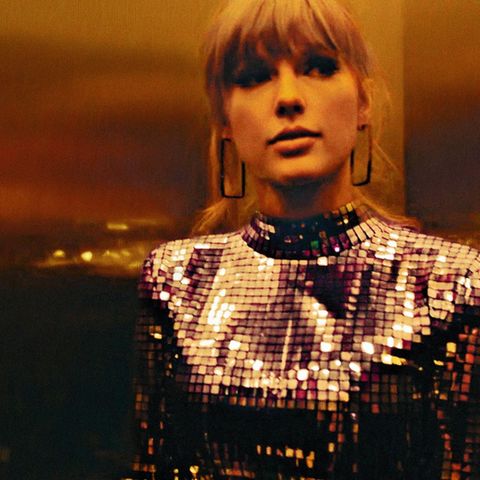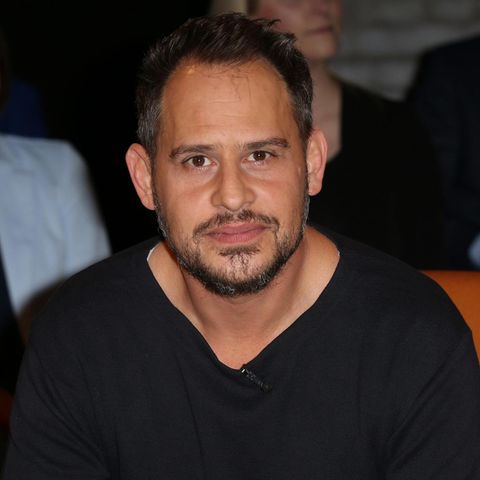Disclaimer: Dieser Artikel erschien bereits im Sommer 2019. Aufgrund der aktuellen Debatte um Frauenfeindlichkeit im Rap – ausgelöst durch die Kampagne #unhatewomen der Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes – wurde er noch einmal publiziert.
Es wirkt wie ein heruntergekommenes Haus, das schon immer kleine Risse in der Fassade hatte – nun aber droht komplett einzustürzen: Im Deutschrap findet gerade ein Diskurswechsel statt. Selten gab es solche selbstkritischen Worte, wie in den vergangenen Wochen. "Ab heute ist Schluss", schrieb Oliver Marquart zum Beispiel in einem Kommentar auf "rap.de". Was der Chefredakteur des Online-Portals damit meint, ist der Umgang mit Sexismus im Rap: "Das Verharmlosen von sexistischen Texten, Darstellungen in Videos und Verhalten von Künstlern mit dem Totschlagargument 'Kunstfreiheit' muss aufhören. Nein, niemand will solche Texte verbieten. Aber ja, sie müssen kritisiert werden."
Marquart ist nicht der Einzige. Mittlerweile werden immer mehr Stimmen laut. Viele davon fordern eine Sexismus-Debatte im Deutschrap, eine Art #RapToo. Dass in Raptexten mit Frauen oft respektlos umgegangen wird, ist bekannt. Der aktuelle Anlass der Diskussion sind aber Vorwürfe gegen zwei Rapper. Natürlich gilt wie immer die Unschuldsvermutung. Trotzdem stellt sich die bekannte Frage: Inwieweit lassen sich Kunst und Künstler trennen – vor allem dann, wenn die Kunst bei einigen Künstlern mutmaßlich keine Kunst sondern Realität ist?
Genau darüber rätselt Hip-Hop-Fan John (Anmerkung der Red.: Er möchte anonym bleiben) schon lange. Eine Antwort hat er nicht. Fast etwas ratlos schaut er an die Decke der Küche einer Zwei-Zimmer-Wohnung in Hamburg-Eimsbüttel, in der er steht, als würde irgendwo dort die Antwort stehen. Aber sie steht da nicht. Vermutlich steht sie nirgendwo, weil es dafür keinen logischen Zusammenhang geben kann. Allein, wie es sich anhört: John, 35, Feminist und Deutschrap-Fan. Eine Einstellung, die sich für Gleichberechtigung einsetzt, und eine Musikrichtung, die das in ihren meisten Songs mit Füßen tritt. Das kann und darf nicht zusammenpassen.
Und doch tut es das in Johns Fall. Genau das findet auch er komisch. Genau das kann er sich nicht erklären. Warum ist er Fan von etwas, das so konträr zu seiner eigentlichen Einstellung steht? Während er bei Freunden sofort eingreift, wenn sie in altmodischen Rollenbildern sprechen, hört er im Rap dagegen weg. Er ignoriert es größtenteils in Texten von Kollegah, Capital Bra oder Fler. Aber es gebe dabei einen Unterschied, sagt er: "Deutschrap ist Kunst und Kunst ist frei. Für mich steht das auch über meinen Denkweisen, die ich sonst vertrete."
Tatsächlich wird das oft vergessen. Wenn Bushido etwa in "Stress ohne Grund" "Ich schieß' auf Claudia Roth und sie kriegt Löcher wie ein Golfplatz" rappt, darf das nicht wortwörtlich ausgelegt werden. Trotzdem wird es das oft. Dabei muss ein Künstler nicht mit dem Werk gleichgesetzt werden. Lyrisches Ich und so. Ein Rapper ist Künstler und macht Kunst. Kunst ist frei. Sie darf provozieren. Sie darf Grenzen überschreiten.
Dennoch ist unbestritten, dass Deutschrap frauenfeindlich ist. Das belegt nicht zuletzt ein datenjournalistisches Projekt von "Puls", dem Jugendradiosender des Bayrischen Rundfunks. Das hat die erfolgreichsten Deutschrap-Alben der Jahre 2000 bis 2015 auf diskriminierende Begriffe untersucht – und herausgefunden: Frauenfeindlichkeit kommt in Rap-Texten häufiger vor als jede andere Form der Diskriminierung; also Homophobie, Rassismus oder Behindertenfeindlichkeit. Man geht sogar soweit und sagt: "Sexism sells – oder ist zumindest kein Hindernis, wenn es um Verkaufszahlen geht."
Es geht also nicht darum, ob Rap sexistisch ist, sondern woran es liegt – und was man dagegen tun kann?
Frauen im Deutschrap
Das Reeperbahnfestival, Anfang September des vergangenen Jahres in Hamburg. Etwa drei dutzend Menschen sitzen in einer völlig überfüllten Bar auf dem Spielbudenplatz im Stadtteil Sankt Pauli. Während draußen Regentropfen auf die grauen Bordsteine prasseln, wird drinnen diskutiert. Vier Frauen und ein Mann sitzen auf einer provisorisch eingerichteten Bühne. Sie diskutieren über "Frauen im Rap". Es geht heiß her. Zu jeder Sekunde merken die Zuschauer im Publikum, wie emotional aufgeladen das Thema ist. Nur eine Person bleibt während des Gesprächs sehr bedacht: Miriam Davoudvandi.
Sie ist Chef-Redakteurin des Hip-Hop-Magazins "Splash-Mag" – und damit eine Seltenheit. Denn Frauen gibt es in der Männerdomäne Deutschrap nur sehr wenige. Und das hat seine Gründe, wie Davoudvandi NEON erzählt. "Ich hatte oft das Gefühl, dass ich im Gegensatz zu meinen männlichen Kollegen mehr kämpfen musste, in der Szene respektiert zu werden. Als man zum Beispiel zu meinem Namen noch kein Gesicht hatte, haben viele Künstler erst einmal gefragt, wo denn mein Chef sei."
Allerdings müsse man mit so etwas leben, sagt die Journalistin. "Es klingt perfide, aber um in einer Männerdomäne wie Deutschrap Fuß zu fassen, hilft es einem als Frau nicht, den Kopf in den Sand zu stecken. Deshalb sind gerade Repräsentation und Vorbilder wichtig. So sehen andere Frauen: Die hat es geschafft, dann kann ich es auch schaffen. Nur so können wir alte Rollenbilder aufbrechen." Mit anderen Worten: Vorangehen und dadurch Veränderung schaffen. Das bedeutet allerdings, vieles zu ignorieren – auch was vielleicht moralische und persönliche Grenzen überschreitet. Dass das nicht jede Frau machen will, zeigt der Fall von Helen Fares. Sie hatte jahrelang als Moderatorin fürs Rap-Portal "hiphop.de" gearbeitet. Im Juli 2017 hat sie plötzlich genug vom Hip-Hop-Journalismus. Der Grund: Sexismus.
Sie sei beim "Openair Frauenfeld" von mehreren Männern auf sexistische Art und Weise degradiert worden. Darunter Rapper, Promoter, Tourmanager, Artist-Entourage und Sicherheitsleute. "Es ging von 'Wenn dir zu warm ist, zieh dich doch einfach aus, ich freu mich dann endlich mal', über ekelhafte Blicke und 'Hey Süße' sagen beim Händeschütteln bis hin zu einem 'Du bist NOCH glücklich mit deinem Freund, ich besorg‘ mir deine Nummer, ich meld‘ mich dann mal und dann gucken wir doch, ob du noch so glücklich bist'", erzählt sie in einem langen und detaillierten Facebook-Post. Dabei berichtet Fares auch von einem Vorfall, bei dem ein Mann sie an den Kehlkopf gefasst und anschließend gesagt haben soll, dass dieser ganz schön tief säße. "Er fragte: 'Du hast keinen Würgereflex, oder?'", so die Journalistin.
Der Sexismus im US-Rap
Helen Fares ist mit ihren Vorwürfen nicht allein. Auch Hip-Hop-Journalistin Juliane Wieler hat Ähnliches erlebt, wie sie in einem Artikel der "FAZ" verrät. Demnach sei sie während eines Interviews vor zwei Jahren von einem Rapper körperlich angegangen worden. Als sie den Vorfall daraufhin öffentlich machte, hätten ihr Rap-Fans gesagt, dass sie zu großen Teilen sogar selbst schuld sei. Typisches Victim Blaming. Statt dem Täter wird dem Opfer die Schuld gegeben. Möglicherweise hat das im Deutschrap aber einen Grund. Denn: Die Vorfälle stellen ein Novum dar – weitere sind kaum bekannt. Sie können somit schön als Einzelfälle abgetan werden.
Ganz anders ist es in den USA. Dort ist die Liste von Rappern und Produzenten lang, denen sexuelle Übergriffe vorgeworfen oder die deshalb sogar verurteilt wurden. Da gibt es zum Beispiel den bereits verstorbenen Rapper XXXTentacion, der seine schwangere Freundin wiederholt missbraucht, verprügelt und getreten haben soll. Oder Russell Simmons, der Gründer des Hip-Hop-Labels Def Jam, dem drei Frauen in einem Bericht der "New York Times" Vergewaltigung vorgeworfen haben. Oder Big Sean, der 2011 auf einem Konzert in New York wegen sexuellen Missbrauchs an einer 17-Jährigen festgenommen wurde und sich der Freiheitsberaubung für schuldig bekannte, was ihm einen Deal vor Gericht einbrachte – und eine Strafe von 750 Dollar (zirka 660 Euro).
Viele Mosaiksteine, die ein vernichtendes Bild ergeben. Doch einen Aufschrei –geschweige denn eine #MeToo-Debatte in der US-Rap-Szene – gibt es bislang nicht. Auch hier seien es alles "nur" Einzelfälle, heißt es von offizieller Seite immer wieder. Das typische Kleingerede, um Schlimmeres zu verhindern; zumal diese Meldungen den betroffenen Künstlern nicht schaden. Wie die amerikanische Journalistin Amy Zimmerman herausfand, sind auffallend oft jene Künstler besonders erfolgreich, die wegen Gewaltdelikten vor Gericht standen. Klingt komisch, macht aber Sinn: Medien berichten über einen Vorfall eines Künstlers, dadurch wird eine große Masse auf ihn aufmerksam, sie fangen an, ihn zu googeln, stoßen auf seine Songs, finden vielleicht sogar Gefallen daran und verdrängen letztendlich, was er getan hat.
Wo ist die Grenze?
Natürlich lässt sich die Situation in den USA nicht mit der in Deutschland vergleichen. Die Vereinigten Staaten sind das Mutterland des Hip-Hops. Dort ist Rap Mainstream. Dementsprechend ist der Diskurs auch ein öffentlicher. Hierzulande ist es zwar die Jugendkultur Nummer eins – allerdings noch nicht so lange. Die Öffentlichkeit behandelt Hip-Hop immer noch stiefmütterlich. Von außen wird herabgeschaut und innen verhält man sich defensiv. Man kämpft noch gegen veraltete Klischees an. "Das ist auch EIN (nicht DER) Grund, warum Vorfälle nicht öffentlich gemacht werden. Die Betroffenen haben Angst, sich etwas zu verbauen", schlussfolgert Miriam Davoudvandi.
Letzteres beschreibt das Dilemma, in dem Menschen wie John stecken. Als Fan eines Künstlers ist es auch immer eine emotionale Frage, inwieweit sich der Künstler und die Kunst von der Person, dem Menschen dahinter trennen lassen. Viele handeln deshalb aus Trotz gegenüber den Medien und Treue zu ihrem Idol: Nein, der tut so etwas nicht. Das glaube ich nicht. Das will ich nicht glauben, so ihr Standpunkt. Auch John geht noch einmal auf seine vorherige Aussage ein, das Kunst frei sei: "Irgendwie kannst du es nicht immer trennen, weil die Übergänge im Rap zwischen Kunstfigur und der Privatperson oftmals fließend sind. Gerade das macht einen Künstler authentisch." Das mag sein. Nur: Wo wird dann die Grenze gezogen – zwischen authentischer Kunst und moralisch fragwürdig?

Fler: "Ändere doch meine Welt, in der ich lebe"
Das Paradebeispiel dafür ist die 187 Strassenbande. Die Mitglieder geben sich nicht nur in ihrer Musik als echte Gangster aus, sondern sind es auch im wahren Leben. Rapper Gzuz wurde beispielsweise schon wegen räuberischen Diebstahls zu drei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Wenn er über Straftaten und den Knast rappt, ist es authentisch. Nur wirft es eben auch die Frage auf: Ist das jetzt die Kunstfigur, die da rappt, oder die Person dahinter?
"Ganz schwierig", sagt Marie Curry. Sie ist Sängerin und Rapperin der Hamburger Hip-Hop-Gruppe Neonschwarz. "Das Argument 'Das ist Kunst!' nutzen viele Rapper als Ausrede. Sie verstecken sich dahinter, wenn sie übers Ziel hinausgeschossen sind. Dennoch muss man auch sagen, dass der Kontext eine Rolle spielt. Also: Woher, aus welchen Verhältnissen kommt derjenige, der das rappt?"
In Gzuz Fall bedeutet das: aufgewachsen in armen Verhältnissen, viel Scheiße durchgemacht, Drogendelikte, Prügeleien und letztendlich Knast. In seiner Musik verarbeitet er all das. Und genau das macht es zu authentischer Kunst. Die Tatsache, dass er dabei gewaltverherrlichend und frauenverachtend ist, liegt daran, dass seine Welt genau das ist. Das mag für Außenstehende nicht nachvollziehbar sein. Dennoch erklärt es, warum er bestimmte Dinge in seinen Songs rappt.
Der Berliner Rapper Fler sagte NEON dazu einmal passend in einem Interview: "Wenn man meine Musik ändern will, dann ändere doch meine Welt, in der ich lebe. Ganz einfach. Nur weil Leute, die das kritisieren, das Glück haben, in einer Welt ohne Kriminalität und Gewalt aufzuwachsen, heißt es noch lange nicht, dass das für jeden gilt." Ein Gangster-Rapper ist für ihn sozusagen ein Reporter der Straße. Er spricht in seiner Musik über eine Lebenswelt, die Otto Normalverbraucher oder Spitzenverdiener nicht kennen.
Aus diesem Grund ist es ein Unterschied, ob ein Gzuz oder ein Cro etwas Frauenfeindliches rappt. Das soll weder das eine noch das andere legitimieren. Denn ein Sexist bleibt immer ein Sexist – egal welche Gründe es dafür gibt. Allerdings macht es einen Unterschied, ob die Welt eines Sexisten extrem sexistisch ist – oder der Sexist den Sexismus selber verursacht. Die Motive sind verschieden.
"Die nachfolgende Generation konsumiert Rap unkritisch"
Nichtsdestotrotz dürfe der Einfluss nicht unterschätzt werden, die solche Lyrics auf die größtenteils junge Hörerschaft haben können, sagt Nico Hartung. Er ist Deutschlands einziger Rap-Pädagoge® und Gründer des Tuned-Jugendprojekts. Mit seinem Projekt bietet er seit vielen Jahren Jugendlichen und Kids mit Rap-Ambitionen eine Plattform und die Möglichkeit, sich gewaltfrei auszuleben. "Grundsätzlich glaube ich, dass sich die Hörerschaft darüber bewusst ist, dass Rap explizit provoziert und Themen gerne überspitzt darstellt. Allerdings hat sich die Hörerschaft in den letzten Jahren deutlich vergrößert und das ist ein Problem. Denn: Die neuen Fans verstehen nicht immer den Hintergrund – und setzen sich auch damit nicht auseinander."

Als Beispiel nennt Hartung vor allem Grundschüler: "Sie übernehmen häufig Floskeln, ohne eine Ahnung zu haben, was der Rapper damit überhaupt sagen will. Das sehe ich als ein großes Problem an. Die nachfolgende Generation konsumiert Rap unkritisch. Dazu kommt, dass sie eben auch ganz wenig Möglichkeiten haben, es im Kontext zu reflektieren – also mit Leuten, die sich damit auch auseinandersetzen." Kurzum: Jugendliche und Kids müssen besser aufgeklärt werden. Allerdings sei es aus seiner Sicht der falsche Ansatz, wenn das die Eltern-Generation übernimmt: "Rap versucht die Adoleszenz der Gesellschaft darzustellen. Das macht es provokant und zugespitzt. Gleichzeitig wird dabei auf ein gesellschaftliches Phänomen hingewiesen."
Nicht Deutschrap allein ist also das Problem, sondern die Gesellschaft an sich. Musikjournalist Falk Schacht hat Rap in einem Interview mit dem WDR mal als "hässliche Fratze der Gesellschaft" bezeichnet. Ja, es ist die alte Leier, aber es trifft den Nagel auf den Kopf. Wenn man sich das gesellschaftliche Bild der Frau anschaut, dann fällt auf, dass die Welt noch immer patriarchalisch geprägt und oft sexistisch ist. Zum Beispiel: sexistische Werbung. Zum Beispiel: Paragraf 219a, der es Ärzten verbietet, auf ihren Webseiten anzugeben, dass sie Schwangerschaftsanbrüche anbieten. Zum Beispiel: Luxussteuer auf Menstruationsprodukte. Zum Beispiel: die katholische Kirche, in der immer noch nur Männer das Sagen haben. Zum Beispiel: das Gender-Pay-Gap. Männer verdienen noch immer 21 Prozent mehr als Frauen. Ja, der bereinigte Wert liegt "nur" bei sechs Prozent. Allerdings arbeiten Frauen öfter in Teilzeit, was auch damit zu tun, dass sie sich noch immer mehr um die Familie kümmern und weniger Zeit für die Arbeit haben. Zum Beispiel: der Bundestag. In dieser Legislaturperiode sind nur 30,8 Prozent der Abgeordneten Frauen.
Natürlich relativiert all das die bestehende Frauenfeindlichkeit im Hip-Hop nicht. Es braucht definitiv einen kritischeren Umgang in der Szene als bisher. Dennoch zeigt es aber auch, dass die Gesellschaft sich erst einmal selbst hinterfragen sollte, was sie im Umgang mit Frauen ändern könnte, bevor sie mit dem Finger auf andere zeigt. Es braucht schlichtweg ein Umdenken im Umgang mit Deutschrap. Bevor es in Zukunft wieder heißt, Hip-Hop mache unsere Jugend kaputt, sollten Fragen gestellt werden, wie: Warum rappt der das überhaupt? Was sagt das vielleicht auch über uns aus? Was können wir besser machen, damit er das nicht mehr rappt? Und wie erklären wir es der jungen Hörerschaft, die Songtexte nicht hinterfragen?
Wenn das gemacht wird, ist sich auch Miriam Davoudvandi sicher: "Dann wird es auch mit dem Frauenbild im Deutschrap besser." Für Johns Dilemma heißt das: Es braucht mehr Gleichberechtigung für weniger Frauenfeindlichkeit im Rap.
Quellen: WDR / "Süddeutsche Zeitung" / "New York Times" / NEON / "The Daily Beast" / Facebook Helen Fares / "Faz.net" / "rap.de"