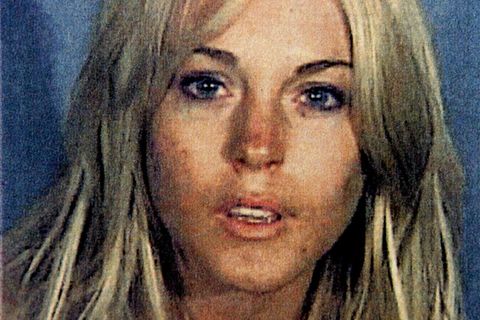Das Buch beginnt ganz harmlos: "Stellen wir uns doch mal eine Welt vor, in der es keine Religion gibt - keine Selbstmordattentäter, keinen 11. September, keine Anschläge auf die Londoner U-Bahn, keine Kreuzzüge, keine Hexenverfolgung, keine Aufteilung Indiens, keinen Krieg zwischen Israelis und Palästinensern, kein Blutbad unter Serben/ Kroaten/Muslimen, keine Verfolgung von Juden als "Christusmörder", keine "Ehrenmorde", keine pomadigen Fernseh- Evangelisten im Glitzeranzug, die leichtgläubigen Menschen das Geld aus der Tasche ziehen. Stellen wir uns vor: keine Zerstörung antiker Statuen durch die Taliban, keine öffentlichen Enthauptungen von Ketzern, keine Prügel für das Verbrechen, zwei Zentimeter nackte Haut zu zeigen ..." Schon mit dem Vorwort seines jüngsten Werkes "Der Gotteswahn" treibt Richard Dawkins Fundamentalisten aller Religionen auf die Barrikaden. Der Biologieprofessor aus Oxford hat offenkundig Spaß an der Polemik. Sein 500- Seiten-Opus stand in Großbritannien, Kanada und den USA wochenlang an der Spitze der Bestsellerlisten. Vor 30 Jahren machte der junge Wissenschaftler mit dem Buch "Das egoistische Gen" zum ersten Mal Furore, als er Charles Darwins Theorie der Evolution auf die Spitze trieb: Danach hängt das Überleben einer Art ausschließlich vom Erbgut ab.
Alle Gene wollen überleben, aber nur jene schaffen es, die sich am besten an die herrschenden Bedingungen anpassen. Wenig später begann Dawkins auch seine Auseinandersetzung mit der Religion. Nun erscheint sein "Gotteswahn" auf Deutsch, und es bedarf keiner übernatürlichen Kräfte, um zu prophezeien, dass der Band auch in der Sprache Luthers und in der Heimat Papst Benedikts XVI. einen Sturm im Weihwasserbecken entfachen wird. Denn Dawkins hält sich nicht lange bei den Auswüchsen der Religiosität auf, den Irrungen fanatischer Dschihadisten oder den Verbrechen der Kurie. Würde er nur die Eiferer geißeln, hätte er vermutlich die friedlichen Muslime und die besonnenen Christen an seiner Seite. Doch er zielt auf den Kern des Glaubens und bricht gleich zwei große Tabus. Er zweifelt die Existenz Gottes direkt an, und er tut dies mit den Mitteln der Naturwissenschaft. Damit erzürnt Dawkins auch Fachkollegen. "Wissenschaft muss sich auf das begrenzen, was sie analysieren kann, sie darf nicht darüber hinausgehen", mahnt etwa Reinhold Leinfelder, Generaldirektor des Berliner Museums für Naturkunde. "Die "Gotteshypothese" ", entgegnet Dawkins auf solche Einwände, "ist eine wissenschaftliche Hypothese über das Universum, die man genauso skeptisch analysieren sollte wie jede andere auch" - und verweist auf eine Parabel Bertrand Russells. In dessen Gedankenspiel kreist eine Teekanne im Weltall, so winzig, dass sie selbst mit den stärksten Teleskopen nicht zu erkennen ist.
Haben wir nun einen Gott in drei Teilen oder drei Götter in einem?
Die Existenz einer solchen Teekanne dürfte man mit allen Methoden jederzeit anzweifeln, selbst wenn sie jeden Sonntag als heilige Wahrheit verkündet würde. Aber wenn die Teekanne "Gott" genannt wird, gilt die wissenschaftliche Prüfung plötzlich als "unerträgliche Überheblichkeit der menschlichen Vernunft", sagt Dawkins und schreitet zur nächsten Provokation. "Der Gott des Alten Testaments ist die unangenehmste Gestalt der gesamten Dichtung: eifersüchtig und auch noch stolz darauf; ein kleinlicher, ungerechter, nachtragender Kontroll-Freak; ein rachsüchtiger, blutrünstiger ethnischer Säuberer; ein frauenfeindlicher, homophober, rassistischer, kinds- und völkermörderischer, ekliger, größenwahnsinniger, sadomasochistischer, launisch-boshafter Tyrann." Das Charakterbild Jahwes ist die meistzitierte Passage des Buches. Dawkins benutzt sie auch gern auf seinen Lesungen, um beim Publikum "das Eis zu brechen". Die Menschen, so das aufklärerische Kalkül des Autors, kennen diesen Gott, haben sich innerlich aber längst von ihm verabschiedet. Sie sollen ihm wiederbegegnen und staunen, was für ein Monster sie im Grunde anhimmeln. Der Gott des Neuen Testaments ist in Dawkins’ Augen allerdings nicht besser. "Womit haben wir es überhaupt zu tun?", fragt er, etwa bei der Dreifaltigkeit, "über deren "Geheimnis" ganze Ströme mittelalterlicher Tinte vergossen wurden -von Blut ganz zu schweigen. Haben wir nun einen Gott in drei Teilen oder drei Götter in einem? Diese Frage beantwortet uns die Catholic Encyclopedia mit einem Meisterstück scharfsinniger Argumentation: "In der Einheit der Gottheit sind drei Personen: der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Diese drei Personen sind wirklich voneinander unterschiedlich."
Die Kirche, ätzt der Professor, habe den Wechsel vom Polytheismus der griechischen und römischen Götter zum Monotheismus als Fortschritt verkauft. Aber bei den Katholiken sei "der Dauerflirt mit dem Polytheismus in eine galoppierende Inflation gemündet", und genüsslich zählt er auf: "Die Dreifaltigkeit wird (oder werden sie?) durch Maria erweitert, die "Himmelskönigin", die in allem außer ihrem Namen eine Göttin ist und als Ziel der Gebete nur ganz knapp hinter Gott an zweiter Stelle steht." Weiter aufgeblasen werde das Pantheon durch eine Armee von 5.120 Heiligen, zuständig für Waffenhändler, Schmiede, Bombentechniker, für Bauchschmerzen, Magersucht oder Darmerkrankungen. Schritt für Schritt geht Dawkins weiter, von den verschiedenen Gottesgestalten der Bibel zum allgemeinen Gottesbegriff, der sich in Stoßseufzern und Gebeten manifestiert. Dabei kommt ihm eine Studie der Templeton Foundation zupass, einer Stiftung zur Förderung des Glaubens, die für 2,4 Millionen Dollar untersuchen ließ, ob "Fürbittgebete in einem medizinischen Umfeld" wirksam sind. Unter Leitung des Kardiologen Dr. Herbert Benson vom Mind/Body Medical Institute in der Nähe von Boston wurden 1.802 Patienten, die sich alle einer Bypass-Operation am Herzen unterzogen hatten, nach dem Zufallsprinzip in drei Gruppen geteilt. Für die Gruppe 1 wurde gebetet, ohne dass die Kranken es wussten. Für die Gruppe 2 wurde nicht gebetet, und die Patienten wussten ebenfalls nichts davon. Für die Gruppe 3 wurde gebetet, und die Betroffenen wussten es. Die Ergebnisse veröffentlichte das "American Heart Journal" im April 2006: Zwischen den Patienten, für die gebetet, und denen, für die nicht gebetet wurde, war kein Unterschied festzustellen.
Dawkins gegen den Opportunismus der Halb- und Dreiviertelgläubigen
Die Patienten jedoch, die wussten, dass für sie gebetet wurde, litten signifikant häufiger an Komplikationen. "Es hat sie vielleicht verunsichert", sagte einer der Wissenschaftler. "Sie grübelten, "bin ich so krank dass man für mich beten muss?" " Selbst Forscher, die dem Glauben aufgeschlossen gegenüberstehen, tun sich offensichtlich schwer, Gott in ihren klinischen Experimenten zu entdecken. "Von den amerikanischen Naturwissenschaftlern, die bei ihren Kollegen als so hoch qualifiziert gelten, dass sie in die National Academy of Sciences gewählt wurden, glauben nur sieben Prozent an einen persönlichen Gott", schreibt Dawkins. "Dieses überwältigende Übergewicht der Atheisten ist das genaue Gegenbild zum Profil der amerikanischen Gesamtbevölkerung, in der über 90 Prozent der Menschen an irgendein übernatürliches Wesen glauben." Auch Einstein kommt ausführlich zu Wort. In den berühmten Zitaten "Gott würfelt nicht" oder "Gott ist raffiniert, aber boshaft ist er nicht", die in vielen frommen Büchern auftauchen, benutze der große Physiker den Begriff "Gott" in einem rein metaphorischen Sinn. "Das Wissen um die Existenz des für uns Undurchdringlichen, der Manifestationen tiefster Vernunft und leuchtendster Schönheit, die unserer Vernunft nur in ihren primitivsten Formen zugänglich sind", so Einstein, "dies Wissen und Fühlen macht wahre Religiosität aus; in diesem Sinne, und nur in diesem, gehöre ich zu den tief religiösen Menschen." "In diesem Sinne bin auch ich religiös", bekennt Dawkins. "Indes, ich nenne mich lieber nicht "religiös", weil für die allermeisten Menschen "Religion" das "Übernatürliche" impliziert.
Der metaphorische Gott der Physiker ist Lichtjahre entfernt von dem eingreifenden, wundertätigen, Gedanken lesenden, Sünden bestrafenden, Gebete erhörenden Gott der Priester, Mullahs, Rabbiner und der Umgangssprache. Beide absichtlich durcheinanderzubringen ist intellektueller Hochverrat." Auch an anderer Stelle wettert Dawkins gegen den Opportunismus der Halb- und Dreiviertelgläubigen. "Der berühmte französische Mathematiker Blaise Pascal machte eine Rechnung auf: So unwahrscheinlich Gott auch sein mag, man sollte lieber an ihn glauben. Wenn man recht hat, wird einem ewige Gnade zuteil, und wenn man unrecht hat, ist es ohnehin egal. Glaubt man aber nicht an Gott und hat damit unrecht, fällt man der ewigen Verdammnis anheim." Sind deshalb so viele Menschen religiös, Mr Dawkins? Der Biologe verweist auf den Psychiater J. Anderson Thomson: "Wir halten eher einen Schatten für einen Einbrecher als einen Einbrecher für einen Schatten." Wenn wir falsch liegen, können wir uns im ersten Fall vielleicht unnötig erschrecken, im zweiten Fall könnten wir tot sein. "Unser Erbe besteht darin, dass wir automatisch eine menschliche Absicht unterstellen und uns häufig davor fürchten. Dies haben wir in verallgemeinerter Form auf göttliche Absichten übertragen." Dawkins sieht in der Religion noch ein anderes Nebenprodukt: Menschen nutzen die Erfahrungen früherer Generationen. Für ein Kind bedeutet es einen Überlebensvorteil, wenn es die Faustregel lernt: "Gehorche deinen Eltern; gehorche den Stammesältesten, insbesondere wenn sie in ernstem, feierlichem Ton zu dir sprechen."
Aber das Kind kann nicht unterscheiden, dass "Plansch nicht in einem Teich voller Krokodile" ein guter Ratschlag ist, während "Du sollst bei Vollmond eine Ziege opfern, sonst bleibt der Regen aus" zur Vergeudung von Zeit und Ziegen führt. Und einige solcher "Wahrheiten" und Gebote setzen sich zäh in unserem kulturellen Erbe fest. Auf dem Weg zu seinem erklärten Ziel, die Existenz Gottes infrage zu stellen, scheint Dawkins oft abzuschweifen. Doch sein Vorgehen hat Methode, und meist ist es ein großer Spaß, dem Autor in die Gedankenwelten der Glaubensapologeten und ihrer Widersacher zu folgen. Da ist etwa der ontologische Gottesbeweis, den der heilige Anselm von Canterbury 1078 formulierte: Man denke sich ein Wesen, das so groß ist, dass man sich nichts Größeres vorstellen kann. Aber wenn das Wesen in der wirklichen Welt nicht existiert, ist es allein deshalb nicht vollkommen. Also muss es existieren, und siehe da, es gibt Gott. Immanuel Kant erkannte "die Trickkarte in Anselms Ärmel: die fragwürdige Annahme, "Existenz" sei vollkommener als "Nichtexistenz" ". Und der Philosoph Douglas Gasking, kehrte den Spieß um:
1. Die Erschaffung der Welt ist die größte vorstellbare Errungenschaft. 2. Der Wert einer Leistung ist das Produkt ihrer inneren Qualität und der Fähigkeiten ihres Schöpfers. 3. Je größer die Hindernisse sind, die der Schöpfer überwinden muss, desto eindrucksvoller ist seine Leistung. 4. Das größte Hindernis für einen Schöpfer würde darin bestehen, dass er nicht existiert. 5. Wenn wir also annehmen, dass das Universum das Produkt eines existierenden Schöpfers ist, können wir uns ein noch größeres Wesen vorstellen, nämlich eines, das alles erschaffen hat, obwohl es nicht existiert. 6. Ein existierender Gott wäre also nicht so groß, dass man sich nicht etwas noch Größeres vorstellen könnte, denn ein viel leistungsfähigerer und unglaublicherer Schöpfer wäre ein Gott, den es nicht gibt. Also: 7. Gott existiert nicht.
Dawkins selbst führt die Gottesbeweise des Thomas von Aquin aus dem 13. Jahrhundert ad absurdum, etwa den vierten, das Argument der Stufungen. Es gebe, so lehrt der Heilige, Abstufungen, etwa von Tugend oder Vollkommenheit. Aber solche Abstufungen können wir nur durch den Vergleich mit einem Maximum beurteilen. Menschen können sowohl gut als auch schlecht sein, also kann das Maximum des Gutseins nicht in uns liegen. Es muss ein anderes Maximum geben, und das nennen wir Gott. "Das soll ein Argument sein?", lästert Dawkins. "Ebenso gut kann man sagen: Die Menschen unterscheiden sich in der Stärke ihres Körpergeruchs, aber einen Vergleich können wir nur anhand eines vollkommenen Maximums an vorstellbarem Körpergeruch anstellen. Es muss also einen überragenden Stinker geben, der nicht seinesgleichen hat, und den nennen wir Gott." Der fünfte Gottesbeweis des Thomas von Aquin ist das teleologische Argument, auch Gestaltungsargument genannt. Die Dinge in der Welt und insbesondere die Lebewesen sehen so aus, als wären sie gezielt gestaltet worden. Nichts, was wir kennen, sieht gestaltet aus, wenn es nicht gestaltet ist. Also muss es einen Gestalter geben, und den nennen wir Gott. "Das Gestaltungsargument wird als Einziges noch heute regelmäßig angeführt, und für viele Menschen hört es sich absolut schlagend an", schreibt Dawkins. Insbesondere für die Kreationisten, die sich daran klammern, dass die Welt in sieben Tagen erschaffen wurde, wie im ersten Buch Mose beschrieben, oder dass sie zumindest Produkt des "Intelligent Design" eines Schöpfergottes ist. Die Bibeltreuen, die ihre Version im Schulunterricht der USA durchsetzen wollen, stützen sich dabei gern auf den Satz eines britischen Astronomen: "Die Wahrscheinlichkeit, dass Leben auf der Erde entsteht, ist nicht größer als die, dass ein Wirbelsturm, der über einen Schrottplatz fegt, rein zufällig eine Boeing 747 zusammenbaut."
Der Schöpfer ist ein Käfermacher
Das haben die Kreationisten auf kompliziert gebaute Lebewesen übertragen. Ein Pferd, ein Käfer oder ein Straußenvogel könne nur aus planvollem Wirken hervorgehen. An diesem Punkt ist der Evolutionsforscher Dawkins in seinem Element: "Wohl nie wurde eine für allgemeingültig gehaltene Wahrheit so auseinandergenommen wie das Gestaltungsargument durch Darwins kluge Beweisführung." Aus einfachsten Lebensformen entstehen durch Genmutationen veränderte Lebewesen. Je besser sie ihrer Umgebung angepasst sind, desto erfolgreicher können sie sich vermehren. Durch den Prozess von Mutation und Selektion bildet sich Schritt für Schritt in Jahrmillionen eine unwahrscheinliche Artenvielfalt heraus. Dawkins’ Fazit: "Die Evolution durch natürliche Selektion erzeugt ein ausgezeichnetes Scheinbild einer Gestaltung, die in Komplexität und Eleganz gewaltige Höhen erreichen kann." Die Kreationisten suchen eifrig nach einer Lücke im System. Sie nehmen ein Wunder der Natur, ganz gleich ob Gießkannenschwamm oder Pfeifenwinde (deren elegante Blüte wirkt, als wäre sie gezielt konstruiert, um Insekten einzufangen), und erklären es für so zauberhaft, komplex, ehrfurchtgebietend und unwahrscheinlich, dass es nicht durch Zufall entstanden sein könne. "Doch die intelligente Gestaltung unterliegt genau dem gleichen Einwand: Ein Etwas, das etwas so Unwahrscheinliches wie die Pfeifenwinde (oder ein Universum) intelligent gestalten kann, muss noch unwahrscheinlicher sein als die Pfeifenwinde", schreibt Dawkins. Die zentrale Argumentation seines Buches fasst er in sechs Punkten zusammen:
1. Jahrhundertelang war es eine der größten Herausforderungen für den menschlichen Geist, zu erklären, wie im Universum "der komplexe, unwahrscheinliche Eindruck gezielter Gestaltung entstehen konnte". 2. "Es ist eine natürliche Versuchung, den Anschein von Gestaltung auf tatsächliche Gestaltung zurückzuführen. Bei Produkten der Menschen, beispielsweise einer Uhr, war der Gestalter tatsächlich ein intelligenter Ingenieur. Man ist leicht versucht, die gleiche Logik auch auf ein Auge oder einen Flügel, eine Spinne oder einen Menschen anzuwenden." 3. "Diese Versuchung führt in die Irre, denn die Gestalterhypothese wirft sofort die noch umfassendere Frage auf, wer den Gestalter gestaltet hat." Und die Antwort kann offenkundig nicht sein, das Unwahrscheinliche (unser Universum) durch etwas noch Unwahrscheinlicheres (Gott) zu erklären. Wir brauchen eine Erklärung, wie sich aus etwas Einfachem in einem dynamischen Prozess stufenweise eine "ansonsten unwahrscheinliche Komplexität" aufbaut. 4. Und das ist, nach derzeitigem Stand, die darwinistische Evolution. Darwin und seine Nachfolger haben uns gezeigt, wie sich Lebewesen von spektakulärer, unwahrscheinlichster Gestalt langsam und allmählich aus einfachen Anfängen heraus entwickelt haben - die dann wirkten, als wären sie speziell für ihre Umgebung oder Lebensform gestaltet worden. 5. Ein entsprechend befriedigendes Prinzip für die Physik (also für die Entstehung des Universums) kennen wir noch nicht. 6. Wir sollten die Hoffnung nicht aufgeben, dass auch in der Physik ein Prinzip gefunden wird, das ebenso leistungsfähig ist wie der Darwinismus. Doch jetzt schon sind die bekannten Theorien ganz offenkundig besser als "die Hypothese von einem intelligenten Gestalter. Wenn man dieser Argumentation folgt, ist die Grundvoraussetzung der Religion - die Gotteshypothese - nicht mehr haltbar. Gott existiert mit ziemlicher Sicherheit nicht".