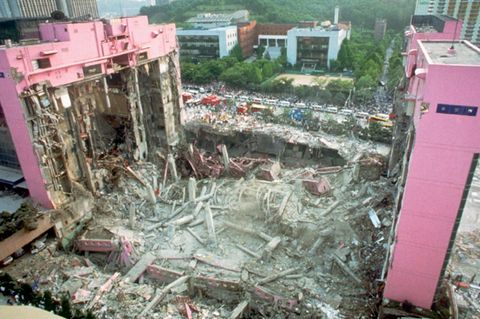Drei Minuten noch!" Hwang Woo-Suk schiebt das schwarze Bohnenmus und den Rest vom Reis zur Seite. Die vier Assistenten legen die Stäbchen nieder - wenn der Chef "drei Minuten" sagt, meint er nicht vier. Für Punkt 13 Uhr ist der Aufbruch geplant. Hwang wirft sich die graublaue Anzugjacke über, greift sein Handy. Ein Mitarbeiter reicht ihm Tasche und einen Report aus dem "San Francisco Chronicle". Es ist einer von Hunderten Artikeln, die in der vergangenen Woche veröffentlicht wurden. Über eine wissenschaftlichen Sensation aus Südkorea: Erstmals ist es einem Forscher gelungen, aus den Körperzellen Kranker geklonte Embryonen zu erzeugen und aus diesen wiederum Stammzellen zu gewinnen - Rohstoff für gesundes Gewebe, das dem Patienten als genetisch identischer Ersatz für das erkrankte Organ eingepflanzt werden kann.
Bis dahin sei es aber noch ein weiter Weg, räumt Hwang ein. So drängt es ihn zum nächsten Experiment. Auf dem Flur vor seinem Büro verbeugen sich artig alle Mitarbeiter in Sichtweite, Hwang stürmt zum Aufzug - 12 Uhr 59.
In der Tiefgarage des Instituts haben sich bereits vier auffallend große Koreaner mit Knopf im Ohr um zwei Hyundai Grandeurs aufgebaut. Die Nobel-Limousinen mit getönten Scheiben sind so schwarz wie die Anzüge der Bodyguards. Wortlos werden der Professor und sein Gepäck verstaut. Wie jeden Montag, Donnerstag und Samstag geht es zur Laborfarm rund 120 Kilometer südlich von Seoul, wo Hwang Klonversuche an Schweinen macht. Was er dort lernt, will er auf Menschen übertragen. Zwei Sauen sollen heute künstliche Embryonen eingepflanzt werden - Chefsache. Trotz des dichten Verkehrs kommen die Wagen zügig voran, rote und blaue Alarmlampen hinter dem Kühlergrill sorgen für freie Fahrt.
Professor Hwang Woo-Suk ist ein Nationalheld, wird entsprechend gehätschelt und bewacht wie ein Staatsschatz. 26,5 Millionen Dollar hat der Wissenschaftler allein in diesem Jahr aus der Regierungskasse erhalten. 45 Mitarbeiter stehen ihm direkt zur Verfügung, 183 Wissenschaftler zählt das komplette Team einschließlich der Humanmediziner, die Hwang, obwohl Tierarzt, ebenfalls dirigiert. Sein Institut im Gebäude 85 der Seoul National University, wo Koreas Elite studiert, wird derzeit erweitert. Auch symbolisch erfährt Hwang jede Unterstützung: Vor dem Klonlabor sind große Orchideengebinde aufgereiht, Dankesgaben von Landsleuten. Und die Post brachte eine Sondermarke heraus.
Sie lieben ihn. Während deutschen und US-amerikanischen Kollegen mit Ethikgesetzen die Arbeit an menschlichen embryonalen Stammzellen schwer bis unmöglich gemacht wird, lebt Hwang Woo-Suk in einem Forscherparadies. Warum aber dann Bodyguards, wenn doch angeblich das ganze Land stolz ist und ihn Regierung wie Opposition einmütig für den Nobelpreis vorschlagen wollen? "Es gibt auch bei uns religiöse Fanatiker", sagt er schulterzuckend. Und gut 50 Kilometer nördlich von Seoul verläuft die Grenze, hinter der Diktator Kim Jong Il mal über eine neue Oper, mal über die Atombombe nachsinnt und womöglich auch über den Tod oder eine Entführung des Klonstars aus dem Süden. "Wer weiß das schon", sagt Hwang leise.
Der zierliche Professor
hat sich an die Weltspitze eines Forschungsfeldes hochgeackert, dessen Vertreter eine Revolution der Medizin versprechen. Gegner werfen ihnen vor, dafür menschliches Leben zu opfern. Auch die Eizellspenden junger Frauen, die Hwang für seine Arbeit benötigt, sind umstritten. Doch er wiegelt ab. "Alles unterliegt einem strengen ethischen Reglement. Die Frauen unterziehen sich der Prozedur freiwillig und ohne jede Bezahlung. Sogar für die Fahrt zur Klinik müssen sie selber aufkommen. Sie wollen der Medizin helfen. Und dafür bin ich ihnen sehr dankbar."
Und nun liegt er vorn in einem Wettlauf um die künstliche Gewinnung humaner Stammzellen: In die entkernte Eizelle einer gesunden Frau wird die Körperzelle eines Kranken eingepflanzt. Der dabei entstehende Embryo produziert schon nach etwa einer Woche so genannte Stammzellen - aus denen sich in der Folge alle spezialisierten Zellen und Organe eines Menschen entwickeln. Die biologischen Alleskönner sind der Rohstoff für eine Medizin der Zukunft, die ersetzen soll, was in einem Menschen alt oder krank geworden ist (siehe Grafik Seite 156). Doch um sie zu gewinnen, müssen menschliche Embryonen künstlich erzeugt und dann abgetötet werden. Aus 100 oder 150 Zellen bestehen sie dann, so klein, dass man ein Mikroskop braucht, um sie zu erkennen.
"Diese winzigen Gebilde liegen in der einen Schale", sagt Hwang und deutet mit den Händen eine Waage an. "In der anderen vielleicht 40 oder 50 Jahre Leiden von chronisch kranken Menschen, ihren Familien und der Gesellschaft, die sie versorgen muss. Ist dann nicht klar, welche Entscheidung fallen sollte?" Er lässt die Hände sinken. Ja, er verstehe die moralischen Einwände seiner Gegner. Teilen aber könne er sie nicht.
Und "adulte Stammzellen"? Die sind in jedem Erwachsenen zu finden, könnten also aus einem Patienten selbst gewonnen werden, ohne einen Embryo zu opfern. Das wäre sicher die ethisch einwandfreie Lösung, sagt Hwang. Doch adulte Stammzellen seien bei weitem nicht so flexibel wie die embryonalen und deshalb keine Alternative.
Dann entschuldigt er sich mit asiatischer Höflichkeit. "Ich habe die ganze Nacht durchgearbeitet. Dürfte ich etwas schlafen?" Sein Kopf kippt auf die Rückbank. In der linken Hand hält er noch immer den Zeitungsartikel, in der rechten sein Handy. Kurz vor dem Ziel tönt Vogelgezwitscher aus Hwangs Hosentasche - sein zweites Handy. Er schnellt aus dem Schlaf auf.
"Schön, nicht wahr?", fragt er nach dem Telefonat und zeigt auf eine Landschaft, die wie ein Hochsauerland mit Reisfeldern aussieht. "In meiner Kindheit stand auf diesen Hügeln kein einziger Baum mehr. Alles hatten die Menschen abgeholzt, um im Winter nicht frieren zu müssen. Meiner Familie ging es nicht besser. Und gehungert haben wir auch."
Der Koreakrieg hatte das Land verwüstet, als Hwang Woo-Suk am 29. Januar 1953 in Puyo, einem Dorf von gerade 20 Familien tief im Süden der Halbinsel, zur Welt kam. Er war fünf, da starb sein Vater an einem Hirnschlag. Um ihre sechs Kinder durchbringen zu können, schuftete die Mutter auf den Reisfeldern und versorgte drei geliehene Kühe vom Nachbarn, deren Kälber sie dann behalten durfte. Auch der kleine Woo-Suk musste die Tiere hüten. "Ich habe mich regelrecht in sie verliebt", erzählt er lachend. "Noch heute weiß ich, was Kühe denken, wenn ich ihnen in die Augen sehe." Das kann er inzwischen auf einer eigenen Ranch, wo er ebenfalls experimentiert. Durch genetische Veränderungen und Klonen will er Tiere züchten, denen der Rinderwahn BSE nichts mehr anhaben kann.
Nur für zwei der sechs Geschwister war genug Geld für die Schule da. Woo-Suk gehörte dazu und kam in die Provinzhauptstadt Taejon. Seine anhaltende Armut brachte ihn dort in die Kirche. Ende der 1960er Jahre ließ er sich sogar taufen, doch der neue Glaube trieb bei ihm keine Wurzeln. Heute versteht sich Hwang nicht mehr als Katholik; wäre das anders, würde er kaum mit menschlichen Embryonen experimentieren.
Sein letzter Schullehrer
versuchte den Jungen mit Ohrfeigen in den Arzt-beruf zu drängen. Ohne Erfolg. "Jeder andere hätte sich darum gerissen", sagt Hwang. "Ich nicht. Schließlich habe ich mich durchgesetzt und studierte Tiermedizin." Seine Sturheit war schon damals legendär. Die Härte, mit der er sich durchbeißen musste, bekommen heute auch seine Mitarbeiter zu spüren: Als einem Assistenten im Schweinestall die Abdeckung des Operationsfeldes verrutscht, setzt es einen Tritt gegen das Bein und eine wütende Standpauke des Professors.
"Ich bin ein Eigengewächs, der Traum aller einfachen Koreaner", sagt Hwang und wirkt dabei nicht einmal überheblich. Eine ausländische Universität hat er nie besucht. Das ist ihm wichtig und wohl auch seiner Regierung. Mit dem Ministerpräsidenten ist Hwang seit der gemeinsamen Studienzeit befreundet. Inzwischen hat er etliche attraktive Angebote für Professuren im Ausland. Er will sie wohl auch annehmen - als Gast. "Mein Basislager bleibt auf jeden Fall in Seoul."
Dort ist Hwang auf dem Umweg durch die Ställe doch noch in der Menschenmedizin gelandet. 1999, drei Jahre nach der Geburt des schottischen Klonschafs Dolly, glückte ihm das genetische Kopieren einer Kuh. Dieses Verfahren hat er bei Rindern und Schweinen zur Routine geführt. Missbildungen und Totgeburten gibt es trotzdem, wie bei allen Klonforschern. Aber er trickst herum und wird besser. "Ich sage meinen Kollegen immer, sie müssen ganz frische Eier nehmen." Vor drei Jahren schlug ihm eine koreanische Nierenspezialistin vor, er solle auch mit menschlichen Zellen arbeiten. Er ließ sich überzeugen.
So geht es heute hinter der Glastür zu seinem Labortrakt links in die tierische Abteilung, rechts in die menschliche. Technisch passiert in beiden ungefähr das Gleiche. Doch die Sicherheits- und Hygienebestimmungen unterscheiden sich drastisch. Darum darf das Labor für menschliche Stammzellen nur durch eine dicke Glasscheibe besichtigt werden.
Dahinter errang Hwang vor einigen Monaten seinen größten Triumph, der durch die wissenschaftliche Publikation jetzt bekannt geworden ist. Gleich von elf Patienten konnten Klonembryonen erzeugt und daraus genetisch passende Stammzellen gewonnen werden.
Ins Tierlabor führt der Weg durch eine Luftdusche, die noch die letzten Staubpartikel vom vorgeschriebenen Overall pusten soll. Was nach der Schleuse folgt, strapaziert einen mitteleuropäischen Magen: In Plastikbechern liegen Dutzende blutige Bälle von der Größe eines Augapfels - Eierstöcke von Schweinen, die aus Schlachthöfen angeliefert werden. Im Akkordtempo greifen zehn Laboranten in die Becher, setzen Spritzen an und ziehen eine gelbliche Flüssigkeit heraus, in der die begehrten Eizellen schwimmen. Eine Laborreihe weiter werden die Eier isoliert, kommen in Petrischalen.
Nächste Station: ein abgedunkelter Nachbarraum. Hier wird es kritisch. Unter dem Mikroskop schiebt eine junge Koreanerin eine Eizelle in Position. Dann quetscht sie diese leicht, und auf dem Monitor über ihr quillt aus dem dunklen Fleck zäh etwas heraus - der Zellkern. "In anderen Labors wird er herausgesaugt", sagt Hwangs Assistenzprofessor Lee Chang-Kyu. "Aber dabei leidet die Zelle. Wir drücken sie nur vorsichtig. Das geht zudem viel schneller." Keine zehn Sekunden dauert die Entkernung. Etwa 1400 tierische Eizellen gehen so durchs Labor - pro Tag, sieben Tage die Woche. Klonen im industriellen Maßstab.
Auf der nächsten Laborbank
werden die leeren Eizellen wieder aufgefüllt. Wie an einer Perlenschnur liegen kleine Körperzellen von einem Schwein in einer durchsichtigen Pipette. Wieder dauert es nur Sekunden, bis eine der Zellen in eine leere Eihülle gerutscht ist. Dann wird kurz eine elektrische Spannung angelegt. Die Körperzelle verschmilzt mit dem Ei, und fertig ist ein Klonembryo.
Nicht jeder "geht an" und beginnt sich zu teilen. Aber Hwang Woo-Suks Labor erzielt Traumquoten im Vergleich zur Konkurrenz. "Wie viel mal besser sind wir geworden seit letztem Jahr?", fragt er seinen Assistenzprofessor. "Siebzehnmal!" Die Antwort kommt mit einem ehrerbietigen Nicken. "Ja", sagt Hwang wie zu sich selbst. "Siebzehnmal." Natürlich hat er das gewusst. Doch scheint es, als brauche er Bestätigung, so fantastisch kommt ihm die Steigerung wohl selbst noch vor. An die 250 Versuche brauchte es noch 2004, um einen künstlichen Embryo bis zur Bildung von Stammzellen durchzubringen. Inzwischen sind es kaum mehr als zehn, und über sein Gesicht huscht ein verträumtes Lächeln. Doch gleich verbietet er es sich, den Triumph auszukosten. "Wir wollen unser Wissen mit allen teilen. Ich will hier in Seoul auch eine Weltstammzellenbank aufbauen. Die Verfahren sind ja veröffentlicht, und jede Forschergruppe kann mitmachen", sagt er. "Jede seriöse Gruppe zumindest."
Vor vier Jahren hätten ihm die "Raëlianer" angeboten, für sie zu arbeiten. Die Sekte um einen französischen Ex-Sportreporter, der sich jetzt "Raël" nennt und "Heiligkeit" und als Botschafter Außerirdischer auftritt, behauptet, schon ein Dutzend Menschenkinder geklont zu haben. Hwang schüttelt verächtlich den Kopf. Kein Wort glaubt er denen. Aber könnte er nicht mit ihnen in einen Topf geworfen werden? "Reproduktives Klonen sollte man weltweit verbieten. Wir wollen doch keine Menschen züchten!", sagt er energisch. Der Gedanke, seine Arbeit könnte Horrorvisionen von Klonarmeen oder Ersatzteillagern aus Fleisch und Blut bestätigen, scheint ihn zu quälen. Als "reiner Forscher, nicht einmal als Geschäftsmann" wolle er in der Erinnerung der Menschen bleiben, sagt Hwang mit so unschuldigem Blick, dass man es ihm glauben möchte. Das Geld, das er mit akademischen Auszeichnungen gewonnen hat, steckte er jedenfalls gleich wieder in seine Labors. "Ich verdiene gut, aber ich bin nicht reich", sagt er. "Nicht mal ein eigenes Haus habe ich, nur eine Mietwohnung." Oft braucht er nicht einmal die, weil er über Nacht im Büro bleibt. "Ich möchte einfach nur von morgens früh bis spät in die Nacht forschen. Jeden Tag!"
Und seine Familie? 1979 hat er geheiratet. Doch seine Frau sieht er kaum. Urlaub hat er mit ihr noch nie gemacht. "Kein einziges Mal", sagt er und klingt traurig. "Meine beiden Söhne haben mich nie gemocht, weil ich ihnen kein guter Vater war." Dann hellt sich seine Miene wieder auf. Die beiden, 24 und 26 Jahre alt, studieren in Amerika. Und nach dem weltweiten Rummel um seine Erfolge hätten sie ihn gleich angerufen und ihm gesagt, wie stolz sie auf ihn seien. Er strahlt, so gut hat ihm das getan. Und ist das denn kein Grund, mit Volldampf weiterzuarbeiten? Die Energie dafür, erklärt er ein bisschen pathetisch, schenkten ihm der Himmel und das koreanische Volk. "Befreundete Kollegen aus dem Ausland haben mir mal gesagt, ich sei ein Workaholic und sollte mich behandeln lassen." Hwang Woo-Suk kichert. "Na gut", sagt er und reißt seine Mandelaugen auf, "vielleicht gibt es dafür demnächst ja auch eine Stammzelltherapie." Und dann biegt er sich vor Lachen.