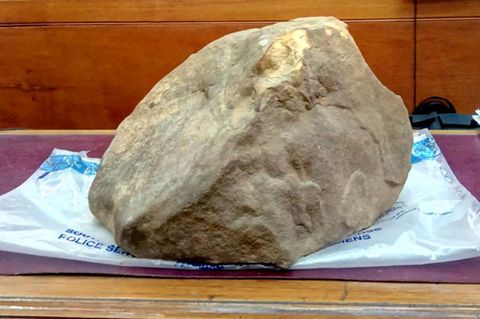Philippolis ist ein kleines Dorf im Herzen Südafrikas. Ein paar Dutzend Holzhäuser inmitten endloser Weiden, wenige Straßen, eine alte Kirche. Darüber spannt sich ein blauer Himmel über den gemächlich ein paar Wolken ziehen. Es ist ein idyllischer Flecken, an dem man den Tag gerne mit einem Bier ausklingen lässt.
Zumindest wenn man Weißer ist. Als Schwarzer hat man zur Kneipe keinen Zutritt.
Südafrika im Jahre 15 nach Ende der Apartheid. Ein Land ohne Rassengrenzen: Die Verfassung verbietet jede Diskriminierung wegen Hautfarbe, Religion oder sexueller Orientierung. Eine Regenbogennation eben, wie sie Erzbischof Desmond Tutu einmal euphorisch nannte - theoretisch. Praktisch leben schwarz und weiß, farbig und indisch häufig in sehr verschienen Welten. Und es sind besonders die Buren, unter denen sich noch manch ewig Gestrige finden, die sich mit der neuen Ordnung nur schwer anfreunden können.
Die "Afrikaaner" haben eine sehr eigene Identität
Es ist eine komplizierte Geschichte mit den Buren. Vielen erscheinen sie schlicht als Nachfahren der ersten holländischen Siedler, gleichzusetzen mit den englischen Siedlern. Und doch haben die "Afrikaaner", wie sie sich selbst nennen, eine sehr eigene Identität: Gottesfürchtig, mit eigener Sprache, dem "Afrikaans", einer Mischung aus Holländisch und einheimischen Wörtern. Und eigenen Traditionen, mit denen sie sich nicht nur von der schwarzen Bevölkerungsmehrheit, sondern auch von den englisch-stämmigen Siedlern abgrenzen.
Der Free State im Zentrum Südafrikas ist ihr Stammland. Und mitten darin liegt Philippolis, gegründet 1822 - das älteste Dorf der ganzen Provinz.
Mitglied wird nur, wer weiß ist
Natürlich ist es auch hier verboten, in Geschäften, Hotels oder eben auch Kneipen jemanden aufgrund der Hautfarbe zu diskriminieren, doch der Besitzer des "Workshop" nahe der einzigen Tankstelle des Ortes hat einen Trick. In die schummrige Kneipe dürfen "Members only". Und wenn man ihn fragt, wie man denn Mitglied werden könne, zeigt er schlicht auf seinen weißen Arm und sagt: "Du bist automatisch Mitglied."
Natürlich ist kein einziger Schwarzer im "Workshop" zu sehen. An der Wand hängt die orange-weiß-blaue Flagge des Apartheids-Südafrika, daneben das Banner der rechtsradikalen "Afrikaner Widerstandsbewegung" (AWB): eine Nachahmung der Flagge des Dritten Reiches, nur mit einem drei- statt viergliedrigen Hakenkreuz. Erst neulich hat AWB-Präsident Eugene Terre Blanche in einer Versammlung wissen lassen: "Der Afrikaner ist genetisch programmiert zur Zerstörung. Alles, was er berührt, zerstört er."
"Die Schwarzen können das Land nicht führen"
An der Theke sitzen ein paar Farmer, und wenn man selbst ein Bier bestellt und mit den Männern redet, wirken sie zunächst alles andere als unfreundlich - bis das Gespräch aufs Politische kommt. "Wir mischen uns nicht", heißt es dann. "Die alten Zeiten waren besser. Getrennt war besser." Oder auch: "Die Schwarzen sind einfach nicht in der Lage, das Land zu führen. Das liegt an deren Kultur. Die Städte, die Straßen, die Schule, alles wird immer schlechter."
Lesen Sie auf der nächsten Seite: Die Buren waren nicht immer die Ewiggestrigen und landeten unter der britischer Herrschaft im Konzentrationslager
Die seltsame Geschichte der Buren
So fremd das alles im Jahre 2009 klingt, so seltsam ist die gesamte Geschichte der Buren hier am Kap. Denn früher waren sie einmal das Gegenteil der Ewiggestrigen: Mit Jan van Riebeek haben sie sogar den wohl bekanntesten Pionier Südafrikas in ihren Reihen. Am 6. April 1652 landete van Riebeek in der Nähe des Kaps der Guten Hoffnung, um eine Siedlung zur Versorgung passierender Schiffe zu errichten: das spätere Kapstadt. Das Datum galt zu Apartheids-Zeiten als Gründungsdatum des modernen Südafrika.
Die Herrschaft der Holländer am Kap währte jedoch nur bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Von den Briten besiegt, machten sich zahlreiche Buren schließlich Mitte des 19. Jahrhunderts im "Großen Treck" mit Planwagen auf ins Landesinnere. Noch heute werden die "Voortrekker" als mythische Gestalten verehrt, die Hitze, Trockenheit und Überfällen einheimischer Stämme trotzend schließlich die Ebenen Zentral-Südafrikas erreichten. Dort ließen sie sich nieder - in Dörfern wie Phillippolis.
Als die Buren die Unterdrückten waren
Und ebenso wenig hatten die Buren zu allen Zeiten das schlechte Image der Unterdrücker. Während des Burenkriegs 1899-1902 galten sie sogar selbst als die Unterdrückten: Schließlich verweigerten die Briten ihnen einen eigenen Staat. Außerdem inhaftierten die Engländer die Familien der burischen Kämpfer in den ersten sogenannten "Konzentrationslagern". Bis heute ist diese grausame Behandlung für manche Buren ein Grund, englisch-stämmigen Südafrikanern nicht über den Weg zu trauen.
Dieses Opfer-Image verblasste aber spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg. 1948 kam die burische "National Party" an die Macht und schuf unter ihrem Premierminister Hendrik Frensch Verwoerd das rassistische Gesellschaftssystem der Apartheid: die Trennung der Wohnviertel, das Verbot gemischtrassiger Ehen, der Entzug des Wahlrechts für Schwarze, die Schaffung von Homelands. 1994 endete die Apartheid, doch in Philippolis scheint es, dass manche Bewohner noch nicht in der neuen Zeit angekommen sind.
Eine Schule wie zu Zeiten der Voortrekker
Manches dabei wirkt wie ein Rückzugsgefecht. So lassen einige weiße Farmer ihre Kinder nun privat unterrichten: in einer Art Hausschule, wie zu Zeiten der Voortrekker. Dazu hat die rüstige Becky Cilliers eine kleine Hütte im Garten ihres Hauses zum Klassenzimmer umgebaut. Einst war Cilliers, eine gottesfürchtige 65-Jährige, selbst Lehrerin. Jetzt ist sie aus dem Ruhestand zurückgekehrt, um fünf Kinder aus der Nachbarschaft zwischen Spielzeug, Tafeln und kleinen Stühlen auf den Ernst des Lebens vorzubereiten. "Die Schwarzen und wir, das ist einfach eine andere Kultur. Viele möchten nicht, dass die Kinder zusammen zur Schule gehen", sagt Cilliers.
Natürlich sind nicht alle Buren Rassisten. Natürlich auch nicht in Philippolis. Viele kämpften gegen die Apartheid und landeten dafür sogar im Gefängnis. Und doch sind rechtsradikale Ansichten heute häufiger unter Buren zu finden als unter den englisch-stämmigen Weißen. Sie selbst sehen sich dabei nicht mehr als ausgewanderte Europäer, sondern als ein Volk, dessen Heimat Südafrika ist.
Oder wie sie Jakob Zuma, der Staatspräsident Südafrikas, einmal versöhnlich nannte: der einzige weiße Stamm Afrikas.