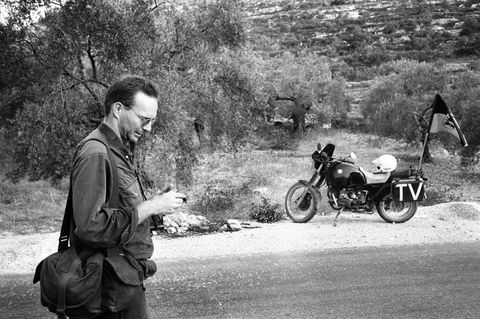Samir hat angerufen: Er sei auf dem Weg zurück nach Bagdad. Er halte es nicht mehr aus in Amman, zu öde und zu teuer sei das geregelte Leben in der jordanischen Hauptstadt. Ausgerechnet Samir Peter, der melancholische Pianist, der uns im Sommer immerfort versichert hatte, er wolle sich umbringen. Jeden Abend seit Kriegsende spielte er im Hotel al-Hamra am Klavier mit Blümchendecke, die Gesichtszüge verwittert, das schulterlange Haar zum Zopf gebunden. Und spätestens, wenn ihn wieder mal ein Gast aufforderte, "Feelings" zu spielen, gab der begnadete Jazzinterpret auf. Wanderte mit der Whiskyflasche unterm Arm durch den Saal, bis er irgendwo Bekannte erblickte, setzte sich und begann Geschichten zu erzählen: wie er im Sommer 2001 aus dem Exil im kalifornischen San Diego zurückgekommen war, nur um ein paar Erbschaftsangelegenheiten zu regeln, dann aber nach dem 11. September kein Visum mehr für die Rückreise erhielt. Woraufhin er begann, in Bagdad Konzerte zu geben und an der Ballett- und Musikschule die Klaviere zu reparieren.
Er war gerade fertig geworden, da kam der Krieg. Und damit beginnt eine von Samirs Lieblingsgeschichten: wie er sich dem US-Panzer vor seinem angeschossenen Haus nahe einer Tigrisbrücke ergab, indem er das einzige weiße Stoffstück griff, das er zur Hand hatte. Er hängte den Slip seiner neben ihm liegenden Freundin aus dem Fenster, in der nicht unberechtigten Annahme, dass dieses Stück Stoff zwar klein, solch ein Signal der Friedfertigkeit aber groß sein würde.
"Ich sollte mich umbringen"
Stunden später machten Hunderte von Plünderern Samirs Werk von anderthalb Jahren zunichte, zertraten die Geigen, zerschlugen die Pianos und stahlen alle Blasinstrumente. Tage später brachte Samir zusammen mit der Ballettlehrerin einen Trupp der radikalschiitischen Messias- Armee davon ab, in der Ballettschule sein neues Hauptquartier aufzuschlagen. Abermals begann er, die Klaviere zu reparieren, führte US-Offiziere und Journalisten durch die Schule. Und stand schließlich, eine Zigarette zwischen den Lippen, inmitten der Trümmer und zuckte mit den Schultern: "Ich sollte mich umbringen."
Sprach's und ging in den leeren Ballettsaal, wo der einzige Steinway-Flügel stand, den die Plünderer nicht zerschlagen hatten. Der Sisyphus von Bagdad zündete sich noch eine Zigarette an - und spielte "What A Wonderful World" von Louis Armstrong, gedankenverloren, mit geschlossenen Augen, und gelegentlich fiel Asche auf die Tasten.
Als Samir Monate später mit dem Reparieren fast fertig war, kam das nächste Inferno: Die Amerikaner hatten die Auszahlungsstelle für entlassene Soldaten und Geheimdienstangehörige neben der Schule eingerichtet. Wochenlang stand die Warteschlange neben dem Schulzaun, bis 2000 Männer am 4. Oktober lapidar gesagt bekamen, dass sie leer ausgingen. Die soldlose Soldateska stürmte darauf die Musiksäle in der irrigen Annahme, hier seien jene Dollarberge verborgen, die ihr gerade vorenthalten würden. Den Wärtern boten sie an, halbe-halbe zu machen, wenn sie ihnen nur die Geldverstecke verrieten. "In den schwarzen Kisten", brüllte einer von ihnen. Daraufhin stürzten die Horden sich auf die Klaviere und Flügel, brachen die Böden auf, rissen die Tasten heraus und ruinierten zum zweiten Mal, was Samir Peter gerade wieder instand gesetzt hatte. Frustriert, doch keine Dollar in den komischen schwarzen Holzkisten gefunden zu haben, legten die Plünderer schließlich Feuer und verschwanden.
Mit Wasser aus der Toilette vorm Verbrennen gerettet
Samir hatte genug von Bagdad, ging nach Amman. Um nun, als die Ballettschule feierlich wieder eröffnet wird, seine Rückkehr anzukündigen. Die Spiegel im Ballettsaal sind mit privaten Spendengeldern aus den USA wieder hergestellt, und am Steinway, den einer der Wächter mit Wasser aus der Toilette vorm Verbrennen gerettet hat, spielt Samirs Sohn.
"Wer bringt sein Kind noch zur Ballettschule, wenn Menschen auf offener Straße entführt werden", fragt Thikra Monem, die unerschütterliche Ballettlehrerin, "wenn Benzin ein Vermögen kostet, Taxifahrer Angst vor ihren Fahrgästen haben und die Schule einmal im Halbjahr vom Mob in Trümmer gelegt wird?" Sieben Familien tun es, die Eltern ihrer kleinen Meisterschülerinnen, die an diesem Wintermorgen vor dem Kulturminister und großem Publikum eine Polonaise von Chopin und den Zug der Zwerge von Edvard Grieg tanzen.
Denn das ist Bagdad, diese Stadt der Abendnachrichten, in der Iraker mit Panzerfäusten auf US-Konvois schießen, amerikanische Soldaten sich mit dem Finger am Abzug des Maschinengewehrs durch den ewigen Stau quälen und Selbstmordattentäter sich auf Botschaften und Polizeistationen stürzen. Und das ist Bagdad, diese Stadt der über fünf Millionen Menschen, die sich in die neue Zeit tasten. Denen funktionierende Telefone und Stromversorgung wichtiger wären als diese seltsame Einrichtung namens Demokratie. Die in ein und derselben Familie der Tochter eines abgetauchten Baath-Gouverneurs Unterschlupf bieten, den Amerikanern Truthähne für Thanksgiving verkaufen und ihren Hund Abed getauft haben, nach dem obersten Leibwächter Saddam Husseins. Denn der Hund läuft immer hinter seinem Herrchen her wie einst Abed Hamid hinter Saddam.
Witze über Saddam
Die sich Witze über Saddam erzählen und gleichzeitig dessen Geister fürchten: Als Polizisten vor zwei Monaten mitten in einem der Slums einen goldschimmernden Rolls-Royce aus dem Fuhrpark von Saddams Sohn Uday beschlagnahmten, verfügte der Polizeichef, dass fortan jeder seiner Untergebenen ihn als Hochzeitskarosse nutzen dürfe. Aber keiner der Polizisten will mitmachen. "Ein böser Fluch, Udays Geist wohnt darin", beteuert ein Kommissar, der in den kommenden Tagen heiraten will, aber ohne Karosse. Die Idee muss besser beworben werden, findet Polizeioberst Raed und stellt sich freiwillig als Bräutigam für eine Show-Heirat samt silberner Kalaschnikow aus dem Arsenal Udays zur Verfügung.
Ungerührt vom Widerhall des Krieges aber finden sich die Menschen am Wochenende in den kleinen Restaurants am Tigris ein zur Bagdader Spezialität Masgouf, am offenem Feuer gegrilltem Karpfen. Und betreiben heiteres Detonationsraten: Fehlzündung eines Autos? Mörserattacke der Saddam-Anhänger? Selbstmordanschlag? Bombardement der Amerikaner? Der trockene, harte Klang weist eher auf Bombardements hin, kurze, bellende Explosionen auf Mörserbeschuss, dumpfes Wummern auf Bombenanschläge.
Aber auch die Detonationen sind zuerst langweilig, dann lästig geworden, und so widmen sich die Ausflügler bald wieder dem Lieblingsthema: ob es unter Saddam besser gewesen sei. Ja, sagt der arbeitslose Armeeoffizier. Nein, sagt seine Frau, die überglücklich ihren ersten Fernseher mit 34er-Bild erstanden hat, der mangels Zöllen und Steuern erschwinglich geworden ist. Ja, sagt die Tochter, die sich abends nicht mehr auf die Straße traut. Nein, sagt der Sohn, der die Nachmittage im neu eröffneten Internetcafé verbringt. Bis der Kellner den würzig gegrillten Karpfen bringt und alles Reden übergeht in geräuschvolles Kauen.
Eine Stadt ohne Elan
Bagdad ist eine Stadt ohne Mitte. Die eigentliche Innenstadt ist eher ein Slum und nach Einbruch der Dunkelheit lebensgefährlich. Das Leben findet verteilt über ein Dutzend Viertel entlang des mäandernden Tigris statt, wo es immer noch Palmen, Zitronenbäume, Gärten zwischen den Häusern gibt. Drei Kriege, 13 Jahre Embargo, die Abwanderung und Flucht Zigtausender haben den natürlichen Elan der Stadt erstickt: ein halbes Dutzend Schwimmbäder für mehr als fünf Millionen Einwohner, keine Bar außerhalb der großen Hotels, keine Hochhäuser, die jünger wären als 20 Jahre. Fast nichts hat sich geändert, seit Mitte der achtziger Jahre der Iran-Krieg den Anbeginn der Agonie markierte und die Zeit stillstehen ließ. In den Hotels und Clubs gibt‘s noch die Cocktailsessel aus den sechziger Jahren, hängen grellorange Lampen von den Decken, die in den Siebzigern schick waren.
Seit Jahrzenten ist Bagdad nicht mehr die moderne Kapitale eines reichen Staates und seit Jahrhunderten nicht mehr das Epizentrum des Geistes, wo Philosophen und Theologen einst um das Verhältnis von Vernunft und Glauben stritten. Nur eines ist Bagdad wieder, seit dem April vergangenen Jahres: die Stadt der Geschichten. Nicht der erfundenen, wie sie Scheherazade in Tausendundeiner Nacht ihrem Herscher erzählte, um ihr Leben zu retten. Sondern der echten. Bagdad ist die Stadt einer grotesken Gegenwart, Schauplatz des Absurden, Tragischen, Komischen. Und es ist die Stadt des Grauens aus der Vergangenheit, das nun endlich erzählt werden kann.
Wie die Blues Brothers sitzen Faris und Chalid hinter ihren Sonnenbrillen im Auto und rollen durch die Stadt - zum ersten Mal, seit sie vor zehn Jahren ins Exil gingen. Sie waren beide Armeemaler, überlebten zwei Kriege, indem sie Generäle porträtierten oder aus dem Gedächtnis Aktbilder für deren Schlafzimmer malten. Und, künstlerische Pflicht am Vaterland, sie pinselten Saddams in Serie: in Uniform, in Kurdentracht, in arabischer Dischdascha, als Nebukadnezar. Manchmal, erzählt Faris, grundierten sie den Diktator erst als Monster und übermalten ihn später in den klassischen Zügen des gütig lächelnden Paten. Bis sie es nicht mehr aushielten und flohen, der eine nach Deutschland, der andere nach Jordanien.
Ohne Grund verhaftet und gefoltert
Ohne Grund war Faris zuvor verhaftet und gefoltert worden, saß mit verbundenen Augen im Gefängnis. Sehen konnte er nichts, aber hören. Eine Stimme, die lachte. Eine Stimme, die er kannte. Die eines seiner besten Freunde. Er hatte dieses Lachen gemocht. Nun war es der Auftakt zur Hölle. "Wie geht es dir?", fragte die Stimme. Faris schöpfte Hoffnung und erwiderte: nicht so gut. "Warum denn?", fragte die Stimme, die so vertraut war. Weil sie mich geschlagen haben, sagte Faris. "Was wagst du", brüllte die Stimme mit sadistischer Lust. Es hagelte Schläge, "du wagst zu behaupten, hier würden Menschen geschlagen", brüllte die Stimme zwischen den Schlägen.
Faris hat es nie vergessen. Die Augen hinter der Sonnenbrille, steuert er den BMW über Bagdads Stadtautobahnen, kennt noch die kaum beschilderten Abfahrten - und steht doch immer wieder vor haushohen Betonwällen. Wie Waldpilze aus feuchtem Herbstboden wachsen die Barrikaden aus Bagdads Boden: erst vor den Quartieren der US-Truppen, den Botschaften und großen Hotels, dann auch vor den Banken, vor Brücken, vor Polizeistationen, tausend kleine Berliner Mauern kreuz und quer durch die Stadt.
"Was ist aus unserem Bagdad geworden?", fragt sich Faris, "was aus unseren Freunden?" Anrufen kann man kaum, und schon eine Stadtrundfahrt erfordert Expeditionsvorbereitungen: Zum einen strangulieren die Betonbarrikaden den Verkehr, den zum anderen die mehreren hunderttausend nach dem Krieg zollfrei ins Land gekommenen Autos endgültig lahm gelegt haben. Und leeren sich die Straßen mal, dann, weil es kein Benzin mehr gibt. Die türkischen Tanklastzüge, die Benzin aus dem erdölarmen Nachbarland in den Irak bringen, wurden so oft beschossen, dass sich nun die Fahrer weigern zu kommen. Da zugleich aber die anhaltenden Anschläge die irakische Produktion weiterhin blockieren, gibt es im Staat mit den zweitgrößten Erdölvorkommen der Welt kaum Benzin.
Die Amerikaner bekämpfen mit Leidenschaft die freie Marktwirtschaft
So werden die Schlangen vor den Tankstellen immer länger. Die Amerikaner bekämpfen mit Leidenschaft die freie Marktwirtschaft, indem sie ausgerechnet den Schwarzhandel mit Benzin verboten und die Schwarzhändler reihenweise ins Gefängnis geworfen haben. Die Preise steigen: auf bald 500 Dinar pro Liter, umgerechnet 25 Cent. Für deutsche Autofahrer käme das immer noch dem Paradies nahe. Verglichen mit dem offiziellen Preis von 20 Dinar pro Liter entspricht es jedoch einer Profitmarge, für die sich jeder in die Schlange stellt, der keinen besseren Job hat.
Die Amerikaner versuchen, in der Tradition sozialistischer Planwirtschaft zu bestimmen, wer wie viel Benzin zu welchem Preis kauft. Ihnen gegenüber steht der Kapitalismus in Form Tausender Iraker vom Benzinstrich. Mit wippenden Gummischläuchen warten sie an der Straße und wuchten auf Nachfrage und gegen Bargeld die Kanister aus dem Kofferraum. Da die Amerikaner nicht das Herumfahren mit vollem Tank unter Strafe stellen können, kämpfen sie auf verlorenem Posten. Kurz vor Silvester kommt das Optionsgeschäft auf: Wer anderthalb Tage angestanden und es bis in Sichtweite der Zapfsäulen geschafft hat, verkauft seinen Platz in der Schlange.
Die Amerikaner starten ihre nächste Offensive im Großen Vaterländischen Benzinkrieg. Mit Panzern fahren sie an den Tankstellen auf, drohen Schwarzhändlern zehn Jahre Gefängnis an und verfügen: An einem Tag sind nur Autos mit geraden Nummernschildern benzinberechtigt, am nächsten nur solche mit ungeradem Kennzeichen.
Sergeant Huckenberry hat sich den Kampf für die Freiheit anders vorgestellt
Irgendwie hatte sich Sergeant Huckenberry seinen Kampf für die Freiheit im Irak anders vorgestellt. Jedenfalls schaut er traurig aus, als er mit drei Humvees und acht Soldaten in voller Kampfmontur anrückt zum Tankstelleneinsatz: Ein Autofahrer mit ungeradem Nummernschild hat sich in die Schlange geschmuggelt und argumentiert lauthals, sich ja bereits gestern angestellt zu haben, als seine Nummer noch an der Reihe war. Fluchend schiebt er sein Gefährt wieder auf die Straße, wild brüllen alle durcheinander, beschweren sich erst über das Warten, dann über die Stromausfälle, die Kriminalität, das Chaos, ach, alles. Nur darauf, dass es im Grunde vollkommen absurd ist, für Benzin zehnmal weniger als für Trinkwasser zu bezahlen - darauf kommt niemand.
Es ist die Prägung der Diktatur, und wer erfahren will, wie sie die Menschen geformt hat, muss sich bloß in die Hölle des Bagdader Straßenverkehrs begeben: Staut sich an einer Stelle der Verkehr, biegt jedes Auto schonungslos auf die Spur des Gegenverkehrs; fährt ein Auto auf die Kreuzung, fährt auch das entgegenkommende und das abbiegende, einfach jedes Auto auf die Kreuzung. Als ginge es um den Eintrag ins Guinnessbuch der Rekorde, schaffen es fünf Autos, den gesamten Verkehr für eine halbe Stunde zu blockieren, weil sich alle erst mal streiten, wer jetzt weiterfahren darf. Ohne dass noch irgendwer weiterfahren könnte, weil sie hoffnungslos ineinander verkeilt sind.
Es ist der Egoismus des Zentimeters, ohne jeden Gedanken ans allgemeine Fortkommen sich noch in die letzte Lücke zu pressen und am Ende selbst lahm zu legen. Aber so weit denkt keiner, so weit kann auch keiner denken, denn wer nicht selbst in die letzte Lücke fährt und auf die Kreuzung drängelt, wird erbarmungslos überholt und abgedrängt. Ein Sog der Unvernunft, dem sich keiner entziehen kann.
Wie ein obskures Sportereignis
Als wieder mal ein Jeep der US-Army in Flammen aufgeht, stehen die Passanten neugierig bis amüsiert am Straßenrand. Die meisten Bagdadis sind Zuschauer des Dramas vor ihrer Haustür, betrachten die Gegenwart, die ihre Zukunft entscheiden wird, wie ein obskures Sportereignis. Das man ausgiebig kommentiert, ohne einzugreifen. Lieber fordert man, was sich zwei von drei Bagdadis wünschen: einen neuen Diktator. Nicht so einen bösen wie Saddam. Einen guten Diktator.
Früher war vieles geordnet, das meiste verboten und alles klar. Jetzt fühlen sich die Bagdadis wie ein Einsiedlerkrebs, dem man das Schneckenhaus abgezogen hat, und mangels anderer Orientierung besinnen sich viele auf ihren Clan, ihren Stamm, ihren Glauben. "Sunniten sind Ungläubige", raunt es im Schiitenviertel Kadhimiya, "Schiiten schlafen mit ihren Schwestern", wispert es im Sunnitenviertel Adhamiya. Verloren geht, wie leicht die Glaubensfrage bislang wog.
Im Viertel Karada heißt eine Moschee "Jesus, Sohn von Maria", umgekehrt gingen noch zum letzten Weihnachtfest auch Schiiten in die Kirche: "Ich liebe Weihrauch, diese ganze Feierlichkeit", erklärt die 50-jährige Samira, die sogar einen Weihnachtsbaum in ihrer Wohnung dekoriert hat. Während andererseits der sunnitische Hochzeitskleidverleiher Sabah al-Janabi den eigentlich schiitischen Brauch der Zeitehe pflegt, um seinen wechselnden Freundinnen wenigstens einen Anstrich von Legitimität zu geben - und dazu sogar unlängst eine Christin überredete, was seine Verwandtschaft empörte.
Verwickelt in die Dramen des Clans
Sein Neffe Omar wiederum hat kaum noch Zeit für seinen Computerladen, weil er nun andauernd in die Dramen seines ganzen Clans verwickelt wird: Endlos verspätet kommt er zum vereinbarten Treffen, "weil ich noch meinen Cousin besuchen musste, der von einem Autofahrer angefahren worden ist. Und dann musste ich noch meinen anderen Cousin bei der Polizei anrufen, den Duleimi wieder aus dem Knast zu holen." Denn als der Angefahrene mit zerschmettertem Bein auf der Straße lag, hatte der Fahrer Reißaus genommen. Ein Mann vom Stamme der Duleimi aus Falludscha, die sich in den vergangenen Monaten vor allem als Straßenräuber hervorgetan haben, nahm im Auto die Verfolgung auf und versuchte, den Fliehenden zum Halten zu bringen. Ohne Erfolg. Also begann er mit seiner Kalaschnikow, die er gar nicht dabeihaben dürfte, auf den Kofferraum des Wagens zu schießen. Endlich hielt der Fahrer an, die Polizei kam - und verhaftete routinemäßig erst einmal den Duleimi. Nach großer Debatte einer binnen Minuten angewachsenen Menschentraube nahmen die Polizisten einfach beide Männer mit. Woraufhin Omars Cousin bei der Polizei die Freilassung des Wohltäters organisierte.
Eigentlich will er uns zwei Tage später die ganze Geschichte en Detail erzählen. Aber dann ist er plötzlich verschwunden, fortgerissen von der nächsten Geschichte: Einem weiteren Cousin bei der Polizei ist sein Dienstauto gestohlen worden. Genaugenommen hatte er den brandneuen Nissan-Pickup lieber zu Hause gelassen, damit er keinen Schaden nehme, und war mit dem eigenen Auto zum Dienst gefahren. Sein Bruder nutzte den Nissan deshalb für einen Ausflug aufs Land. Er nahm einen Anhalter mit, der ihm Minuten später eine Kalaschnikow unter die Nase hielt und um die Herausgabe des Zündschlüssels bat. Nun ist ein halbes Dutzend Cousins mitgekommen ins Dorf, das gekidnappte Polizeiauto zu suchen.
Während Omar nun doch noch die Geschichte in der Geschichte erzählt, ist es dunkel geworden. Als der Strom ausfällt, sitzen wir im Finstern, und nur die riesige Gasflamme der Raffinerie im westlichen Stadtteil Dora wirft ihren zuckenden Feuerschein über die Stadt. Etwas später wird die US-Luftwaffe in Dora zum wiederholten Mal dort ausgemachte Widerstandsnester bombardieren. Es klirren die Scheiben, der Kellner lacht, und die Salven aus den Bordkanonen der Kampfflugzeuge klingen, als würde jemand am Himmel Schränke rücken.
Alltag in Bagdad. Samir Peter, der melancholische Pianist, ist doch noch nicht zurückgekommen.