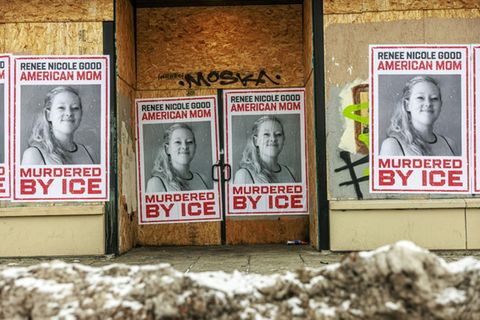Pim Fortuyn hatte sich als "Hecht im Karpfenteich" der niederländischen Politik einen Namen gemacht. Mit Kritik an der traditionellen Politik des Establishments in Den Haag wusste er zunehmende Wählermengen anzuziehen. Alle Umfragen deuteten darauf hin, dass er nach den Parlamentswahlen vom 15. Mai 2002 eine bedeutende Rolle bei der Regierungspolitik hätte spielen können.
Fortuyn, der 54 Jahre alt wurde, hatte jahrelang als Journalist eher rechte Positionen vertreten und daneben reiche Niederländer beraten. Er rühmte sich, über ausreichend Geld zu verfügen. Aber der Daimler-Fahrer mit eigenem Chauffeur trat erst 2001 aktiv in der Politik des Landes in Erscheinung. Dabei fand er bei der neu entstandenen Bewegung "Leefbaar Nederland" ("Lebenswerte Niederlande") eine Heimat. Er wurde deren Spitzenkandidat.
Die bis dahin in den Niederlanden einzigartige Organisation kritisierte die regierenden Parteien in Den Haag. Sie warf dem politischen Establishment vor allem vor, sich zu wenig an den Wünschen der Bürger zu orientieren.
"Der größte Einfluss des Phänomens Fortuyn lag darin, dass er viele Dinge ins Rampenlicht der Öffentlichkeit gerückt hatte, die bislang verschwiegen wurden. Was vor kurzem noch als politisch inkorrekt galt, wurde plötzlich ganz offen erörtert", erklärt Peter Groot, Professor für Sprachwissenschaften an der Universität Utrecht.
Latenter Rassismus
Offensichtlich war es dem Rechtsextremisten gelungen, den latenten Rassismus in der niederländischen Gesellschaft an die Oberfläche zu befördern. Zugleich war er mit seinen Klagen über mangelhafte öffentliche Dienstleistungen, korrupte Geschäftspraktiken und schlechte Arbeitsmoral auf viel Zustimmung gestoßen.
Fortuyns Erfolg reihte sich ein in das Wiedererstarken rechtsextremistischer Parteien in mehreren europäischen Ländern, doch hatte man solche Strömungen in den als so liberal geltenden Niederlanden bislang weniger erwartet.
Sie waren das erste Land, dass die Eheschließung von Homosexuellen ebenso billigte wie eine geregelte Prostitution, eine aktive Sterbehilfe und den Verkauf weicher Drogen in so genannten Coffee Shops. Doch die viel gepriesene Toleranz war offenbar nicht sehr weit entwickelt in Gegenden mit einer hohen Einwandererquote. Etwa zwei Millionen der 16 Millionen Niederländer stammen aus anderen Teilen der Welt, etwa 800.000 von ihnen sind Muslime.
"Wir werden den Vertrag von Schengen aufkündigen"
Als Fortuyn aber den Islam heftig attackierte und ohne Rücksprache mit der Parteiführung allzu extreme Positionen vertrat, trennte sich die Bewegung von ihrem Spitzenkandidaten. "Wir werden den Vertrag von Schengen aufkündigen und den Flüchtlingsvertrag", hatte Fortuyn öffentlich angekündigt.
"Es gab schon immer einen unterschwelligen Rassismus im Lande", erklärt der Sozialhistoriker Han van der Horst. "Die Toleranzschwelle gegenüber den Muslimen ist sehr niedrig", bestätigt auch Rita Schriemer vom Rotterdamer Komitee gegen Diskriminierung. Fortuyn schien eine klare Antwort zu haben: "Die Niederlande sind voll."
Immer öfter erklärte er, dass er der künftige Regierungschef der Niederlande sein werde. Dann werde er die Dinge neu ordnen. Dazu gehörten vor allem das Gesundheitssystem, das Schulwesen und die Vorkehrungen zur besseren Sicherheit der Bürger. Als der glatzköpfige Politiker eine eigene Liste Pim Fortuyn schuf, hatte er auf Anhieb großen Erfolg.
Verblüffende Erfolge
Bei den Kommunalwahlen im März 2002 verblüfften Erfolge seiner Liste in einigen Städten. Allein in der früheren sozialdemokratischen Hochburg Rotterdam eroberte sie mehr als 34 Prozent der Stimmen und wurde stärkste Partei. Sein Bekenntnis zur Homosexualität schadete ihm bei den Wählern kaum. Auch das auffällige Auftreten des elegant gekleideten Politikers mit griffigen und gemessen vorgetragenen Slogans machte ihn populär.
Pressestimmen vom 7. Mai 2002
"El País" (Madrid) "Die Politik der Niederlande hat seit dem Attentat aufgehört, eine Oase der Ruhe und des Konsens zu sein. Der Mord bedeutet - ganz unabhängig von den Motiven des Täters - eine schwere Bedrohung für das niederländische Modell. Er versetzte das Land, dessen Politik der Parteienpakte wie ein Uhrwerk funktioniert hatte, in einen Schockzustand.
"The Times" (London)
Die konservative britische Zeitung "The Times" schrieb: "Ein Mord tötet nur selten eine Idee. Pim Fortuyn wird nun in den Augen jener, die seine Sorge hinsichtlich der Einwanderung in ein bereits überbevölkertes Land teilten, ein Märtyrer werden. Fortuyns Mörder haben die niederländische Toleranz, Lockerheit und gesittete Diskussion getötet. Sie werfen einen Schatten auf ganz Europa."
"Algemeen Dagblad" (Den Haag)
"Ein Mann wie Fortuyn hat ein solches Schicksal absolut nicht verdient. Er führte einen scharfen und in mancher Hinsicht auch umstrittenen Wahlkampf mit dem erklärten Ziel, Ministerpräsident zu werden. Der Anhang, den Fortuyn für seine Vorstellungen gewann, ist gewachsen, aber unter seinen Gegnern nahm auch der Widerstand gegen seine Standpunkte zu. Er führte die politische Debatte auf der Grundlage von Argumenten. Kugeln haben dem nun ein Ende bereitet.
"La Repubblica" (Rom)
"Pim Fortuyn war weder ein Le Pen noch ein Haider. Er war kein Antisemit und kein Nazi. Er verhöhnte auch nicht das Andenken an den Holocaust. Seine Fremdenfeindlichkeit war nicht vom Geist der Nazis infiziert, und sie war auch nicht durch antisemitische Untertöne vergiftet. Fortuyn wollte die Grenzen schließen, weil ihre islamische Religion die Freiheit der Frauen bedroht, die freie Meinungsäußerung, die Toleranz gegenüber leichten Drogen und die Praxis der Euthanasie, also all das, was dem liberalen Holland lieb und teuer ist."
Insbesondere seine häufig vorgetragene Erklärung "Ich sage, was ich meine und ich tue, was ich sage", brachte ihm viel Sympathie. Damit stand er in deutlichem Gegensatz zu der vorsichtigen, auf Konsens gegründeten vorherrschenden Politik in Den Haag. Diese Praxis der dominierenden Parteien machte nach Fortuyns Ansicht das "politische Geschäft" immer weniger durchschaubar.
Mehr Stoiber als Haider
Fortuyn hatte stets Vergleiche mit anderen Rechtspopulisten wie Jean-Marie Le Pen in Frankreich oder Jörg Haider in Österreich zurückgewiesen. Er stehe allenfalls CSU-Chef Edmund Stoiber nahe. Er teile dessen Auffassungen über die Bedeutung gesellschaftlicher Normen und Werte teile, sagte Fortuyn bei einem der seltener gewordenen Treffen mit Journalisten noch Anfang April 2002.
Bei der Beerdigung traten Züge einer Massenhysterie zu Tage, schrieben die Medien damals. Auf dieser Welle der Popularität wurde die Liste Pim Fortuyn (LPF) auf Anhieb zweitstärkste politische Kraft im Land. Sie rangierte in der Volksvertretung noch vor den viele Jahre lang tonangebenden Sozialdemokraten (PvdA).
Der Mitleids- und Popularitätsfaktor, der die LPF auch ohne ihren charismatischen Anführer hoch gespült hatte, ebbte aber schnell weg. Die mit der Partei gebildete Regierungskoalition unter Führung der Christdemokraten (CDA) zerbrach am Streit in der Fortuyn-Partei. Sein Aufbegehren gegen verkrustete Politik und gegen allzu liberale Ausländerpolitik lebt aber heute in der niederländischen Politik vielfach spürbar fort.
Mörder zu 18 Jahren Haft verurteilt
Fortuyns Mörder war sofort gefasst worden. Der Tierschutzfanatiker Volkert van der Graaf begründete seinen Anschlag mit der Angst, dass der Politiker zu viel Macht erobern und den Schwächsten in der Gesellschaft schaden könnte. Seine Verurteilung zu 18 Jahren Haft ist in der Berufungsinstanz bestätigt worden.