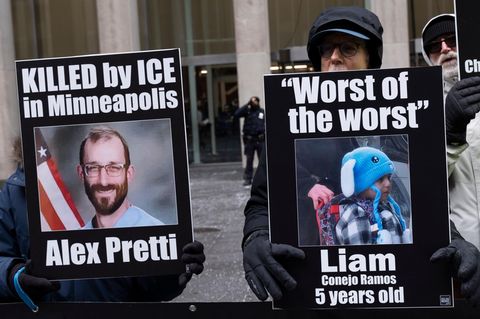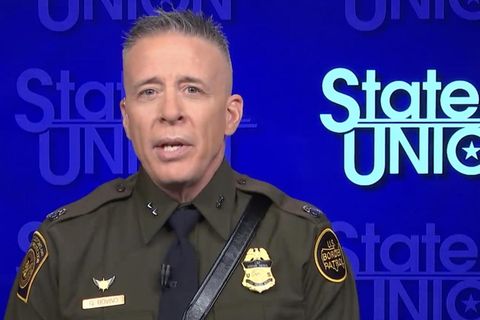Die USA, Frankreich, Großbritannien, Russland und China bilden einen äußerst exklusiven Club im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen: Das Veto-Recht gibt den fünf ständigen Mitgliedern die Möglichkeit, die internationalen Beziehungen in einer Weise zu gestalten, wie es keine andere Regierung kann.
Dabei taucht der Begriff Veto in der Charta der Vereinten Nationen kein einziges Mal auf. Stattdessen heißt es dort: "Beschlüsse des Sicherheitsrats über Verfahrensfragen bedürfen der Zustimmung von neun Mitgliedern. Beschlüsse des Sicherheitsrats über alle sonstigen Fragen bedürfen der Zustimmung von neun Mitgliedern einschließlich sämtlicher ständigen Mitglieder." Diese Formulierung bedeutet, dass bereits die Ablehnung eines einzelnen ständigen Mitglieds einen Beschluss zu Fall bringen kann - möglich ist jedoch die Stimmenthaltung.
Beliebtes Mittel im Kalten Krieg
In der 58-jährigen Geschichte der Vereinten Nationen ist das Vetorecht vor allem im Kalten Krieg zwischen den USA und der Sowjetunion ein beliebtes Mittel gewesen, um unliebsame Resolutionen zu verhindern und befreundete Staaten des eigenen Blocks zu schützen. Die Sowjetunion und danach die Russische Föderation haben das Veto 117 Mal eingesetzt, die USA 73 Mal. Aber während das "Njet" aus Moskau vor allem im Kalten Krieg zu hören war, haben die USA ihr "No" immer häufiger in den letzten Jahren zum Ausdruck gebracht. Seit 1990 hat kein Staat häufiger sein Veto eingelegt als die USA, meistens als Schutz für Israel.
So stoppten die Vereinigten Staaten erst vor drei Monaten eine UN-Resolution, mit der der Tod eines UN-Mitarbeiters durch israelische Truppen und die Zerstörung eines UN-Lebensmittellagers im Westjordanland verurteilt werden sollten. Frankreich hat zum letzten Mal 1976 als einziger Staat ein Veto gegen eine UN-Resolution eingelegt. Damals ging es um die winzige Inselgruppe der Komoren vor der Südostküste Afrikas.
Mindestens neun Ja-Stimmen erforderlich
Bei einer Abstimmung ruft der amtierende Vorsitzende des Sicherheitsrats - ihn stellt zurzeit Guinea - zunächst die Befürworter einer Resolution dazu auf, die Hand zu heben. Dann folgt das Votum der Gegner. Zuletzt werden die Stimmenthaltungen gezählt. Wenn die Entschließung nicht die erforderlichen neun Ja-Stimmen erhält, erklärt der Vorsitzende die Resolution für gescheitert. Dies ist auch dann der Fall, wenn es zwar neun oder mehr Ja-Stimmen gibt, aber auch ein Nein aus dem Kreis der fünf ständigen Mitglieder.
Eine solche Nein-Stimme gilt jedoch nur dann als Veto, wenn es gleichzeitig mindestens neun Ja-Stimmen gibt. Die diplomatischen Bemühungen Frankreichs in der Irak-Politik zielen somit in erster Linie darauf ab, dass nicht mehr als acht Mitglieder eine zweite Irak-Resolution mit der Ermächtigung zu militärischem Handeln befürworten. Denn so könnte Frankreich der gewichtige Schritt eines Vetos erspart bleiben - und damit eine noch weiter gehende Belastung der Beziehungen zu den USA.