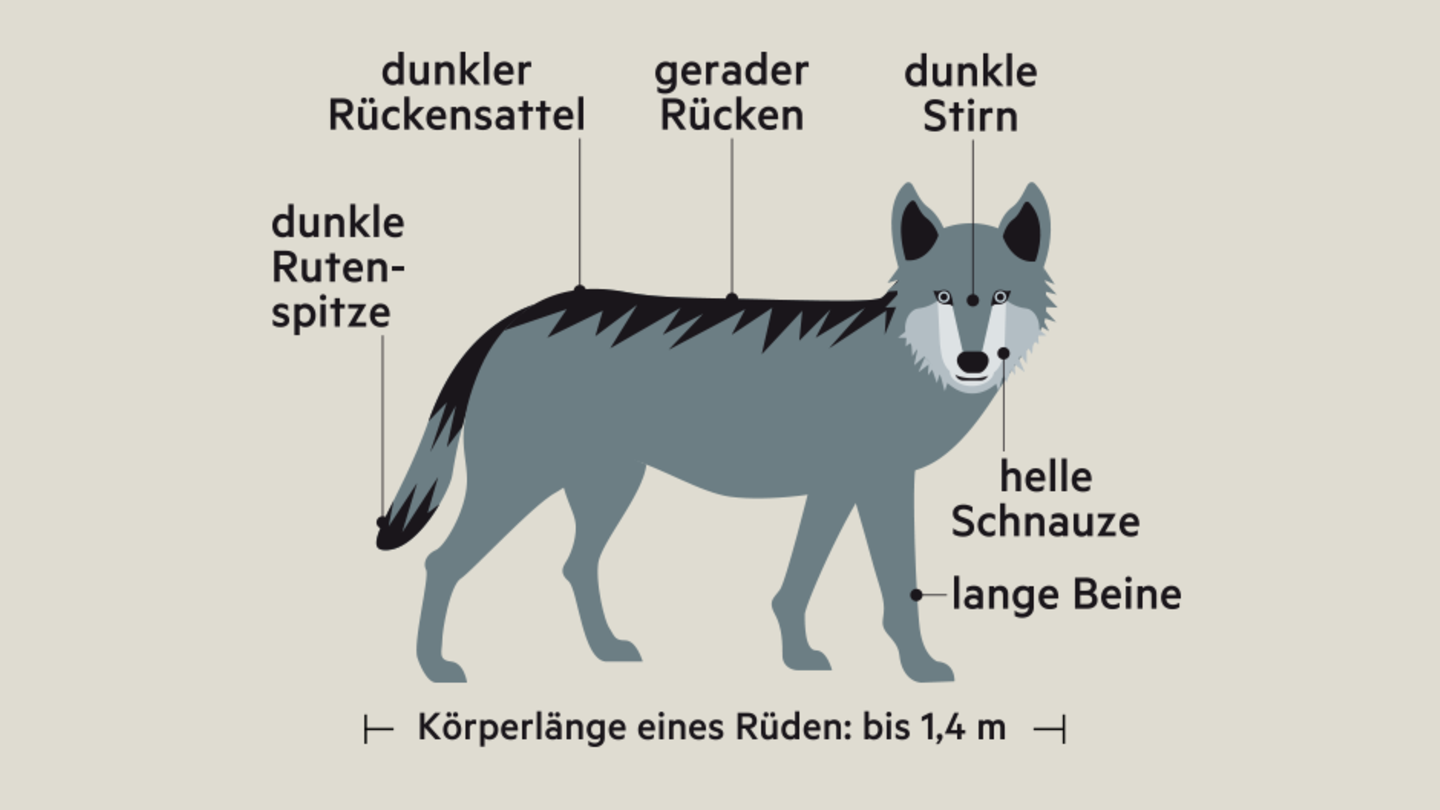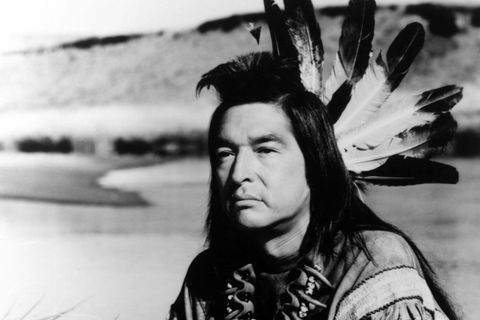Der Wolf scheint sich wohlzufühlen in der Schweiz. Zählte das Land laut Schweizer Regierung im Jahr 2020 insgesamt elf Wolfsrudel und etwas mehr als 100 Wölfe, sind es aktuell 32 Rudel und rund 300 Wölfe. Und nicht nur die Zahl der Raubtiere stieg, sondern auch die Zahl der Schäden, die sie verursachten. Im Jahr 2019 rissen Wölfe in der Schweiz 446 Nutztiere. 2022 waren es 1480.
Die wachsende Wolfspopulation stelle insbesondere die Alpwirtschaft mit Schafen und Ziegen vor große Herausforderungen, schrieb die Regierung Anfang November – und kündigte Konsequenzen an. Jetzt macht sie ernst: Ab dem 1. Dezember ist in der angepassten Jagdverordnung "unter klar definierten Bedingungen die präventive Regulierung von Wolfsrudeln zur Verhütung zukünftiger Schäden erlaubt". Neu dürfen die Kantone Wölfe erlegen, um zukünftigen Schaden zu verhüten, und nicht erst, nachdem Schaden entstanden ist.
Zwölf Rudel sind ab heute bis zum 31. Januar zum Abschuss frei. Die Kantone Graubünden, St. Gallen, Tessin, Wallis und Waadt hatten entsprechende Gesuche eingereicht, 12 von 13 wurden genehmigt. Ein Rudel besteht meist aus drei bis elf Tieren; Mutter, Vater und dem Nachwuchs der letzten zwei Jahre.
Ein schwieriges Vorhaben
Das Bundesamt für Umwelt geht davon aus, dass das Wachstum des Wolfsbestands stark gebremst werde. Die Hoffnung ist zudem, dass die Wölfe scheuer werden. Dass zwölf Rudel in den kommenden Wochen erlegt werden, gilt allerdings als unwahrscheinlich. Unwegsames Gelände, Winterwetter und das große Streifgebiet der Tiere dürften es schwierig machen, die Wölfe zu finden, schreibt SRF. Die Idee, dass man mit einer einzigen Aktion ein ganzes Rudel "entnehmen" könne, sei mehr Theorie als Praxis, wird ein Wildhüter aus Graubünden zitiert.
Und die Wolfsjagd ist nicht für jedermann und -frau: Im Wallis braucht man dafür unter anderem einen gültigen Jagdschein, und man muss für die Fuchs- und Wildschweinjagd eingeschrieben sein. Es darf auch kein Strafverfahren gegen den Jäger oder die Jägerin vorliegen.
Der Präsident des Walliser Jägerverbands geht davon aus, dass vielleicht zehn bis 15 Wölfe geschossen würden in diesem Winter, niemals aber über zwei Drittel der Walliser Wölfe. Und er versprach im Interview mit der "NZZ am Sonntag": "Es wird kein Massaker geben". Viele Leute hätten eine völlig falsche Vorstellung von der Wolfsjagd.
Der Wolf – ein emotionales Thema
Vorstellungen rund um den Wolf, sie spielen in der Debatte eine große Rolle. Schließlich bevölkert das Tier auch unsere Geschichten, die wir von klein auf hören, da frisst der Wolf auch mal ein Rotkäppchen. Die Schweiz diskutiert seit Jahren über ihre realen Wölfe und den richtigen Umgang mit ihnen. Die einen sehen die Bedrohung durch das Raubtier, leben als Landwirte in Sorge um ihre Tiere und die Grundlagen ihres Wirtschaftens. Die anderen sehen einen weiteren Eingriff des Menschen in die Natur, betonen den Schutz des Tieres und der Art.
Zu Angriffen auf Menschen ist es laut "NZZ" noch nie gekommen, seit der Wolf 1995 in die Schweiz zurückgekehrt ist.
Mit der angepassten Jagdverordnung ist nun von einem "Paradigmenwechsel in der Wolfspolitik" die Rede. Stand bislang der Schutz des Raubtiers an oberster Stelle, ist es jetzt der Schutz von Hab und Gut.
Dabei hatte das Stimmvolk ein neues Jagdgesetz, das den Wolfsschutz lockern wollte, erst im Jahr 2020 abgelehnt. Wenn auch knapp, mit 51,9 Prozent der Stimmen. Gegner sahen damals nicht nur den Wolf, sondern auch andere geschützte Arten gefährdet. Sie kritisierten Abschüsse "auf Vorrat". Auffällig am Ergebnis war: Berggebiete und Kantone der Zentralschweiz stimmten damals für das Jagdgesetz. In den Städten hingegen war die Stimmung eher pro Wolf.
Was sehen Städter in der Rückkehr des Wolfes?, fragte der "Beobachter" den Kulturanthropologen Nikolaus Heinzer im Jahr 2020, der die Debatte eng verfolgt hatte. Seine Antwort: "Der Wolf ist Teil einer bedrohten Natur, die weltweit auf dem Rückzug ist. Wenn er sich wieder ausbreitet, ist das eine punktuelle Erholung, ein Symbol, dass es anders geht, wenn der Mensch die Bedingungen schafft. Der politische Einsatz für den Wolf ist darum ein Engagement für die Natur, wie Bio-Produkte zu kaufen. Seine Rückkehr steht für eine Entwicklung als Ganzes, die man fördern will."
Auch Deutschland streitet über den Wolf
Während es dem Wolf in der Schweiz bereits an den Pelz geht, wird auch in Deutschland über ihn diskutiert. Problematische Wölfe, die Schutzzäune überwunden und Nutztiere gerissen haben, sollen in Deutschland künftig schneller als bisher getötet werden können. Darauf verständigten sich die Umweltminister von Bund und Ländern bei ihrem zweitägigen Treffen im westfälischen Münster. "Uns ist da ein Durchbruch gelungen", sagte Nordrhein-Westfalens Umweltminister Oliver Krischer am Freitag als Vorsitzender der Konferenz zu deren Abschluss. Den Ländern waren die Vorschläge von Bundesumweltministerin Steffi Lemke für einen leichteren Abschuss der Raubtiere zunächst nicht weit genug gegangen.
Die Bundesländer sollen bestimmte Regionen mit vermehrten Wolfsrissen festlegen. Anders als bisher soll dann für einen Abschuss aber nicht erst eine DNA-Analyse abgewartet werden müssen, wenn ein Wolf Schutzvorkehrungen überwunden und Nutztiere gerissen hat.
Quellen: Beobachter, Der Bundesrat, NZZ, NZZ am Sonntag, SRF(I), SRF(II), SRF(III), Süddeutsche Zeitung, mit Material von DPA