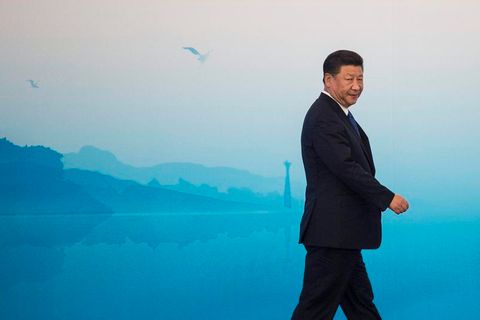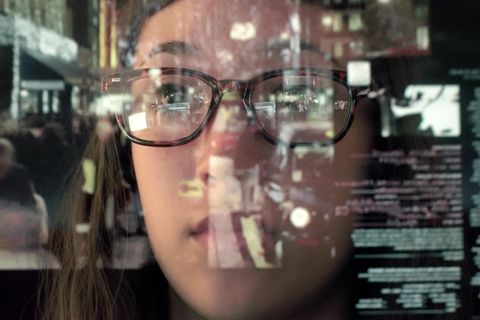Die Meldung, die vor ein paar Tagen über die Agenturen ging, fand kaum Beachtung. "Europas Aktien", stand da über ein paar dürren Sätzen, "sind mehr wert als amerikanische." Doch wen zwischen dem Polarkreis und der Poebene interessiert es schon groß, dass Europas börsennotierte Firmen inzwischen mit 15.720 Billionen Dollar 80 Billionen mehr wert sind als die der USA?
Dabei sind die Vergleichszahlen durchaus bemerkenswert, denn zuletzt hatte Europa an den Börsen solch eine Führungsposition im Jahr 1914. Damals schlittere der Kontinent in die größte Katastrophe seiner Geschichte. "In ganz Europa gehen die Lichter aus", sagte kurz nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs der britische Außenminister Edward Grey, "und wir werden nicht erleben, dass sie wieder angezündet werden."
Die Lichter sind wieder an
Spätestens seit 1989 sind die Lichter überall in Europa wieder an. Eine strahlende Erfolgsgeschichte, vor allem in wirtschaftlicher Hinsicht. Der größte Binnenmarkt der Welt, ein starker Euro, imponierende Handelsbilanzen - an all dies haben wir uns inzwischen gewöhnt wie an das Amen in der Kirche. Tabellen-Erster auf den Aktienmärkten, interessiert das jemand außerhalb Brüssels? Nein, wohl kaum, und diese Haltung mag auch etwas Sympathisches haben. Doch eines ist auch klar: Ein umgekehrtes Ergebnis - eine amerikanische Führungsposition auf den Aktienmärkten - hätte in den USA so manches Hurra ausgelöst.
Wenn es um Optimismus und gesundes Selbstbewusstsein geht, sind wir Europäer noch immer wahrlich keine Weltmeister. Das hat uns vor ein paar Jahren besonders gut ein Amerikaner erklärt, der Zukunftsforscher Jeremy Rifkin, dessen Buch "Der Europäische Traum" zwar diesseits des Atlantiks kein Bestseller wurde, doch zumindest einige Leser davon überzeugte, dass die EU heute unbestritten eine "sanfte" Supermacht ist. 14 der 20 wichtigsten Banken der Welt sind inzwischen europäisch, rechnete der Wissenschaftler aus Washington vor, und von den 140 größten Firmen der Welt haben 61 ihren Sitz in der EU und nur 50 in den USA. "Ihr Europäer", erklärte Rifkin einmal im Straßburger Parlament, "denkt oft noch in falschen Dimensionen, die Zeiten des schwachen Kontinents, das am Tropf Amerikas hängt, sind doch längst vorbei."
Das europäische Projekt floriert
Noch immer regen wir uns hauptsächlich darüber auf, dass die EU-Parlamentarier für viel Geld zwischen Brüssel und Straßburg pendeln, die EU-Bürokraten so bürokratisch sind oder die Verfassung im Kauderwelsch der vielen Sprachen nicht vorankommt. Doch trotz all dieser tief im inner-europäischen Bewusstsein verankerten Kritik floriert das europäische Projekt. Mehr noch: "Die Europäische Union bestimmt in zunehmendem Maße die Spielregeln auf der weltpolitischen Bühne."
Dieses optimistische Credo kommt diesmal nicht von einem Amerikaner, sondern aus dem Land der vielen Euro-Skeptiker: aus England. Der Autor heißt Mark Leonard, Direktor für Internationale Politik am "Centre for European Reform" in London. Seine gerade auf Deutsch erschienene Studie "Warum Europa die Zukunft gehört" (Deutscher Taschenbuch Verlag) trägt im Original den etwas aggressiveren Titel "Why Europe will run the 21st Century". Zentrale These des Buchs: Die EU besitzt die überzeugendste Antwort auf die Herausforderungen der Globalisierung und verkörpert eine Wertegemeinschaft, die allem Krisengerade zum Trotz überall in der Welt an Attraktivität gewinnt - von Albanien bis Zaire.
USA - die einsame Supermacht
"Das Buch dürfte alle aufwecken, die nur gähnen, wenn man das Wort Europa ausspricht", hieß es in der französischen Zeitschrift "Nouvel Observateur", und die Kollegen aus Paris haben recht. Leonard leitet seine Grundthese, ähnlich wie vor ihm der französische Sozialwissenschaftler Emmanuel Todd, aus der wirtschaftlichen und moralischen Schwäche der USA ab - einer "einsamen Supermacht", so der Brite, die nur "mit dem Einsatz von Geld-, Druck- und Zwangsmitteln Willfährigkeit" herstelle.
Die EU hingegen weite "ihren Einfluss aus, ohne spezielle Angriffsziele für potenzielle Gegner zu schaffen", indem sie "die Umsetzung der für alle Mitglieder verbindlichen Normen nationalen Institutionen überlasst". Leonard: "Je weiter die wirtschaftliche Entwicklung Indiens, Brasiliens, Südafrikas und sogar der Volksrepublik China fortschreitet, desto attraktiver und unwiderstehlicher wird für sie das europäische Modell sein als Weg, Wohlstand zu erlangen und gleichzeitig die eigenen Sicherheitsinteressen zu wahren."
"Die amerikanische Macht in ihrem Wesen umgestalten"
Der Brite geht keineswegs davon aus, dass sich die EU aus dem transatlantischen Verbund mit den USA lösen sollte. Im Gegenteil. Gemeinsam müssten die Partner, schreibt er, "die amerikanische Macht in ihrem Wesen umgestalten." Nicht mehr bundesstaatliche Ordnung mit Hilfe einer ominösen Verfassung sollte sich die EU auf ihre Fahnen schreiben, sondern einen neuen "europäischen Politikstil", den sich der Rest der Welt gerne zu eigen macht.
Leonards Visionen mögen manchmal etwas hochfliegend sein - gute Lektüre zum bevorstehenden US-EU-Gipfel, der am 30. April in Brüssel steigt, ist sein Buch auf jeden Fall.