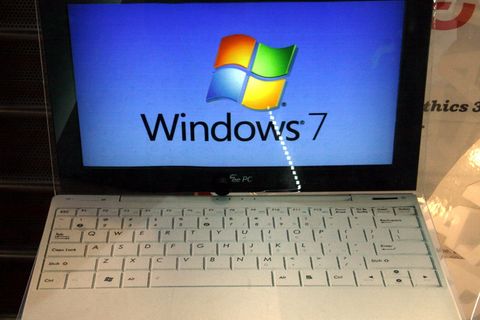Einer hat Hausaufgaben gemacht. Das Ergebnis ist falsch - aber immerhin: Björn hat es versucht. Einer von 16 Schülern! Holger Redlich hat gelernt, seine Freude zu zähmen. Er will niemandem falsche Hoffnungen machen, weder Björn noch dem Rest oder sich selbst. Insgeheim jubelt er trotzdem: Denn einer ist allemal besser als keiner. Acht sind an diesem Morgen da, fünf sogar pünktlich, was auch nicht so schlecht ist. Eigentlich, findet Herr Redlich, könne er relativ zufrieden sein, erst recht mit Björn.
Björn ist 17 Jahre alt, ziemlich pünktlich und steht in allen Fächern sicher auf Vier. Damit gehört er zu den Besten seines Jahrgangs an der Hamburger Gewerbeschule Kraftfahrzeugtechnik, wo er ein sogenanntes berufsvorbereitendes Jahr (BVJ) absolviert. Es gibt nur zwei Probleme: Björns Schrift kann niemand lesen, auch der wohlwollende Herr Redlich nicht. Das andere ist das BVJ selbst.
"Wir bekommen den Bodensatz"
Seit etwa 30 Jahren gibt es diese Schulform so ähnlich überall in Deutschland: Eine Mischung aus Praxis und Schule soll Jugendliche ohne jeden Schulabschluss auf ein Berufsleben vorbereiten, das es ohne Schulabschluss heutzutage gar nicht mehr gibt. Nebenbei, so wird den Schülern vorgegaukelt, könnten sie außerdem den Hauptschulabschluss nachholen. So gaukeln es sich auch Lehrer aus Regelschulen und die Schulbehörden vor, die sie dorthin abschieben; die Politik, die sich damit beruhigt; verzweifelte Eltern: Notfalls gibt es immer noch das BVJ.
Tatsächlich ist das Jahr mit der irreführenden Bezeichnung nur eine von vielen Möglichkeiten, weder einen Beruf noch einen Schulabschluss zu bekommen, wenn auch wahrscheinlich die sicherste, sinnloseste und teuerste. In den BVJ-Klassen zwischen Bayern und Mecklenburg-Vorpommern landen irgendwann alle, die anderswo nichts „gerissen“ haben: Förderschüler und Faulpelze, Schwänzer und Sitzenbleiber - aber auch jede Menge Spätstarter, die viel zu früh durch jeden Rost gefallen sind. "Wir bekommen den Bodensatz", sagt Holger Redlich, 49, "und sollen neben Praktika und Projekten in einem knappen Jahr nachholen, was ein Schülerleben lang versäumt wurde."
Seit 13 Jahren fängt er nach den Sommerferien bei null an, "eigentlich im Minusbereich", denn auch Niveau und Disziplin sinken stetig. Nicht kippeln! Sitzen bleiben! MP3-Player aus! Die ersten Monate gehen allein dafür drauf, Begriffe wie Pünktlichkeit und Autorität so weit zu vermitteln, dass halbwegs an Unterricht zu denken ist. Manchmal braucht es auch ganzen Körpereinsatz, aber darüber will Redlich gar nicht erst reden. "Man muss es mögen", sagt er, "und darf den Sinn nicht hinterfragen." Redlich gibt Mathe und schraubt mit seinen Schülern zwei Tage die Woche an Oldtimern herum. Den meisten macht das Spaß, weil man da nicht denken muss. Und weil sie das ernst meinen, hat Redlich in der Werkstatt vor allem damit zu tun, dass nicht allzu viel kaputtgeht.
Es sind unschulbare Freigeister dabei wie Costa, der mit 15 der Jüngste ist und im Unterricht entweder schläft oder um sich schlägt. Oder Dennis, 17, der Gedichte voller Todessehnsucht schreibt - allerdings nur in Mathe, während er in Deutsch Mathe-Kästchen vollmalt. Erol, 18, erfüllt mit dem Schulbesuch eine Bewährungsauflage für seine letzte Körperverletzung und wird von Redlich trotz Volljährigkeit nur noch geduldet, "weil er in der Werkstatt ein brauchbarer Schrauber ist". Die Mehrheit aber starrt Stunde für Stunde tapfer auf die Tafel, ohne dass ihnen die Zeichen aus Kreide etwas sagen. An Praxistagen sortieren Dennis und Costa Schrauben.
In aktuellen Bildungsdebatten tauchen diese Schüler nicht auf
Zugunsten der Grundrechenarten und für ein bisschen Dreisatz hat Redlich vom praktischen Unterricht schon einen Wochentag abgezweigt. Es reicht trotzdem nie: "Wenn pro Klasse zwei den Haupt schaffen", sagt Redlich und meint den notdürftigsten aller Schulabschlüsse, "ist das viel." Zwei von sechzehn, mit Sport als Ausgleichsnote vielleicht auch drei. "Selbst das ist nur ein Beleg, wie sehr wir die Ansprüche runtergeschraubt haben." An diesem Morgen sind einfache Gleichungen mit einer Unbekannten dran, zum Beispiel: x+2 = -4. Ein paar Schüler raten noch mit: Zwei? Null? Geht nicht? Sie verzweifeln, weil auf beiden Seiten eine Zwei abgezogen werden muss, aber auf einer Seite schon minus steht. Redlich stöhnt geduldig: "Stellt euch ein Thermometer vor. Draußen sind minus vier Grad, und es wird noch zwei Grad kälter. Na?" Niemand meldet sich. "Macht euch nicht dümmer, als ihr seid", sagt Redlich - und findet das oft am traurigsten: Seine Schüler haben genau damit kein Problem mehr nach etlichen Jahren als Loser. Sie sagen ständig: "Kann ich nicht. Weiß ich nicht. Dafür bin ich zu blöd."
Weder Scham noch Ehrgeiz treibt sie an, nicht mal beim Sport. Sie haben längst verinnerlicht, dass sie nichts können, und bevor sie eine Aufgabe überhaupt lesen, fragen sie schon: "Herr Redlich, wie sollen wir das machen?" Lehrer wie er können über die aktuellen Bildungsdebatten nur staunen: Akademikermangel? Lehrstellen? Pisa? Das klingt für Holger Redlich wie aus einem fernen Land, wie die Sorgen reicher Leute. Reden die wirklich über dasselbe Schulsystem?
Selbst als Deutschland Anfang September im weltweiten Bildungsvergleich der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) von Rang 10 auf 22 rutschte, ging es wieder nur um fehlende Abiturienten - nicht um die knapp 80.000 Jugendlichen, die stattdessen jedes Jahr ganz ohne Abschluss von deutschen Schulen abgehen, zehn Prozent eines Jahrgangs und oft "funktionale Analphabeten", wie der Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung klagt, "die trotz Erfüllung der Schulpflicht nur so gut lesen und schreiben wie Kinder der ersten oder zweiten Klasse". Dabei ist die Hamburger Gewerbeschule G 9 keine Rütli-Schule. Redlichs Schüler kommen aus den Ghettos im Osten der Stadt genauso wie aus den Reihenhäusern vom Stadtrand. Knapp über 60 Schüler im BVJ teilen sich Mensa und Sportplatz mit Mechatronikern und anderen Kfz-Lehrlingen, die hier als normale Berufsschüler ausgebildet werden - und gehen den Schulweg von der U-Bahn bis zum Tor mit Gymnasiasten, die nebenan fürs Abitur lernen. Ihre Wege aber haben sich lange vorher getrennt.
Sie rutschen von einer Schleife in die nächste
Franzi, das einzige Mädchen der Klasse, konnte fließend lesen, als sie in die Grundschule kam. Sie hatte es sich selbst beigebracht; nach einer verschleppten Ohrenentzündung hörte sie kaum noch, sprach mit niemandem. Von der Grundschule schickte man sie auf eine Förderschule. Als die Ursache ihrer Lernprobleme entdeckt wurde, war es längst zu spät. Der ehemalige Kleindealer David hatte bis zur neunten Klasse fast immer nur Sechsen und "falsche Freunde", wie er sagt, und in seinem ersten BVJ "Stress mit Kanaken". Jetzt hat er Stress mit Redlich - "nur weil der glaubt, ich schaffe den Haupt vielleicht doch".
Björn war immer zu klein für sein Alter und wird auch jetzt noch bei jeder Gelegenheit von Costa geohrfeigt. Er macht notgedrungen den Clown für alle und auf Befehl Motorgeräusche, bis sich die anderen vor Lachen wegschmeißen, wenn er im fünften Gang jault. Er ist das, was seine Altersgenossen ein "Opfer" nennen. "Man braucht eben immer einen zum Ärgern", sagt er selbst. Seine Augen kann er im Unterricht kaum offen halten, weil er jede Nacht Computer spielt. "Die meisten sitzen hier den Rest ihrer Schulpflicht ab", sagt Holger Redlich. "Siewerden verwahrt, bis sie volljährig sind." Dann endet in den meisten Bundesländern auch die Berufsschulpflicht, und die Schulbehörden übergeben an ein anderes Ressort, meist das Sozialamt. Alle Maßnahmen davor und dazwischen nennen Experten unfreiwillig zynisch das "Übergangssystem", obwohl dort schon mehr als 1,3 Millionen Schulabgänger im Alter von bis zu 29 Jahren ohne Berufsausbildung kreisen.
Lange hat die Politik auf die sinkenden Geburtenraten spekuliert: Wenn es weniger Schulabgänger gibt, so die trügerische Hoffnung, steigen vielleicht ihre Chancen. Doch es ist das Gleiche, als zöge man von minus vier noch einmal zwei ab: Die Anzahl der aktuell 18-, 17- und 16-Jährigen sinkt, und mit ihr sinken deren Chancen. Während die Arbeitslosenquote durch echte Jobs abnimmt, wird die Statistik bei den unter 25-Jährigen nur mit Milliardenprogrammen und immer neuen überbetrieblichen Maßnahmen weiter verschoben. "Hier wächst seit Jahren ein Problem, das in seiner gesellschaftlichen Tragweite überhaupt noch nicht wahrgenommen wird", sagt Professor Arnulf Bojanowski vom Institut für Berufspädagogik an der Universität Hannover. Zwar streite man immer mal wieder über die Gründe, ob es nun an ein paar Tausend fehlenden Ausbildungsplätzen liegt oder an Defiziten der Schulen. „In Wirklichkeit aber“, fürchtet Bojanowski, „fühlt sich keiner zuständig, weil die Kinder der Zuständigen vermutlich alle auf Gymnasien landen.“Mehr als ein Jahr hat es gedauert, bis sich das Berliner Parlament in einer Sitzung mit dem Nationalen Bildungsbericht 2006 befasste, in dem die "Expansion des Übergangssystems" erstmals als "ernsthafte bildungspolitische Herausforderung" bezeichnet wird.
Weder Scham noch Ehrgeiz treibt sie an
Es war im Mai dieses Jahres, lange nach Mitternacht, und wahrscheinlich hat deshalb wieder niemand bemerkt, was sich dort zwischen 330 laut Experten "überwiegend beschönigenden Seiten" verbirgt - nämlich, so die Autoren des Berichts, die "möglicherweise folgenreichste und auch problematischste Strukturverschiebung" im deutschen Bildungswesen. Schlimmer noch: Ob BGJ (Berufsgrundbildungsjahr), AVJ (Allgemeines Vorbereitungsjahr) oder BVJ, ob Maßnahmen der Bundesagentur oder der Berufsfachschulen, in denen vor allem Mädchen für ein Jahr geparkt werden - wegen mangelnder Vergleichsdaten kann niemand sagen, ob all das irgendwelche "Ausbildungs- und Arbeitsmarkteffekte" bringt. "Was die Maßnahmetypen eint", so der Bericht, ist die Tatsache, "dass sie zu keinem qualifizierten beruflichen Abschluss führen". Und weiter: "Insofern scheint die Etikettierung des Übergangssystems als Warteschleife einen Kern von Wahrheit zu enthalten."
Redlich sagt es seinen Schülern deutlicher: "Ihr habt sowieso keine Chance, also strengt euch wenigstens an." Womit soll er sie auch motivieren? Wenn sich einer besonders blöd anstellt, sagt er auch mal "Trottel" oder "Hirsch" zu ihm und hat im Gegenzug gelernt, dass "Kanake", und "deine Mutter ficken" nicht immer so gemeint ist. Immerhin scheint er der erste Lehrer zu sein, bei dem David nach einer Extra-Einladung sein Schreibzeug auspackt, bei dem Björn Hausaufgaben macht. Der erste, der auch am Ende des Schuljahrs immer noch bei den Eltern anruft, wenn die Behörde längst kein Bußgeld mehr für Schwänzer eintreibt. Bei jeder Verspätung pocht Redlich auf eine Entschuldigung. Später im Job gehe das auch nicht, sagt er dann. Das ist Berufsvorbereitung. Seine Schüler verdrehen die Augen; sie wissen, dass sie später sowieso immer ausschlafen können.
Redlich ackert, weil es Franzi und David vielleicht trotzdem schaffen - zwei von sechzehn - und manchmal scheint es, als mache er überhaupt nur noch Unterricht für sie. Das eigentliche Wunder dabei ist, dass er immer noch an solche Wunder glaubt. Die vier Migrantenkinder seiner Klasse machen ihm noch die wenigsten Sorgen. Als lebensfrohe Großmäuler fallen sie in dem antriebslosen Haufen beinahe positiv auf. "Die finden schon irgendwas", glaubt Redlich - im Gegensatz zu jungen Männern wie Kevin oder René, beide 17, die früher vielleicht auch ohne Schulabschluss bei einem Handwerker etwas lernen konnten, was heute nicht mal der Hälfte aller Realschüler gelingt. Für Kevin und René ist das Berufsleben zu Ende, bevor es angefangen hat, da können sie sich in der Oldtimer-Werkstatt noch so geschickt anstellen oder wie René in der Freizeit als Ordner beim FC St. Pauli Behinderte betreuen.
"Es interessiert keine Sau, was aus denen wird"
Wer in den Prüfungsfächern Mathematik, Deutsch und Englisch keinen Stich sieht, wird auch im BVJ aussortiert: Seit vergangenem Schuljahr dürfen sie in Hamburg nur dann an der Hauptschulprüfung teilnehmen, wenn sie drei Extra-Doppelstunden Mathe und Deutsch pro Woche absolviert haben. Doch wer im ersten Halbjahr in mehr als zwei Fächern auf Vier oder schlechter steht, für den gibt es den Zusatzunterricht gar nicht erst. René hätte es wenigstens gern mal probiert. So aber gehört er zu den elf Schülern seiner Klasse, die auch dieses Jahr völlig ziellos abreißen, 11 von 16. Angeblich nimmt er schon ewig "diese Pferdepillen", um sich überhaupt konzentrieren zu können. Es klingt wie eine Entschuldigung, wie ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, doch vermutlich ist es nur seine Art, sich einen Rest Selbstwertgefühl zu bewahren. Denn seine Mutter weiß nichts von Medikamenten, kümmert sich stattdessen um Praktika und organisiert private Nachhilfe. "Leider war das nun auch zwecklos", sagt sie, "wenn er nicht mal zur Prüfung darf."
Björn darf und würde danach gern Karosseriebauer werden, "am liebsten bei Ford oder einem anderen". Doch weil er ahnt, dass er den "Haupt" sowieso nicht schafft und - selbst wenn - damit nicht gerade die Auswahl hat im Gerangel mit Realschülern, "mach ich eben Quas". Wieder so eine Maßnahme: sechs Monate "Qualifizierung und Arbeit". Warum und wofür, weiß Björn auch nicht. Aber er hat gehört, da gebe es 150 Euro im Monat. So rutschen sie von einer Schleife in die nächste, absolvieren oft mehrere BVJs nacheinander und entwickeln dabei eine Maßnahme-Mentalität, die sie auf das künftige Leben mit Hartz IV und Ein-Euro-Jobs vorbereitet.
"Es interessiert keine Sau, was aus denen wird", sagt Redlich. Die meisten Eltern nicht: Aus vier BVJ-Klassen kommen nur sechs zum Elternabend, sechs bei knapp 60 Schülern. Das Schulsystem nicht: Darin sieht Redlich das Hauptproblem, weil "dadurch die Hauptschulen seit Jahren vernachlässigt werden und die frühe Selektion mit der Einschulung anfängt". Und die Unternehmen interessiert es auch nicht: Die umwerben zwar Schulabgänger mit guten Zeugnissen, reduzieren aber zugleich die Ausbildungsplätze - um dann über Fachkräftemangel zu klagen. Laut einer Studie der Friedrich-Ebert- Stiftung gefährden die Bildungsdefizite deutscher Schüler zunehmend die Volkswirtschaft. "Die sich abzeichnende Fachkräftelücke ist hausgemacht", schreibt der Soziologieprofessor Martin Baethge. Die schrumpfenden Jahrgänge würden diesen Trend nur noch verstärken. Und das ist auch Redlichs einzige Hoffnung: Dass die jungen Leute irgendwann allzu knapp werden und man sich an seine Jungs erinnert: "Vielleicht mit einer Art Hilfsarbeiterausbildung, mit der sie für weniger Geld trotzdem arbeiten könnten."
Bis dahin drängeln sich seine Schüler in der Pause um die sechs Schulcomputer im Foyer und spielen „World of Crime“. Bei diesem Internetspiel sollen 100.000 geerbte Euro möglichst geschickt in Drogen, getunte Autos oder Waffen angelegt werden. Nach und nach steigt man so in der Gangsterhierarchie bis zum Mafiaboss auf, kann andere Spieler in den Bandenkrieg schicken oder Nutten für sich laufen lassen. „Wie im richtigen Leben“, sagt Costa und grinst, als sei das nur ein Scherz gewesen.