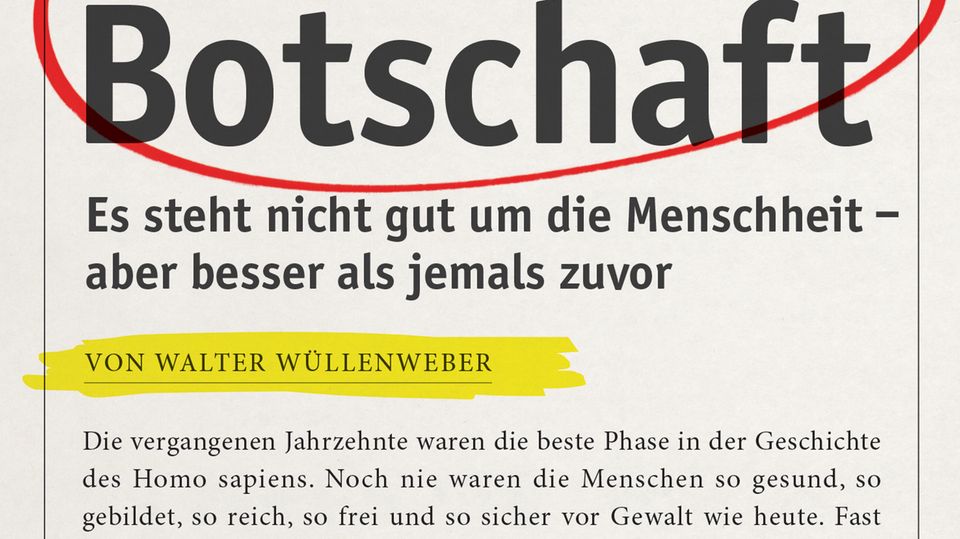In Chemnitz marschieren Nazis. Im Hambacher Forst verliert der Klimaschutz eine wichtige Schlacht. Assad führt weiter Krieg gegen das syrische Volk. Wer auf die aktuelle Nachrichtenlage schaut, kommt zu dem Schluss: Es steht nicht gut um die Menschheit.
Wer aber einen Schritt zurücktritt, und sich die Entwicklung in Deutschland und in der Welt aus der Perspektive der letzten Jahrzehnte betrachtet, kommt zu einem völlig anderen Ergebnis: Es steht besser als jemals zuvor.
Das ist kein Gefühl und keine Meinung, sondern die solide Faktenlage wissenschaftlicher Erkenntnisse. Nahezu alle Entwicklungskurven zeigen steil nach oben. Noch nie waren die Menschen so gesund, so gebildet, so reich, so sicher vor Gewalt und Kriminalität und so frei wie heute. Und noch nie wurden sie so alt: 72 Jahre beträgt die durchschnittliche Verweildauer eines Erdenbürgers. Wir, die heutigen Menschen, haben das Privileg, in der besten Phase der 300.000-jährigen Geschichte des Homo Sapiens leben zu dürfen.
Zahlen und Daten: Was alles besser wird
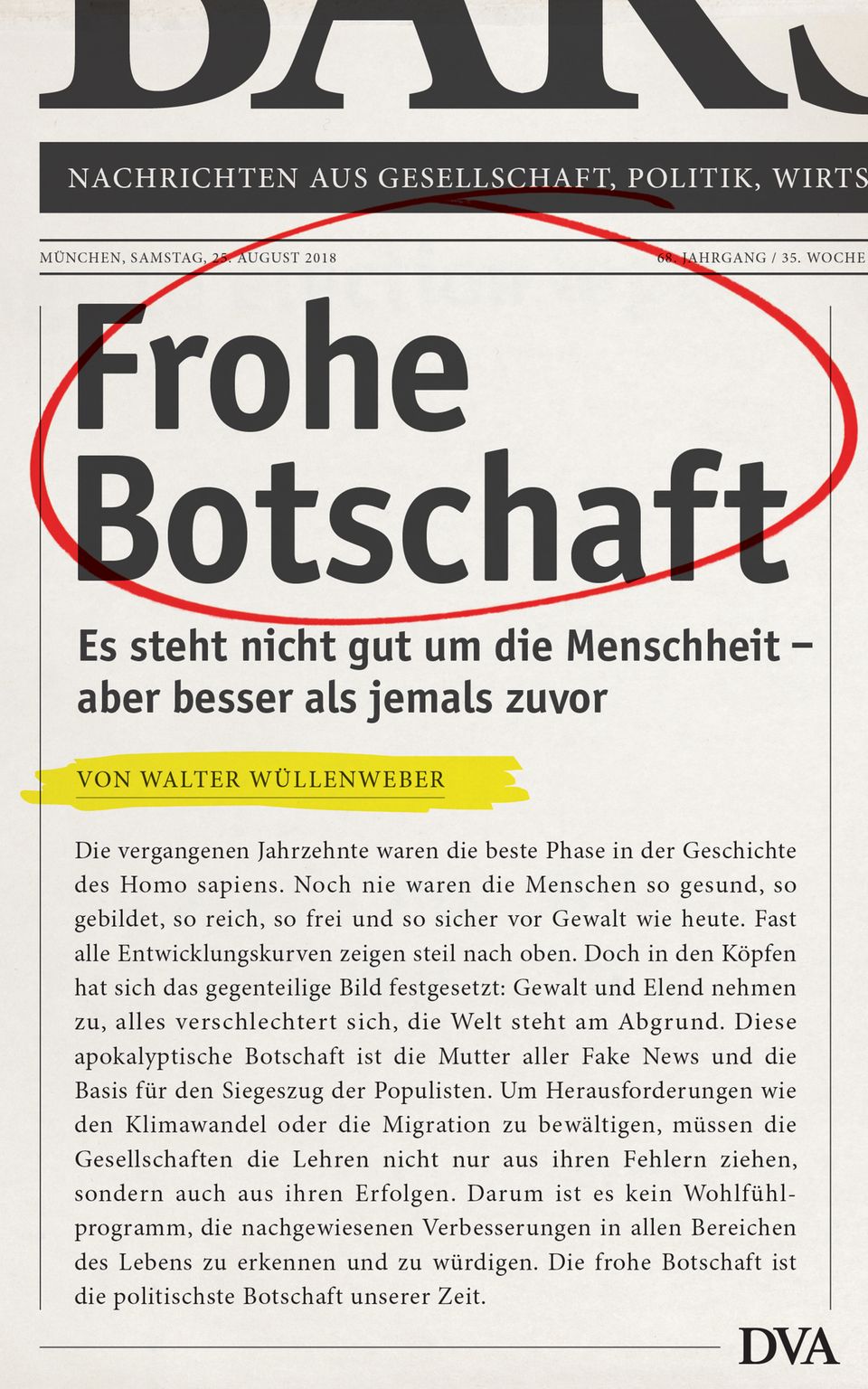
Das Buch von stern-Autor Walter Wüllenweber: "Frohe Botschaft", Deutsche Verlagsanstalt, 18 Euro
Glauben Sie nicht? Hier kommen Zahlen und Daten. Achtung, anschnallen! So lange unsere Spezies existiert lebten stets mehr als 90 Prozent am oder unterhalb des Existenzminimums. In den letzten 50 Jahren ist es gelungen, den Anteil dieser extrem Armen entscheidend zu reduzieren auf heute unter zehn Prozent. Noch in den 1960er Jahren verhungerten von 1000 Menschen jedes Jahr etwa 50. Heute noch einer, und zwar alle zwei Jahre. Das sind noch immer viel zu viele, aber es ist ein Rückgang um 99 Prozent. In den 1950er Jahren war die große Mehrheit von 60 Prozent der Menschen Analphabeten, heute noch 16 Prozent, und die allermeisten sind über 60 Jahre alt. Der Analphabetismus stirbt aus. In den 1950er Jahren musste fast jedes dritte Kind für seinen Lebensunterhalt arbeiten, heute jedes zehnte. Die Kindersterblichkeit konnte seit 1990 um etwa zwei Drittel reduziert werden.
Sie werden es kaum glauben, aber es stimmt: Die Welt wird immer friedlicher. In den 1970er Jahren war die Wahrscheinlichkeit für einen Erdenbürger, bei einem Krieg getötet zu werden, etwa sieben mal größer als heute. In den 1970er und 80er Jahren ermordeten Terroristen in Westeuropa pro Jahr durchschnittlich 252 Unschuldige. In den letzten zehn Jahren im Schnitt 42: minus 85 Prozent. Die Deutschen dürfen sich über die niedrigste Kriminalitätsrate seit der Wiedervereinigung freuen. Und das, obwohl die Opfer immer mehr Straftaten anzeigen. Besonders drastisch ist der Rückgang übrigens bei der Jugendgewalt und bei Sexualmorden.
Einem Terror-Opfer, einer vergewaltigten Frau oder einem hungernden Kind ist es kein Trost, dass sein Schicksal heute unwahrscheinlicher ist als jemals zuvor. Das macht deutlich: Die Probleme sind längst noch nicht gelöst. Es gibt keinen Grund zur Entwarnung und sich entspannt zurück zu lehnen. Dennoch müssen wir feststellen: Auf fast allen Gebieten konnten epochale Fortschritte erreicht werden, die für frühere Generationen unvorstellbar waren. Objektiv hat sich das Leben erheblich verbessert.
Es fühlt sich aber überhaupt nicht so an. Nur zu oft widersprechen die nachweisbaren Fakten unserem Empfinden. So leiden gerade in Deutschland viele unter einem Ungleichgewicht ihrer work-life-balance. Tatsächlich jedoch haben unsere Väter und Großväter in den 1960er Jahren im Schnitt 800 Stunden pro Jahr mehr gearbeitet. Mit diesem Arbeitspensum wären sie mit unserer heutigen Jahresleistung im August durch und könnten den Rest des Jahres frei machen.
Der Dieselskandal hat deutlich gemacht, wie sehr unsere Atemluft durch die krankmachenden Abgase verpestet wird. Das erweckt den Eindruck, die Luft sei heute stärker belastet als früher. Stimmt aber nicht. In Deutschland ist der Stickoxydgehalt in der Luft um zwei Drittel geringer als noch 1990. Die Feinstaubbelastung in europäischen Großstädten ist in den vergangenen 100 Jahren sogar um rund 95 Prozent gesunken. Nur vor der industriellen Revolution war die Luft tatsächlich sauberer. Aber nicht dort, wo unsere Vorfahren sie eingeatmet haben. Die hielten sich meist in schlecht gelüfteten Häusern oder Hütten auf, die mit Öfen oder sogar offenem Feuer geheizt wurden. Ruß und Grobstaub färbte Nasenlöcher und Lungen schwarz. Heute müssten Behörden den Aufenthalt in solchen Räumen verbieten.
Wir beklagen – völlig zu recht! – die immer unverschämteren Mietpreise vor allem in den Ballungsräumen. Viele haben das Gefühl, unter unzumutbaren Bedingungen wohnen zu müssen. Dabei vergessen wir: Seit 1990 ist die durchschnittliche Wohnfläche in Deutschland pro Person von 35 auf 46 Quadratmeter gewachsen. Das entspricht fast einem zusätzlichen Zimmer pro Person.

Nicht alle Verbesserungen lassen sich in Zahlen messen
Nicht alle Verbesserungen lassen sich in Zahlen messen. Dennoch gibt es sie. So profitieren gerade wir Deutschen von einer spürbaren Liberalisierung des Lebens. Bis 1994 war Sex zwischen Männern gesetzlich verboten. Heute können sie selbstverständlich heiraten. Der spießige Muff der alten Bundesrepublik sowie der alten DDR ist weitgehend ausgelüftet. Die Deutschen haben Gefallen gefunden an der offenen, vielfältigen Gesellschaft. So empfinden mehr als zwei Drittel Flüchtlinge und Zuwanderer nicht als Belastung, sondern als Bereicherung. Mit Ausnahme einer radikalen und sehr lauten Minderheit schauen die meisten Deutschen inzwischen mit großer Gelassenheit auf das, was nur am Anfang wie eine Flüchtlingskrise erschien. Nicht wenige sind sogar stolz darauf, mit welcher Geschwindigkeit die vielen Neuankömmlinge untergebracht und versorgt wurden, wie die Kinder in den Schulen aufgenommen wurden, wie viele Ehrenamtliche sich engagiert und wie viele Flüchtlinge bereits einen Job gefunden haben.
So langsam regt sich Widerspruch bei Ihnen. So viele frohe Botschaften auf einmal sind ungewohnt, für viele nur schwer zu ertragen. Wir Deutschen können in den schillerndsten Farben schwarz malen. Wir sind geprägt von apokalyptischen Vorhersagen, von Büchern wie "die Grenzen des Wachstums" oder "Global 2000". Hierzulande gelten Warner und Mahner aus Prinzip als glaubwürdig und weise. Wer jedoch auf nachgewiesene Fortschritte und Erfolge hinweist, ist entweder naiv oder gekauft. Vermutlich haben viele beim Lesen der vorangegangenen Zeilen genau diesen Pessimismusreflex auch schon verspürt und im Geiste widersprochen: Was ist mit der Klimakatastrophe? Was mit der Ungerechtigkeit?
Das sind berechtigte Einwände. Denn natürlich hat sich - trotz der einmalig positiven Gesamtbilanz - in den vergangenen Jahren nicht alles positiv entwickelt. Die Verteilung des Reichtums – in der Welt und auch in Deutschland - wurde in den letzten Jahren sogar ungerechter und unverschämter. Die Reichen wurden unvorstellbar viel reicher. Allerdings wurden die Armen nicht ärmer. Der Abstand hat sich spürbar vergrößert, weil sich die oberen zehn Prozent fast den gesamten Zugewinn für sich allein gesichert, der in den letzten Jahrzehnten zusätzlich erwirtschaftet wurde. So bleibt die himmelschreiende Ungerechtigkeit eine der großen, unerledigten Aufgaben der Menschheit.
Der Klimawandel ist noch weit mehr als eine Aufgabe, er ist eine existenzielle Bedrohung. Ob die Erderwärmung noch rechtzeitig gestoppt wird, scheint derzeit fraglich. Die Weltgemeinschaft steckt mitten in der größten ökologischen Herausforderung. Aber nicht in der ersten. In den 1980er Jahren bedrohte das Ozonloch das Klima. Damals rauften sich die Verantwortlichen des gesamten Globus zusammen und schlossen 1987 das erste weltweite Umweltabkommen. Das wirkte. Vor zwei Jahren konnten Forscher erstmals nachweisen, dass sich das Ozonloch wieder schließt.
Auch die Lage der Natur verbessert sich in Teilen
Ebenfalls in den 1980er Jahren bestimmte noch eine zweite ökologische Katastrophe die Schlagzeilen: das Waldsterben. Das war keine Erfindung von zotteligen Müslifetischisten. Der saure Regen hatte den Baumbestand in den Mittegebirgen bereits sichtbar geschädigt. Doch die ersten Maßnahmen der Umweltpolitik in Deutschland verordnete den Kohlekraftwerken härtere Grenzwerte für Schwefel-Emissionen. Auch das wirkte. Der gesamtdeutsche Wald ist erheblich gewachsen. Verglichen mit 1970 kam eine Fläche hinzu, die doppelt so groß ist wie der Schwarzwald.
Auch das Wasser wurde sauberer. So konnte die Belastung mit Schwermetallen in den vergangenen 30 Jahren um fast drei Viertel reduziert werden. In vielen Städten entstehen schicke neue Wohnviertel in den ehemaligen Binnenhäfen. Das ist nur möglich, weil das Wasser nicht mehr so unerträglich stinkt, wie die Brühe, die dort noch vor kurzem die Ufer verseuchte. Vor 30 Jahren kämpften Greenpeace-Aktivisten mit Schlauchbooten gegen Hochseefrachter, die auf der Nordsee Dünnsäure verklappten. Mit Erfolg. Das Umweltverbrechen wurde längst verboten. Kaum einer erinnert sich daran. Stimmt, da war doch was.
Die Umweltbewegung gehört zu den kraftvollsten Motoren der Zivilgesellschaft. Sie hat zeigt: Engagement lohnt sich. Und sie beweist, dass unsere Gesellschaft nicht starr ist, sondern ein lernendes System.
Die vielen positiven Veränderungen passieren nicht zufällig alle gleichzeitig. Sie beeinflussen sich gegenseitig. 70 Jahre ohne Krieg sind ein Segen für die Volkswirtschaft. So bleibt mehr Geld für die Bildung, für die medizinische Versorgung oder für den Sozialstaat. Das entspannt die Menschen und bewirkt einen Rückgang der Kriminalität. Was wieder der Wirtschaft hilft. Und so weiter. Man kann das ewig fortsetzen. Der gegenteilige Effekt ist uns allen bewusst: Mehrere negative Einflüsse verstärken sich gegenseitig und setzen eine Abwärtsspirale in Gang. Das Ganze geht auch andersrum. Auch die vielen Fortschritte verstärken sich. Die Welt befindet sich in einer Aufwärtsspirale.
Wenn das alles so eindeutig ist, warum ist uns die frohe Botschaft nicht bewusst? Warum sind die meisten Menschen überzeugt, dass die generelle Entwicklungskurve nach unten zeigt? Eine berechtigte Frage.
Die Wissenschaft kann sie beantworten. Das können Sie morgen beim stern lesen.