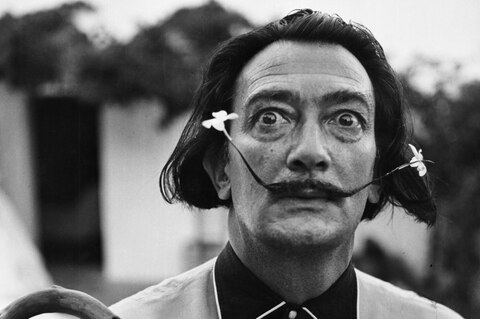Heimliche Vaterschaftstests sind vor Gericht als Beweismittel unzulässig – etwa bei der Anfechtung der Vaterschaft. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) nun entschieden. Nach dem Grundsatzurteil verletzt ein Gentest, der ohne Einwilligung der Betroffenen zustande gekommen ist, das Persönlichkeitsrecht des Kindes. Damit können Männer ihre Vaterschaft nicht unter Berufung auf solche Tests anfechten, sondern müssen andere konkrete Verdachtsmomente nennen, die Zweifel an ihrer Vaterschaft wecken.
Der Anwalt und Medizinrechtler Albrecht Wienke aus Köln sagt im Gespräch mit stern.de: "Das Urteil ist aus meiner Sicht nicht überraschend." Heimliche Vaterschaftstests seien mit unbemerkt mitgeschnittenen Telefonaten oder einer unterlassenen Rechtsbelehrung von Angeklagten zu vergleichen. Auch in diesen Fällen dürfen die dadurch gewonnenen Erkenntnisse nicht vor Gericht verwendet werden.
Schwer zu verstehen - obwohl die Vaterschaft in den vorliegenden Fällen eindeutig ausgeschlossen ist, haben die "Väter" nach der derzeitigen Rechtslage keine Möglichkeit, ihre Vaterschaft und damit die Unterhaltszahlungen anzufechten. Einzige Ausnahme: Wenn sie andere konkrete Verdachtsmomente vorweisen können, die von den Richtern anerkannt werden, kann das Gericht einen Vaterschaftstest anordnen (siehe Kasten).
Konsequenzen für zweifelnde Väter
Heimliche Vaterschaftstest bieten Männern zwar die Gewissheit, ob ihre Kinder von ihnen sind, sie geben ihnen aber nicht die Möglichkeit, die Vaterschaft und damit die Unterhaltspflicht für ihre Kinder anzufechten.
Wenn ein Mann bei der Geburt seines Kindes daran zweifelt, dass er der Vater ist, ist der Fall eindeutig. Da die Mutter für sich und das Kind eine Leistung, nämlich Unterhalt, einfordert, ist sie in der Beweispflicht. Sie muss dann einem Vaterschaftstest zustimmen.
Wenn die Vaterschaft bereits anerkannt ist, kann ein Mann nur noch schwer dagegen vorgehen. Um ein Gericht zur Anordnung eines Vaterschaftstest zu veranlassen, muss er einen "konkreten Anfechtungsgrund" vorweisen können.
Als "konkrete Anfechtungsgründe" sind denkbar:
- Keine Beziehung mit der Mutter zu der Zeit, als das Kind gezeugt wurde
- Eine nachweisliche räumliche Trennung zum Zeugungszeitpunkt
- Krankheitsbedingte Unmöglichkeiten wie Hodenkrebs oder Zeugungsunfähigkeit
Äußerliche Merkmale kommen in der Regel nicht als Verdachtsmomente in Betracht. Wenn keine auffälligen Ähnlichkeiten mit dem eigenen Kind bestehen, ist dies kein zuverlässiger Hinweis darauf, dass eine Verwandtschaft ausgeschlossen ist.
Mit zwei Urteilen wies der BGH die Klagen zweier Männer ab, die heimlich Gentests hatten durchführen lassen. Sie wollten damit vor Gericht ihre Vaterschaft anfechten. Sowohl das Oberlandesgericht Thüringen als auch das Oberlandesgericht Celle ließen die Testergebnisse aber nicht als Beweis zu. Diese Auffassung wurde jetzt vom Familiensenat des BGH bestätigt.
In dem Celler Fall hatte der Mann ein Kaugummi mit Speichelresten der 1994 geborenen Tochter ins Labor gebracht - ohne Zustimmung der allein sorgeberechtigten Mutter. Ähnlich war es in dem Jenaer Verfahren: Im Jahr 2001 ließ der vermeintliche Erzeuger, der seine Vaterschaft zunächst anerkannt hatte, heimlich eine Haarprobe des 1986 geborenen Jungen untersuchen, weil dieser ihm ganz und gar nicht ähnlich gesehen habe. Die Gerichte ließen die Privatgutachten jedoch nicht zum Prozess zu und wiesen die Anfechtung der Vaterschaft ab.
Zypries verteidigt ihre Forderung nach einem Verbot
Das Urteil fällt zeitlich zusammen mit einem Vorschlag von Bundesjustizministerin Brigitte Zypries, die heimliche Vaterschaftstests unter Hinweis auf den Datenschutz verbieten will. Noch am Mittwochmorgen verteidigte sie ihre äußerst umstrittene Initiative. Es gehe um ein generelles Gesetz, das den Umgang mit genetischen Daten regele, sagte die SPD-Politikerin. "Die Gefahr besteht, dass sich jedermann leicht zu erlangendes genetisches Material besorgt und testen lässt." Das müsse verhindert werden.
Genetische Daten seien doch "das Wertvollste, das der Mensch hat", betonte Zypries. Das Gesetz sehe deshalb vor, dass genetische Untersuchungen grundsätzlich nur mit Zustimmung des Betroffenen durchgeführt werden dürften. Verstöße will Zypries unter Strafen bis zu einem Jahr Gefängnis stellen.
Im Gegenzug erwägt die Justizministerin, das Verfahren für legale Vaterschaftstest zu vereinfachen. "Möglicherweise könnte das gerichtliche Verfahren durch ein anderes ersetzt werden", sagte sie. Grundsätzlich sei Heimlichkeit im deutschen Rechtssystem ein großes Problem.