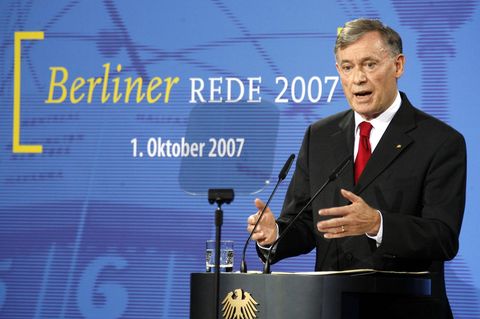Nach Kanzlerin Angela Merkel hat Arbeitsminister Franz Müntefering Bundespräsident Horst Köhler gegen Angriffe aus der großen Koalition in Schutz genommen. Köhler tue seine Pflicht, wenn er Gesetzestexte auf Verfassungsmäßigkeit überprüfe und bei Bedenken notfalls stoppe, betonte der Vizekanzler im Deutschlandfunk. Merkel hatte über einen Sprecher SPD und Union zur Mäßigung aufgerufen: "Öffentliche Belehrungen sollten doch unterbleiben."
Nach einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" ist das Regierungsbündnis bemüht, einen neuen Konflikt mit Köhler zu entschärfen. Das Innenministerium habe rechtliche Einwände gegen ein fertiges Gesetz zur Übernahme von Unterkunftskosten für Hartz-IV-Empfänger durch den Bund zu Gunsten der Kommunen. Das Vorhaben sei kritisch geprüft worden, sagte Müntefering. "Insgesamt haben wir in der Bundesregierung festgestellt: das ist vertretbar."
Kein Vermittlungsausschuss
Über das Gesetz entscheidet der Bundesrat am Freitag. Müntefering bestritt Angaben der Zeitung, wonach die Regierung für die Anrufung des Vermittlungsausschusses sei, um "mögliche Sollbruchstellen im Hinblick auf die Verfassungsmäßigkeit" zu heilen. "Ich sehe die Notwendigkeit nicht", meinte der Vizekanzler. Er rechne mit Zustimmung der Länderkammer und halte das Gesetz für "belastbar". Das Projekt sei deshalb so kompliziert, weil die Finanzverfassung direkte Zuweisungen des Bundes an die Kommunen nicht erlaube. "Entscheidend ist, dass das Geld bei den Menschen ankommt."
Köhler war in die Kritik geraten, nachdem er binnen weniger Wochen zwei Gesetze der Koalition gestoppt hatte. Politiker von Union und SPD warfen dem Staatsoberhaupt vor, Kompetenzen zu überschreiten.
Bundesländer und Bundesrat stehen dahinter
Die Bundesländer hatten zuletzt bekräftigt, weiter zu der Regelung zu stehen. Der Bundesrat selbst hatte einstimmig die unterschiedlichen Quoten empfohlen. Danach sollen die Kommunen keinen einheitlichen Bundeszuschuss von 31,8 Prozent für die Heizungs- und Unterkunftskosten der Langzeitarbeitslosen erhalten. Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz hatten für ihre Gemeinden höhere Quoten von 35,2 beziehungsweise 41,2 Prozent durchgesetzt. Die Kommunen der anderen 14 Länder sollen 31,2 Prozent erhalten. Für den Bund ändert sich dadurch nichts. Er stellt den Ländern insgesamt 4,3 Milliarden Euro bereit, die das Geld an die Kommunen weiterleiten.