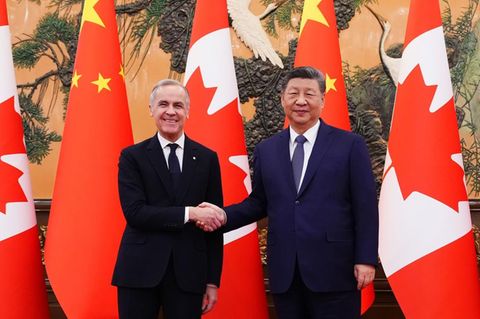Vergangene Woche zog das Nachrichtenmagazin "Newsweek" einen Bericht zurück, wonach im US-Gefangenenlager von Guantanamo auf Kuba eine Ausgabe des Koran geschändet und die Toilette heruntergespült worden sei. Inzwischen haben andere Journalisten und das Rote Kreuz die Recherchen des Magazins bestätigt. Trotzdem scheint "Newsweek" blamiert, weil der Bericht sich nur auf eine anonyme Quelle im US-Militär gestützt hatte. Wenn man nicht mehr weiß, sollte man lieber auf Veröffentlichung verzichten?
Bernstein: Auf keinen Fall. Bob Woodward und ich haben fast nur mit Informationen aus anonymen Quellen gearbeitet, als wir den Watergate-Skandal enthüllten. Der Informant, der unter dem Pseudonym "Deep Throat" berühmt wurde, war nur einer von vielen, deren Namen nie bekannt wurden. Ohne die Hilfe solcher Informanten hätten Bob und ich die Machenschaften von Präsident Nixon nie aufdecken können.
Scholl-Latour: Richtig. Mich überrascht viel mehr dabei, dass niemand in den USA gemerkt zu haben scheint, welche Brisanz die Meldung in der islamischen Welt haben würde. Den Koran die Toilette herunterspülen - das ist noch schlimmer als Abu Ghreib.
Schlimmer als die Bilder von nackten Gefangenen und feixenden US-Soldaten?
Scholl-Latour: Ja. Den Koran ins Klo - das ist so etwa das Schlimmste, was man machen kann. Der Koran hat für gläubige Muslime eine Bedeutung, die weit größer ist als die der Bibel für gläubige Christen. Er sind Gottes eigene Worte für die Ewigkeit. Man muss sich sehr gut überlegen, ob man solch einen Bericht überhaupt einfach so drucken soll.
Bernstein: Da muss ich entschieden widersprechen. Hätte das Magazin "The New Yorker" die Enthüllungsstory über den Folterskandal von Abu Ghreib etwa auch nicht drucken sollen? Nein, die Presse muss über Grausamkeiten beider Seiten berichten, einerlei, welche Folgen das haben mag. Zudem: Man kann "Newsweek" doch nicht für die Ausschreitungen und Toten verantwortlich machen. Die Meldung ist von fanatischen Klerikern ausgebeutet worden. Wir sind im Westen sicher noch weit davon entfernt, die religiösen Gefühle der Muslime zu verstehen. Aber der "Newsweek"-Fall ist ein schlechtes Beispiel dafür.
Fehlt den USA schlicht das Verständnis für die Region?
Scholl-Latour: Einige der besten Orientalisten kommen aus den USA. Die sind noch besorgter als ihre Kollegen in Europa über die Konsequenzen der US-Politik. Erst neulich stand ich in der American Academy in Berlin wieder mit ein paar von ihnen zusammen. Die wissen ganz genau darüber Bescheid, was im Irak vor sich geht.
Bernstein: Speziell in der Politik gegenüber muslimischen Ländern zeigt Bush eine Tendenz, einfache Antworten für sehr komplexe Probleme zu suchen. Sein Krieg gegen den Terrorismus ist das beste Beispiel. Ein Teil der Menschen in meinem Land folgt Bush in seiner schlichten Aufteilung der Welt in Gut und Böse. Aber es gibt auch viele Amerikaner, die ganz anderer Ansicht sind. Das wird in Europa oft übersehen.
Sind daran unsere Medien schuld?
Bernstein: Ich habe den Eindruck, dass zu oft anti-amerikanische Vorurteile die europäische Berichterstattung über die USA beeinflussen. Die europäischen Medien haben eine Tendenz, ihren Berichten immer gleich die Wertung mitzugeben, die sie für richtig halten, statt die Fakten für sich sprechen zu lassen.
Ist Amerikas Presse weniger voreingenommen als die europäische?
Scholl-Latour: Ich finde es viel schlimmer, dass eine Regierung wie von George Bush versucht, massiv auf die Berichterstattung Einfluss zu nehmen und kritische Journalisten zu behindern.
Bernstein: Das sehe ich nicht so. Wir haben ein ganz anderes Problem: Die wachsende Sensationsgier der US-Medien führt dazu, dass es fast keine angemessene Berichterstattung mehr gibt. Statt ihr Publikum über die Lage im Irak und andere wirklich wichtige Dinge zu informieren, kümmern sich unsere Medien lieber um Klatsch und Tratsch. Ich habe diese Entwicklung einmal als "Triumph der Idiotenkultur" bezeichnet.
Scholl-Latour: Eine ähnliche Entwicklung sehe ich auch bei uns. Als ich anfing, gab es nur die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender. Seit die mit den privaten Sendern konkurrieren müssen, ist der Platz für seriöse Berichterstattung kleiner geworden. Eine solche Entwicklung kann Politikern wie Bush doch nur recht sein. Wären die Wähler besser informiert, hätten solche Regierungen womöglich mehr Probleme, wiedergewählt zu werden.
Bernstein: Da bin ich mir nicht so sicher. Jedenfalls liegt die Schuld für den Niedergang des kritischen Journalismus in den USA nicht bei Bush.
Was sollten Journalisten tun, um sich gegen Gefahren für die kritische Berichterstattung zu wehren?
Bernstein: Egal worüber man berichtet: Man hat immer mit Leuten zu tun, die versuchen, die Presse vor ihren Karren zu spannen. Wir Journalisten sollten versuchen, unseren Job zu machen. Und der besteht darin, der Wahrheit so nahe wie möglich zu kommen. Wenn wir zulassen, dass uns Regierungen oder ihre Gegner einschüchtern, dann machen wir unseren Job nicht anständig. Manche Kollegen lassen sich wohl auch deshalb leichter einschüchtern, weil sie weniger Kenntnis der Länder haben, über die sie berichten. US-Fernsehsender kaufen häufig nur noch das Filmmaterial der Nachrichtenagenturen und lassen im fernen New York einen Redakteur, der nie vor Ort gewesen ist, dazu einen Text verfassen.
Scholl-Latour: In einer Zeit, in der wir im Westen die Folgen der meisten Kriege nicht mehr zu spüren bekommen, ist es wichtiger denn je, dass Journalisten sich vor Ort ein Bild machen. Nur so erfährt man, was wirklich vor sich geht. Zum Beispiel im Irak. Da denken viele bei uns immer noch, die irakischen Wahlen vom Januar seien ein Sieg der amerikanischen Demokratie, weil sie glaubten, die Amerikaner hätten dem Irak die Freiheit sozusagen aufgezwungen. Das ist natürlich Unsinn. Es war der schiitische Ayatollah Sistani, der den Amerikanern die Wahlen und den Wahltermin aufgezwungen hatte. Er wusste genau: Mit einer Bevölkerungsmehrheit von 65 Prozent würden die Schiiten als klare Sieger hervorgehen. Aber bei uns berichten alle so, als seien die Amerikaner die Initiatoren.
Sie beide blicken auf erfolgreiche Karrieren als Reporter zurück und hatten schon früh großen Erfolg. Glauben Sie, Sie könnten noch einmal denselben Weg gehen, würden Sie heute als junge Reporter beginnen?
Bernstein: Ein Kollege von der "New York Times", Anthony Lewis, sagte neulich zu mir, er glaube nicht, dass heute zwei 29-jährige Redakteure eine Geschichte wie Watergate enthüllen könnten. "Das würde doch niemand drucken", sagte er. Ich bin Optimist. Chefredakteure wollen gute Geschichten - damals wie heute. Wahr ist: Reporter haben heute viel mehr mit Problemen wie der politischen Linie der Verleger und der Sensationsgier vieler Medienmacher zu kämpfen. Aber im Kern ist die Aufgabe des Reporters dieselbe geblieben: Gehe raus und besorge dir die Fakten.
Scholl-Latour: Als ich 1965 kritisch aus Vietnam berichtete, hat sich das Außenministerium bei meinem Sender, dem Westdeutschen Rundfunk, über mich beschwert. Drei Stunden hat mich der Intendant Klaus von Bismarck damals ins Gebet genommen. Dann ließ er mich weitermachen. Das wäre heute wohl kaum mehr so. Die Stimmung ist heute politisch so viel aufgeheizter als vor 40 Jahren, dass Verantwortliche sich scheuen, Reporter loszuschicken, die schon unangenehm aufgefallen sind.