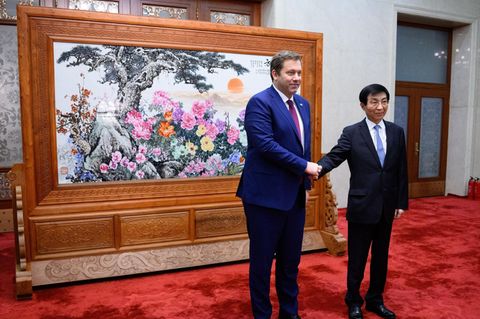Neulich in Berlin. Der Seeheimer Kreis feiert sein 50. Jubiläum im schicken Allianz Forum am Brandenburger Tor. Es gibt Popcorn, den Kanzler und einen kämpferischen Geburtstagsgruß des Parteivorsitzenden. "Wir machen uns nicht klein als Sozialdemokratie", ruft Lars Klingbeil von der Bühne, "wir sind stolz auf das, was wir geleistet haben."
Klingbeil gibt sich selbstbewusst – und freundlich. Zum Jubiläum hat er eine Torte mitgebracht. Dabei wirkt es dieser Tage so, als bekäme er von den Genossen zuweilen selbst eine ins Gesicht.
Mal ein paar Beispiele: In Sachen Russlandpolitik wird sein Versuch einer Kurskorrektur kurzerhand ins Gegenteil verkehrt. Verdiente Sozialdemokraten verlassen die Politik, fühlen sich von der SPD allein gelassen. Inhaltliche Impulse gehen unter – wie Klingbeils Pläne für den Wirtschaftsaufschwung. Nicht mitbekommen oder schon vergessen? Ganz genau.
Klar, Klingbeil ist nicht allein an der Spitze der SPD, Saskia Esken ist auch noch da. Aber er hat den größeren Ehrgeiz, die Partei neu zu positionieren, den Laden zusammenhalten. Deshalb steht auch er nun im Fokus. An der Lage der SPD verändert sich gerade wenig: Der Kanzler unbeliebt, die Partei nervös – für Lars Klingbeil läuft es so la la. Was ist da los?
Lars Klingbeil und die Sowohl-als-auch-Strategie
Klingbeil war es, der seiner Partei nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine ein drastische Kurskorrektur verordnet hatte. Sicher auch, um den Ruf einer unverbesserlichen Appeasement-Partei abzuschütteln. Deutschland müsse den Anspruch einer "Führungsmacht" haben, schlussfolgerte der Parteichef im Sommer 2022, nun müsse die Sicherheit vor und nicht mit Russland organisiert werden, forderte er wenige Monate später. Klare Ansagen, die an den bis dahin geltenden Grundsätzen der Genossen rüttelten und auch Widerspruch provozierten. Er fand das gut. Klingbeil hielt die Aufarbeitung der Russlandpolitik für notwendig.
Nur hat sich der Kursschwenk als nicht besonders nachhaltig erwiesen. Rolf Mützenich, der SPD-Fraktionschef, hat den versuchten Mentalitätswandel mit einer bemerkenswerten Überlegung konterkariert. "Ist es nicht an der Zeit", fragte Mützenich kürzlich im Bundestag, "dass wir nicht nur darüber reden, wie man einen Krieg führt, sondern auch darüber nachdenken, wie man einen Krieg einfrieren und später auch beenden kann? Geht es nicht politisch auch um diese Fragen?"
Der offenbar wohlplatzierte Friedensakzent sorgte für Kopfschütteln bei den Koalitionspartnern, löste aber Begeisterung bei den Sozialdemokraten aus. Viele von ihnen empfinden Mützenichs neuen Sound als eine Art Befreiungsschlag – weniger den Ton des Parteivorsitzenden. Die SPD, die alte neue Friedenspartei. Solidarisch mit der Ukraine, aber auch über den Tag hinausdenkend. Ende des Krieges, einfrieren der Front. Frieden, vielleicht.
Klingbeils Antwort: Ein Dreiklang, der irgendwie alle abholen soll – und dabei eins vermissen lässt: Klarheit. Russland müsse aus den besetzten Gebieten verschwinden, die Ukraine umfassend und langfristig unterstützt werden, aber auch eine Debatte über Friedensszenarien möglich sein. So sagte es Klingbeil, grob zusammengefasst, nun dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Es ist eine Sowohl-als-auch-Strategie, mit der Klingbeil die erregte Debatte kaum wird abräumen können, die gerade alles überschattet. Und mit der er den Eindruck erweckt, als sei auch ihm das Friedensmantra aufgezwungen worden.
Mützenich konterkariert den Kurs des Parteichefs
Vielleicht ist das Klingbeils Problem: Er wollte eine Kurskorrektur in der Russlandpolitik, dabei aber nicht den Kanzler einengen. Also formuliert er seine Sicht seit zwei Jahren eher dosiert. Jetzt, in der Krise, haben manche den Eindruck, als verschwinde die SPD hinter dem Kanzleramt. In dieses Gefühl stieß Mützenich. Auch deshalb dürfte sein Akzent die Genossen so aufgerüttelt haben.
Das hat Kollateralschäden für Klingbeil. Nur einen Tag nach Mützenichs Zehn-Minuten-Manöver im Parlament traf sich der Parteivorstand zur zweitägigen Klausurtagung. Dabei wurde unter anderem ein Zehn-Punkte-Plan für die Wirtschaft beschlossen. Doch was als großer Aufschlag des Chefs gedacht war, der die Partei auch für die Bundestagswahl positionieren soll, wurde von der breiten Öffentlichkeit kaum notiert. Die großen Schlagzeilen schrieb der neue Ukraine-Sound.
Die Frage von Krieg und Frieden hat in der SPD für eine neue Härte gesorgt – sagt einer, der es wissen muss. Michael Roth, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, hat sich von seiner Partei distanziert. Oder sie von ihm? "Mein früher Einsatz für die Ukraine gefiel nicht allen", sagt er nun im großen stern-Gespräch. Er habe immer mehr mit den Parteisitzungen gefremdelt, einer frostigen Stimmung. "Manchmal fühlte ich mich wie ein Fremdkörper", sagt Roth. Zur nächsten Bundestagswahl will der langjährige Abgeordnete nicht mehr kandidieren.
"Es hängt alles am Kanzler"
Damit verliert die Partei nicht nur einen profilierten Außenpolitiker, sondern Co-Chef Klingbeil auch einen, der in Sachen Russlandpolitik ähnlich tickte wie er. Roth stand nie in Verdacht, dem Kreml auch nur einen Millimeter entgegenkommen zu wollen. Ganz im Gegenteil. Vielleicht wurde er beim Parteitag im Dezember auch deswegen nicht erneut in den SPD-Vorstand gewählt, von seinen Genossen abgestraft. Nun macht er Schluss – offenkundig auch, weil er sich von der SPD und ihrem Umgang mit dem Kanzler entfremdet hat. "Sowohl Partei als auch Fraktion haben sich ihm faktisch untergeordnet. Es hängt alles am Kanzler", kritisiert Roth.
Als unbequeme Einzelmeinung versucht man Roths Einlassungen in der Parteispitze kleinzureden. Allerdings: Auch Boris Pistorius, der Verteidigungsminister, macht deutlich, dass er dem Gedankenspiel vom "Einfrieren" des Kriegs nicht viel abgewinnen kann. Und auch namhafte Historiker, die selbst SPD-Mitglieder sind, gehen plötzlich auf Distanz. Ihre ungewöhnlich scharfe Kritik dürfte natürlich auch an Klingbeil adressiert sein. Er ist der Chef.
In einem Brief an den Parteivorstand werfen die Osteuropa-Wissenschaftler der SPD-Spitze eine Realitätsverweigerung im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine vor. Besonders die jüngsten Äußerungen des SPD-Fraktionschefs Mützenich seien "fatal", zitiert etwa "Table.Briefings" aus dem Schreiben, würden sie "faktisch eine Beendigung zugunsten des Angreifers bedeuten". Der Schlüsselsatz, für Klingbeil: In der SPD fehle eine "ehrliche Aufarbeitung der Fehler in der Russlandpolitik der letzten Jahrzehnte".
Was die Historiker da schreiben, lässt sich eigentlich nur so verstehen: Die Mission des Co-Chefs, sie ist gescheitert.