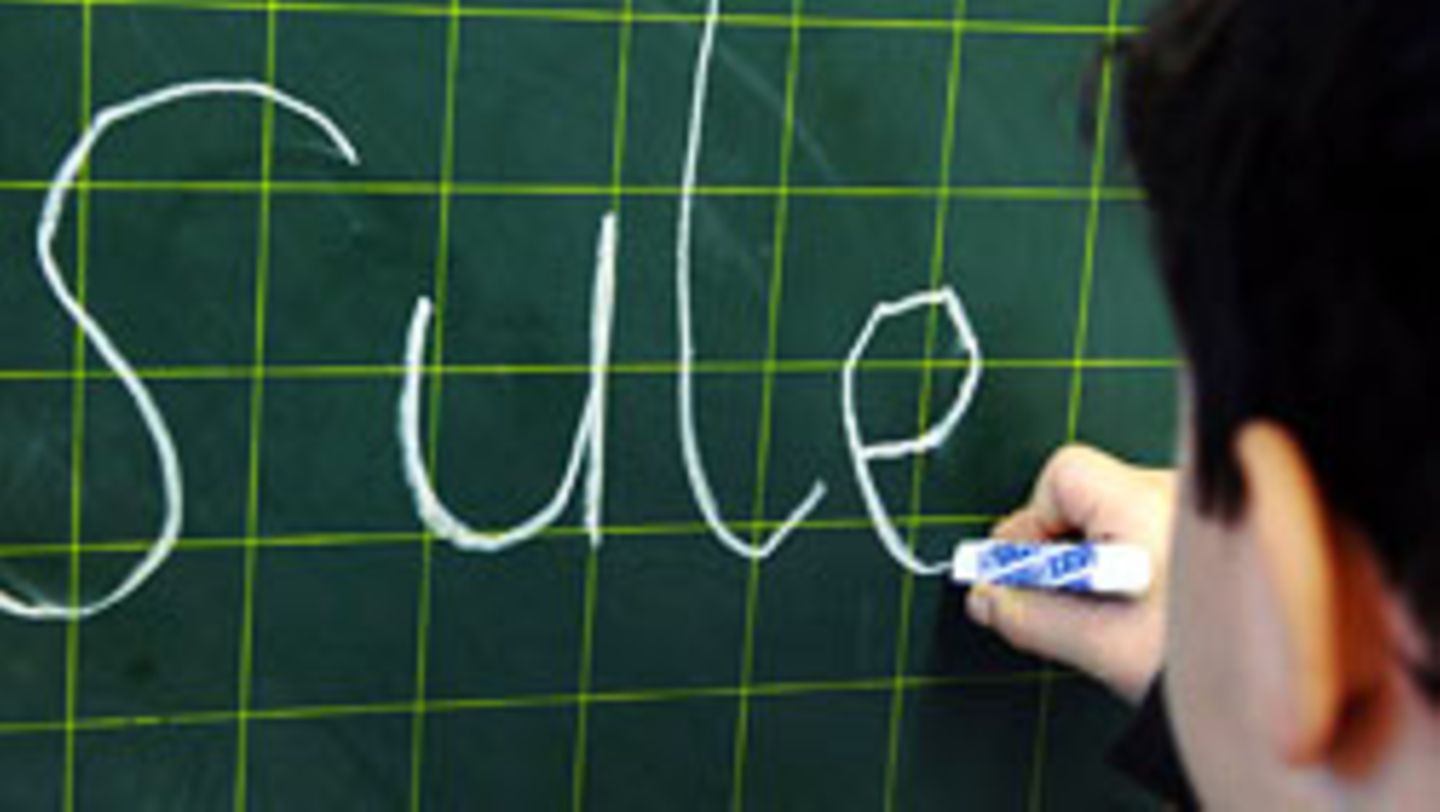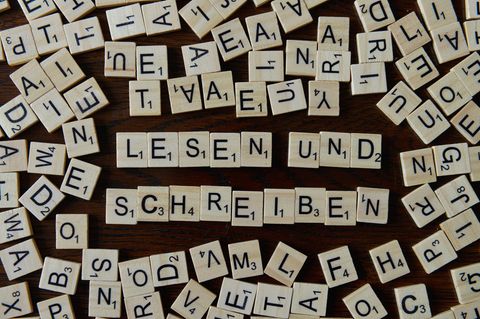Matthias sitzt am Küchentisch und knipst wütend auf seinem Kugelschreiber herum. Der Lehrer sei "ein Arschloch", sagt er. "Der hat mich auf dem Kieker." Der Kugelschreiber fliegt gegen die Wand. Frühjahr 2008. Matthias steht kurz vor den Abschlussprüfungen an der Hauptschule. "Ich mache gut mit", versichert der Hauptschüler aus einer Gemeinde bei Ulm. "Aber meinem Lehrer kann ich nichts recht machen." Die Mutter sagt, Matthias hasse seinen Klassenlehrer. "Manchmal mag er ihn auch", schiebt sie entschuldigend nach.
Die Version des Klassenlehrers hört sich so an: Matthias sei "deutlich und oft" frech, vorlaut und rechthaberisch. Er beschimpfe Mitschülerinnen und provoziere in letzter Zeit auch noch durch rechtsradikales Gehabe. Dabei sei der Junge durchaus begabt, habe ein "überdurchschnittliches Allgemeinwissen" und arbeite gut mit. "Wenn er will."
Kein seltener Störfall
Matthias ist der Alptraum seiner Lehrer. Er schafft es, den Unterricht lahm zu legen und seine Lehrer an den Rand der Verzweiflung zu treiben. Er leidet am Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, kurz ADHS, bekannt als Zappelphilipp-Krankheit und hat zudem eine Leserechtschreibstörung, kurz LRS. Damit ist er ein doppelter, aber keineswegs seltener Störfall im Klassenzimmer.
In fast jeder Klasse sitzen Kinder mit Lernproblemen, die so schwer sind, dass sie sich nicht allein mit Nachhilfe beheben lassen. Fünf Prozent der Schüler haben eine Lese-Rechtschreibstörung sagt Annette Höinghaus vom Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie. Weitere fünf Prozent leiden an einer Rechenstörung. Bei zehn Prozent der Schulkinder gibt es Hinweise auf ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Sie können sich nicht konzentrieren, werden schnell nervös, vergessen das Erlernte gleich wieder. Doch wie wird ihnen in der Schule geholfen? Selten, sagt Annette Höinghaus, die selbst Mutter von zwei betroffenen Kindern ist: "Die meisten Lehrer machen davor die Augen zu."
"Polizit" statt Polizist
Schon zu Beginn der zweiten Klasse fiel Matthias' Mutter auf, dass sich ihr Sohn an Silben abschuftete, als säße er im Steinbruch. Es fiel ihm schwer, Laute zu unterscheiden und beim Niederschreiben dem richtigen Wortbild zuzuordnen. Noch in der fünften Klasse schrieb er "Polizit" statt Polizist und "Fermilie" statt Familie.
"Ich weiß nicht, woher das kommt", sagt Matthias zuhause am Küchentisch. Tatsächlich forscht die Wissenschaft noch, wie die Sprache im Kopf dieser Kinder verarbeitet wird. Eine neurologische Störung steckt dahinter, so viel steht fest, als deren Ursache ein Gendefekt vermutet wird. Legasthenie gilt als nicht heilbar. Aber mit Geduld und einem speziellen Training lässt sich das Problem bessern.
Mehr Üben half nicht
Mehr Üben, riet die Lehrerin in der Grundschule der Mutter von Matthias. Doch das half nicht. Ganze Nachmittage saß seine Mutter neben dem Achtjährigen und sie paukten Diktate, "bis Tränen flossen, bei ihm und bei mir." Schrieb Matthias ein Wort richtig, hatte er es am nächsten Morgen vergessen. Der Junge leide unter einer Lese-Rechtschreibstörung, fanden die Ärzte am Kinderklinikum in Memmingen heraus, er brauche dringend eine gezielte Fördertherapie.
Doch wie? "Ich habe für jedes Kind pro Schulstunde maximal eine Minute Zeit", beschied die Grundschullehrerin der allein erziehenden Mutter. Wie könne sie da Matthias helfen? Besser wäre es, Matthias ginge auf eine Sonderschule. Verunsichert stimmte seine Mutter zu. "Das war ein Riesenfehler", sagt sie heute. Tatsächlich verbesserte sich Matthias anfangs. Dann aber langweilte er sich. "Das war viel zu leicht für mich", sagt der schlaksige Junge mit der Igelfrisur. "Ich hab nicht da hingepasst, und dann baust du nur noch Scheiße." Matthias, hatten auch die Memminger Ärzte bescheinigt, sei eigentlich kein Kind für die Sonderschule. Doch er blieb. Drei Jahre lang. Und schämte sich. Als der Zweitklässler im Fußballtraining des Dorfvereins gefragt wurde, welche Schule er besuche, kam er nie wieder zum Kicken.
40.000 Schüler scheitern jährlich
Zwar sollte - notorische Forderung der Pisa-Forscher - jedes Kind nach seinem Können maßgeschneidert gefördert werden. Doch tatsächlich sei das Gegenteil der Fall, sagen betroffene Eltern. Der Druck in den Klassenzimmern wächst bei allen Kindern, erst recht bei denen mit einer Lernstörung. Wer das Handwerkszeug nicht beherrscht, fliegt raus, manchmal schon in der zweiten Klasse wie Matthias. Spätestens aber, wenn es in die weiterführende Schule geht. Der Legasthenie-Verband schätzt, dass jedes Jahr etwa 40.000 Kinder mit einer Legasthenie in der Schule scheitern, obwohl sie die Intelligenz hätten, das Abitur zu machen.
Auch der zehnjährige Niklas aus Hildesheim ist Legastheniker - und zugleich hochbegabt. Die Lehrer seien "lieb und nett," sagt seine Mutter, "aber sie verwenden ihre Kraft eher auf die sozialen Störfälle in der Klasse." Das Problem des ruhigen Niklas fiel erst in der dritten Klasse auf, als er immer noch viele Schreibfehler machte, "Delefun" statt Telefon schrieb, ganze Wörter und die Interpunktion vergaß.
Therapeutin soll helfen
Was andere Kinder intuitiv erlernen, muss Niklas pauken. "Er hat kein Sprachgefühl, er muss sich alles logisch über Regeln erschließen", sagt seine Mutter. Weil er in Deutsch die Note vier hatte, bekam er eine Hauptschulempfehlung - Hochbegabung hin oder hier. Doch seine Eltern, sie Erzieherin, er Sozialpädagoge, wollen ihren Sohn nicht auf die Hauptschule schicken. Eine Therapeutin soll Niklas helfen.
Bei Matthias versuchte es der Klassenlehrer an der Hauptschule vor allem mit Ermahnungen. Er fühlte sich mit Matthias "ein bisschen überfordert", räumt er ein. "Das ist Willenssache bei ihm." Spezielle Schreib- und Sprechübungen wären für den Jungen gewiss sinnvoll gewesen, sagt er. Aber die gebe es in den höheren Klassen nicht mehr. In seiner Abschlussklasse, 18 Schüler, sitze auch ein Junge mit einer noch stärkeren Legasthenie, dazu einer mit einer Rechenschwäche und etliche Schüler mit Erziehungsproblemen, erzählt er. "Allen helfen, das wäre ideal, aber dazu hat man einfach nicht die Zeit."
Schwierige Diagnose
Nur etwa ein Prozent der Lehrer bilde sich fort und könne bei einer Lernstörung wirklich helfen, sagt Annette Höinghaus vom Legasthenieverband. Die Mehrheit der Lehrer fühle sich überfordert, verdränge oder beschönige das Problem. "Man weiß ja nicht genau, was das sein soll, Legasthenie," sagt der Klassenlehrer von Matthias. "Die Diagnose ist schwierig, da können auch andere Faktoren eine Rolle spielen." Angebote zur Fortbildung gebe es schon, "aber die Fahrtzeiten sind zu lang." Er informiere sich aus der Literatur und spreche mit Kollegen.
Viele Lehrer würden den Eltern die Schuld zu schieben, kritisiert Klaus Fritze aus Reutlingen, Vater eines Zwölfjährigen, "weil man angeblich zu wenig vorgelesen hat oder beide Eltern berufstätig sind". Manche halten die Kinder für faul oder unwillig, lassen sie schon mal unter dem Gefeixe der Klasse Vokabeln an die Tafel schreiben.
80 Prozent weniger Fehler
Dabei lässt sich tatsächlich etwas gegen Legasthenie tun. Mindestens drei Programme gelten als wissenschaftlich abgesichert, eins davon wird seit Jahren an Schulen in Mecklenburg-Vorpommern angewandt. Beim Rostocker Lese-Rechtschreibtraining, das der Sprachlehrer Hans-Joachim Kossow entwickelt hat, zerlegen Lehrer und Kinder jedes Wort in seine Bestandteile. Das Programm gilt als sehr effizient: Nach vier Monaten in einer speziellen Trainingsklasse kehren die Kinder in ihre Klassen zurück - und machen fast 80 Prozent weniger Fehler, fanden Forscher der Universität München heraus. Mecklenburg-Vorpommern schickt deshalb einen Teil seiner Lehrer zur Fortbildung, ist damit aber immer noch eine Ausnahme. Weiterbildung ist in den meisten Bundesländern keine Pflicht, wird nicht bezahlt und findet oft samstags oder in den Ferien statt. Keine verlockenden Aussichten für Pädagogen. Nicht jeder Lehrer muss gleich ein Spezialist sein. Oft helfen schon ein gut strukturierter Unterricht und übersichtliche Aufgabenblätter statt einem Haufen Kleingedrucktem, sagt die Hildesheimer Legasthenie-Therapeutin Kerstin von Werder. Vor allem aber helfe: eine "wohlwollende Haltung." Pauker dagegen, die mit "altbackenen Methoden" unterrichteten, hätten weniger Erfolg als solche, die moderne Unterrichtsformen wählten, sagt Ada Sasse, Professorin für Grundschulpädagogik an der Humboldt-Universität Berlin. "Oft," so ihr Fazit, "ist nicht das Kind lernbehindert, sondern der Lehrer lehrbehindert."