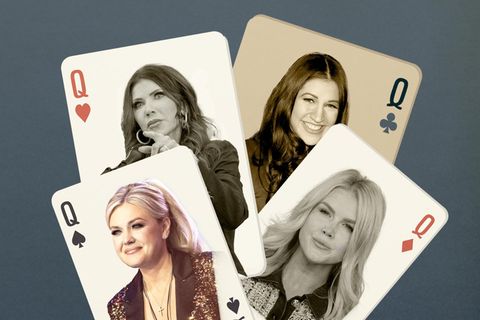Fast scheint es, als hätten die rechtsextremistischen Aufzüge der vergangenen Jahre eines erreicht: Die eindrucksvolle Geschichte der Versammlungsfreiheit, die vom Hambacher Fest von 1832 über die Studentenproteste der 68er bis zu den Montagsdemonstrationen in der DDR reicht, gerät langsam in Vergessenheit. Stattdessen wird die Sicht auf das edle Freiheitsrecht dadurch getrübt, dass Feinde der Freiheit es zu Provokationen in Anspruch nehmen. Kein Wunder also, dass der Ruf nach seiner Beschränkung laut wird.
Gigantische Quote
Allerdings soll die von Bundesinnenminister Otto Schily (SPD) geplante Verschärfung offenbar eher vorsichtig ausfallen - was angesichts der strikt liberalen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ein Zeichen politischer Klugheit ist. Eilanträge von Rechtsextremisten gegen allzu forsche Demonstrationsverbote sind in Karlsruhe in den vergangenen Jahren in fast einem Drittel der Fälle positiv beschieden worden - eine gigantische Quote, gemessen an nicht einmal drei Prozent erfolgreicher Verfassungsbeschwerden.
Verfassungsrichter Wolfgang Hoffmann-Riem, beim Thema Versammlungsfreiheit federführend im Karlsruher Gericht, formulierte seine Leitlinie in der "Neuen Juristischen Wochenschrift" kürzlich so: "Der Schutz des Grundrechts gilt für alle Versammlungen, und zwar ohne inhaltliche Bewertung des Anliegens oder gar seiner gesellschaftlichen Wünschbarkeit." Wobei er sich durchaus bewusst ist, dass die Gerichte hier vor der prekären Aufgabe stehen, "ein Freiheitsrecht zum Schutz für Ewig-Gestrige, für Verherrlicher von Hess und Hitler realisieren zu helfen".
Dass für Neonazis die gleiche Freiheit gelten soll wie für andere Demonstranten, hat freilich auch in der Justiz zu einer scharfen Kontroverse geführt. Vor allem das Oberverwaltungsgericht Münster bezichtigte die Karlsruher Kollegen, den Charakter des Grundgesetzes als Antwort auf die Barbarei der Nazis zu verkennen und die Wehrhaftigkeit der Demokratie zu schwächen.
Behörden können provokative Kundgebungen einschränken
Doch so apodiktisch ist Karlsruhe gar nicht. "Schutz besteht grundsätzlich auch für Versammlungen von Rechtsextremisten", schreibt Hoffmann-Riem - doch er fügt hinzu: "Aber nicht unbegrenzt." Vergangenes Jahr umriss das Gericht die Grenzen so: Die Behörden können aggressive und provokative Kundgebungen einschränken, "durch die ein Klima der Gewaltdemonstration und potenzieller Gewaltbereitschaft erzeugt wird". 2001 untersagte Karlsruhe einen rechtsextremistischen Aufzug am Holocaust-Gedenktag - unter Hinweis auf den Symbolgehalt des Gedenktages.
Daraus kann Schily Honig saugen. Sein Vorhaben, Neonazi-Aufzüge vor Gedenkstätten wie dem Holocaust-Mahnmal zu verhindern, gründet ebenfalls auf der Erinnerung an die Nazi-Opfer. Auch die beabsichtigte Erleichterung von Verboten, wenn bei Kundgebungen erkennbar eine Verherrlichung oder Verharmlosung der Nazigewaltherrschaft zu erwarten ist, dient eher der Klarstellung des geltenden Rechts: Volksverhetzung oder die Präsentation von Nazisymbolen sind strafbar - daran ändert auch die Versammlungsfreiheit nichts.
"Selbstbestimmungsrecht" Teil der Versammlungsfreiheit
Die weitergehende Forderung aus der Opposition, Neonazis möglichst vom Brandenburger Tor fern zu halten, dürfte dagegen problematisch sein. Ein eindeutiger Symbolgehalt wird dem Ort angesichts seiner wechselvollen Geschichte kaum zukommen. Bereits im Brokdorf-Beschluss von 1985 hatte das Gericht unmissverständlich klargestellt, dass zur Versammlungsfreiheit auch das "Selbstbestimmungsrecht über Ort, Zeitpunkt, Art und Inhalt der Veranstaltung" gehört.
"Kein Schutz der Freiheit für die Gegner der Freiheit" - Hoffmann-Riem erinnert seine Kritiker, die dieses Wort im Munde führen, an dessen Ursprung: Es wurde geäußert von Saint Just - auf dem Höhepunkt des jakobinischen Terrors in den 1790er Jahren.