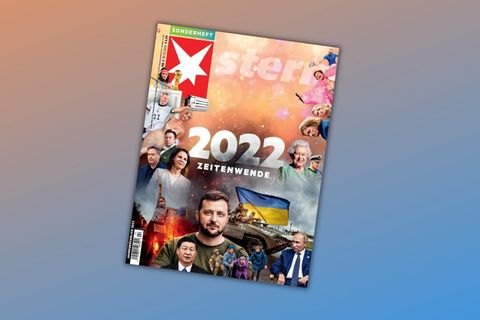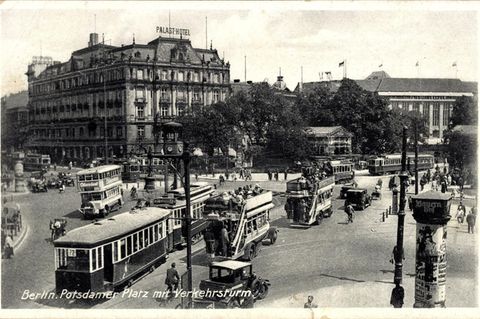Die dramatischen Ereignisse der Tage um den 17. Juni 1953 in der DDR haben nicht nur die SED-Funktionäre verstört, sondern auch die Schriftsteller und Künstler irritiert und teilweise überfordert. Das zeigen die Reaktionen von Bertolt Brecht, Thomas Mann oder Stefan Heym. Er schrieb später darüber sogar einen - in der DDR "wegen seiner völlig falschen Darstellung der Ereignisse" nie erschienenen - Roman mit dem Titel "Der Tag X", geändert in "5 Tage im Juni". Wie naiv selbst Thomas Mann auf die Ereignisse reagieren konnte, belegt seine Tagebucheintragung über die "Arbeiter-Revolte" in Ost-Berlin, "von russischen Truppen schonend niedergehalten, Panzer und Schüsse in die Luft".
Verheerende Folgen
Kulturpolitisch hatte der Aufstand verheerende Folgen, denn das Trauma wurde gezielt lange Zeit auch gegen Künstler und Schriftsteller erfolgreich einschüchternd eingesetzt. Nach dem 17. Juni wurden wie in der Wirtschaftspolitik Fehler vorübergehend korrigiert, die Zügel etwas lockerer gehalten, nach dem Ungarn-Aufstand 1956 aber wieder angezogen, nach dem Mauerbau 1961 in Berlin wieder gelockert und 1965 nach "zersetzenden" Filmen, Büchern und Theaterstücken mit einer ganzen "Verbots-Orgie" wieder angezogen ("Spur der Steine").
1971 nach Erich Honeckers Machtantritt schien es den Künstlern wieder einmal etwas besser zu gehen, weil es laut Honecker "keine Tabus" geben sollte. Wie ernst das gemeint war, zeigte er mit dem Rausschmiss des widerborstigen Liedermachers Wolf Biermann 1976, der allerdings einen heftigen künstlerischen Aderlass zur Folge hatte.
Gängelung durch Partei und Regierung
Die Probleme waren über 40 Jahre immer dieselben und wurden schon in vertraulichen Dokumenten der damaligen (Ost-) Deutschen Akademie der Künste (der späteren Akademie der Künste der DDR) beim Namen genannt: Die Unzufriedenheit der Schriftsteller und Künstler über die Gängelung durch Partei und Regierung.
So heißt es in Akademie-Protokollen vom 16. Januar 1953, also noch vor den Ereignissen am 17. Juni, unter anderem: "Bertolt Brecht wehrt sich gegen bürokratische Behandlung durch die Kunstkommission", die Tänzerin Palucca sei "schwer verstimmt", weil man sie als Fachkraft nicht schätze und der Komponist (unter anderem der DDR-Nationalhymne) Hanns Eisler sei "vollkommen erschlagen" wegen Bemerkungen im SED-Zentralorgan "Neues Deutschland" und wolle sich zurückziehen.
Brecht war tief zerrissen
Der Maler Otto Nagel äußert "zeitweise eine tiefe Depression, die ihre Ursache in einer Verständnislosigkeit, wie er es ausdrückt, für Kunst und Künstler hat". Und Heym, der sich in jenen historischen Junitagen seiner eigenen Erinnerung nach empört über "diese Arbeiter, diese Partei, diese Gewerkschaften, diesen Verband, überhaupt über die Deutschen", wird in seiner 1988 erschienenen Autobiografie ("Nachruf") seine "Politische Publizistik" mit dem Titel "Stalin verlässt den Raum" eine "Abrechnung mit dem einstigen Idol und der eigenen Verblendung" nennen.
Auch nach dem 17. Juni, der zunächst eine deutliche Verunsicherung im SED-Apparat auch gegenüber den Künstlern verursachte und zur Bildung eines eigenen Kulturministeriums mit Johannes R. Becher an der Spitze führte, wurde es nicht viel besser. Brecht, der in seinen Notizen die "Richtungslosigkeit und jämmerliche Hilflosigkeit" der Arbeiterrevolte beklagte, war tief zerrissen. Einerseits notierte er in seinem Arbeitsjournal "Der 17. Juni hat die ganze Existenz verfremdet", andererseits schrieb er dem SED-Chef Walter Ulbricht noch am 17. Juni eine Ergebenheitsadresse.
Loest saß sieben Jahre im Zuchthaus
Brechts Art einer "inneren Opposition" jedenfalls war, wie Weggefährten damals meinten, mit einem einzigen "Faustschlag", wie er den Arbeiteraufstand auch nannte, zu einer grotesken Illusion geworden. Günter Grass schrieb darüber ein 1966 uraufgeführtes Parabel-Stück "Die Plebejer proben den Aufstand", ein "deutsches Trauerspiel", das die Haltung vieler Dichter und Intellektueller widerspiegelt, die vor der politischen Wirklichkeit zurückschrecken.
Der große alte Mann des frühen politischen Avantgarde-Theaters, Erwin Piscator, war verstört über den 17. Juni und forschte in seinem Tagebuch vergeblich nach den "Ursachen der Berliner Tage", erkannte aber: "Den Wissenschaftlern und Künstlern verschwimmen die Ziele." Realistischer sah das im Juni 1953 der damals von Erich Loest geführte Leipziger Schriftstellerverband in einer Resolution: "Wir wehren uns gegen unwahre, lückenhafte und beschönigende Information" heißt es da - eine Forderung wie sie wörtlich im "deutschen Herbst" 1989 wieder auf die Tagesordnung kam. Für Loest ("Völkerschlachtdenkmal") kam das zu spät - er saß sieben Jahre im Zuchthaus Bautzen.