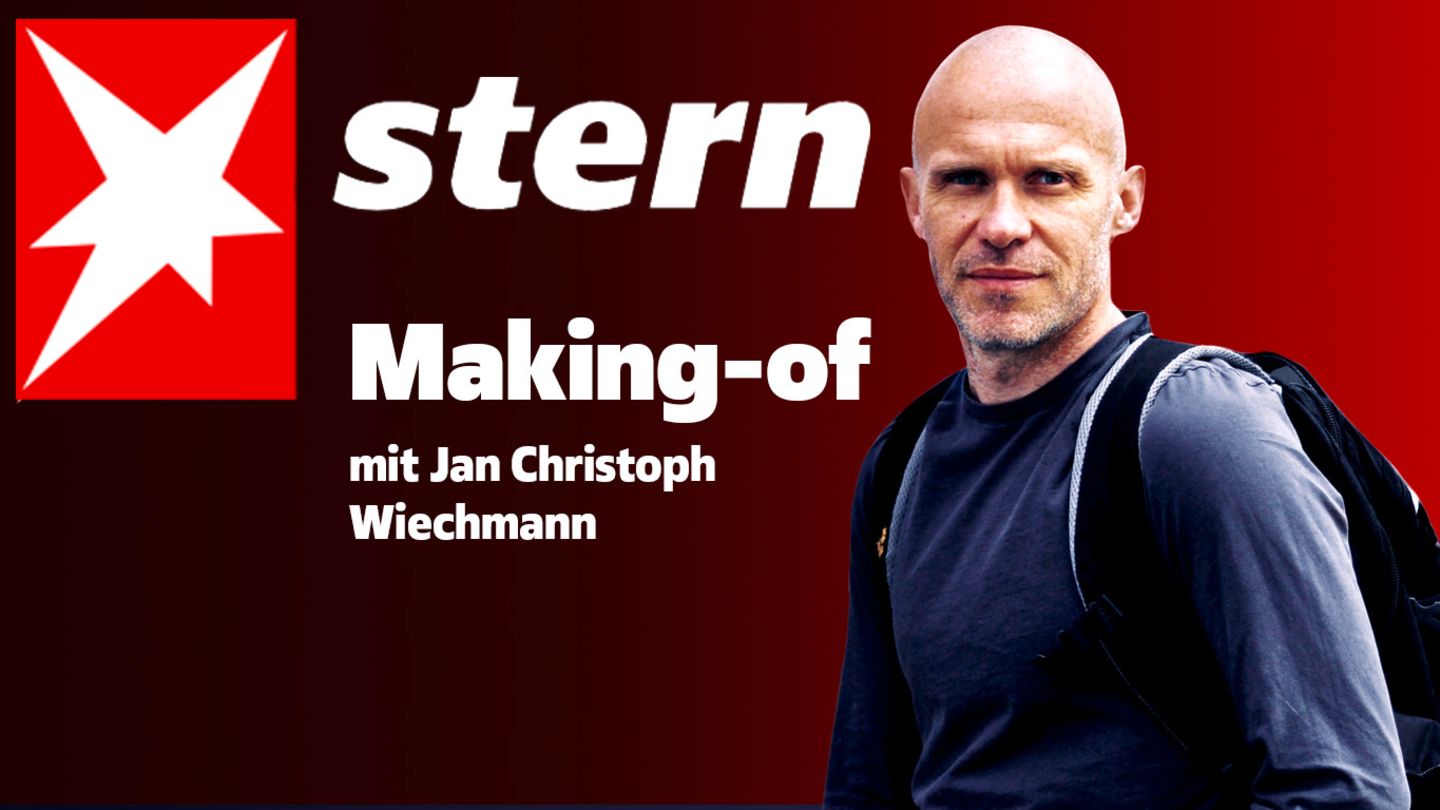Making-of heißt unser neues Format. Wir wollen Ihnen einen persönlichen Blick hinter die Kulissen ermöglichen, aus unserem journalistischen Alltag erzählen und von unseren Recherchen. Wir beginnen mit einer kleinen Serie, in der wir auf unsere Momente des Jahres 2023 zurückblicken.
Ich war schon sieben Tage im Stadtteil Kensington in Philadelphia, dem Brennpunkt der Fentanyl-Epidemie in den USA, als es an einem Kiosk auf der Allegheny Avenue zu einer etwas unheimlichen Begegnung kam. Drei Drogendealer, von denen es einige hundert in Kensington gibt, fragten mich: "Was willst du hier?"
"Ich rede mit den Menschen", sagte ich.
"Worüber?"
"Über das Leben in Kensington, für ein Magazin aus Deutschland."
Eigentlich hätte ich antworten sollen: Über die vielen Opfer dieser furchtbaren Drogenepidemie. Sie sterben vor euren Augen und ihr verkauft ihnen noch den Todesschuss.
"Geht dich nichts an", entgegneten sie.
Ich brachte noch so etwas raus wie: "Ist es nicht traurig, dass hier so viele junge Menschen sterben?"
"None of your business", fauchte einer.
"Get out of here", ein anderer – "verschwinde"!
Ich war als Reporter in so einigen Krisengebieten, in Afghanistan, Irak, Syrien, aber am gefährlichsten erschienen mir immer die Drogengangs. Vor allem, weil sie so schwer berechenbar sind, so launisch, so verschieden. In El Salvador erzählte der Familienvater Zeus, ein lokaler Anführer der Straßengang Barrio 18, freimütig und detailliert, wie sie dutzende ihrer Rivalen massakriert hatten, vor allem von der berüchtigten Bande MS-13.
In Guerrero, Mexiko, berichteten wir über die dortige Organisierte Kriminalität, als uns bewaffnete Bandenmitglieder, vermutlich die Guerreros Unidos, an der Straße anhielten und aufforderten, das Land sofort zu verlassen. Sie konnten von unserer Anwesenheit nur von der örtlichen Polizei erfahren haben.
In Kolumbien verbrachte ich zwei Wochen mit einer Einheit der marxistischen Guerilla FARC im Dschungel, als mir klar wurde, dass sie eher mit dem lukrativen Drogenhandel beschäftigt sind als mit der sozialistischen Revolution.
Drogenhändler in Lateinamerika übernehmen mehrere Rollen gleichzeitig
Es ist etwas kompliziert mit Drogenhändlern in Lateinamerika. Sie wechseln häufiger mal die Seiten. Sie sind gleichzeitig Polizisten, Guerilleros, Politiker, Rapper, Familienväter.
In Brasilien kam es zu einer Begegnung der etwas anderen Art. Ich lebte dort zwei Jahre lang in einer Favela, die von Druglords des Kartells Comando Vermelho kontrolliert wird. Sie verstehen sich als autoritäre Herrscher und regeln sogar Ehekonflikte, Nachbarschaftsstreits und Ausgangssperren und legen dabei drakonischen Gesetze fest wie: Wer einen Bewohner beklaut, bekommt einen Finger abgehackt.
Für mich galt die Regel: Ich darf in der Favela leben, aber nicht über den Drogenhandel berichten.
Einmal stoppten mich zwei Jugendliche unweit der Favela mit gezogenen Waffen in meinem Mietauto, sie zwangen mich, auszusteigen, und fuhren davon. Klassisches Carjacking. Verängstigt erzählte ich meinem Vermieter davon, der die Nachricht weitergegeben haben muss. Als ich von der Polizeiwache kam, wo die Beamten herzlich wenig Interesse an meinem Raubüberfall zeigten, erhielt mein Vermieter die Auskunft vom Bandenführer: Der Fall ist aufgeklärt. Das Auto wurde unversehrt gefunden, 50 Kilometer entfernt, im Norden von Rio. Ich könne es abholen.
Was er mit den Räubern gemacht hatte, traute ich mich nicht zu fragen.
Hunderttausende Drogentote, Verbrecher in Anzügen und eine große Lüge
Die größte Drogengang, mit der ich es je zu tun bekam, war aber das Pharmaunternehmen Purdue der Unternehmerfamilie Sackler. Sie sind die Hersteller von Oxycontin, jenem opioidhaltigen Schmerzmittel, das Millionen Amerikaner abhängig machte und laut NIH (Nationale Gesundheitsinstitute) die derzeitige Opioidkrise auslöste, in deren Folge schon mehr als 450.000 Menschen gestorben sind. Gleichzeitig bezahlte das Unternehmen Bestechungsgelder in Millionenhöhe an Forscher und Mediziner, die die Erkenntnis verbreiteten: Das Mittel ist völlig harmlos.
Mit allen Banden konnte man als Reporter irgendwie sprechen, nicht aber mit der größten Drogengang der Welt, der Familie Sackler. Das Opioid hatte sie zu Multimilliardären gemacht. Durch PR-Agenten ließen sie ausrichten, dass sie nichts zu sagen haben und dass sie hochbezahlte Anwälte beschäftigen, die sich um hartnäckige Reporter kümmern.
In der Berichterstattung über Drogenkriege hat man es mit jeder Menge mieser Gestalten zu tun, auch im Fentanyl-Brennpunkt Kensington in Philadelphia, aber keine sind so mies wie die Verbrecher in Anzügen und Laborkitteln. Ganz legal haben sie mit synthetischen Drogen vermutlich mehr Geld eingenommen und mehr Leben zerstört als alle zusammen – Sinaloa-Kartell und Comando Vermelho, Barrio 18 und FARC, Guerreros Unidos und die Kleindealer von Philadelphia.
Sie sahen mich an der Allegheny Avenue in Kensington noch manches Mal während der stern-Recherchen im Sommer, doch mehr als finstere Blicke gab es nicht.