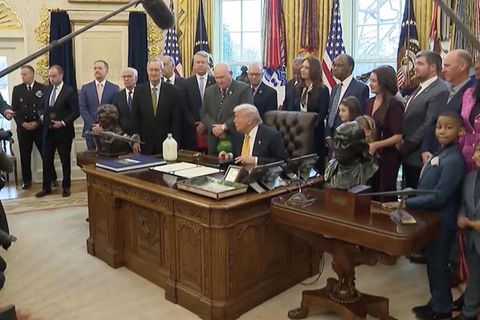Christof Kneer ("Süddeutsche Zeitung") stöhnt in Anbetracht der Rückbesinnung der Deutschen auf ihre Wurzeln, ist andererseits aber erleichtert über diese Repertoire-Erweiterung: "Diese Vorrunde war einem so vertraut, dass man sie fast nicht wiedererkannt hätte. Es war eine Vorrunde, die sich kaum von jenen Zeiten unterschied, die Löws neues Deutschland ausdrücklich für überwunden erklärt hatte. Deutschland, ein Rumpelmärchen - nach dem Spiel gegen Österreich wurde jede urdeutsche Kampfesfloskel in den Mund genommen, die nicht bei drei aus dem Stadion verschwunden war. Wer will, der kann die Wiederentdeckung der Tugendrhetorik durchaus für einen Fortschritt halten, denn man konnte sich ja bis Montagabend nicht sicher sein, ob Löws saubere Laptop-Elf überhaupt noch die gute, alte Schmutzlösung im Programm hat. Sie hat - dank Ballacks kunstvollem Brachialtor brachten die Deutschen das Spiel in ihre Gewalt. Löws Anspruch aber sind gewaltlose Siege; sein Deutschland soll eigentlich nicht per Faustschlag gewinnen, sondern mit manikürten Fingernägeln."
Quelle
indirekter-freistoss.de ist ein Fußball-Online-Magazin, das täglich die besten und wichtigsten Textausschnitte und Meinungen aus der deutschen Presse sammelt, zitiert und kommentiert. Auch als Newsletter in den Posteingang. www.indirekter-freistoss.de
Michael Horeni ("Frankfurter Allgemeine Zeitung") nennt der Teamführung deutlich die Unterschiede zwischen Wort und Tat, zwischen Theorie und Praxis: "Wenn die Wirklichkeit doch nur so wäre, wie die deutsche Nationalmannschaft sie wahrnimmt! Aber seit Wochen findet die Wirklichkeit nur noch schwerlich Zugang zum deutschen Lager. Der Bundestrainer und seine Spieler haben es sich zunehmend in ihrer eigenen Wunschwelt bequem gemacht, in der nicht erst seit den kümmerlichen Auftritten gegen Österreich und Kroatien nicht mehr sein kann, was nicht sein darf. Vor dem Spiel gegen Österreich kündigte der Bundestrainer zahlreiche Änderungen an. Neue Spieler sollten kommen, eine aufgefrischte Spielweise sollte zu sehen sein. Das war die Wunschvorstellung. Die Wirklichkeit sieht so aus: Bis auf den verletzten Marcell Jansen blieb personell alles so, wie es war - und auch spielerisch wurde nichts besser. Oder die Fitnessfrage: Die Führung sprach vor der EM von der vielleicht besten Vorbereitung auf ein Turnier. Das war ihre Wunschvorstellung. Die Wirklichkeit sieht derzeit so aus: Die Mannschaft ist nicht topfit, zu viele Spieler haben ihre Defizite nach Verletzungspausen nicht aufarbeiten können. Vor dem Viertelfinale sagt der Bundestrainer jetzt, dass ein spielerisch stärkeres Team wie Portugal der deutschen Mannschaft entgegenkomme. Das ist die Wunschvorstellung. Wenn sich bis Donnerstag nicht doch noch Entscheidendes ändert, droht den deutschen Verdrängungseuropameistern der nächste Realitätsschock."
Stefan Osterhaus ("Neue Zürcher Zeitung")
hingegen gesteht der Elf zu, pragmatische Lösungen zu suchen und ästhetische zu vernachlässigen: "Die Performance gegen den Erzrivalen war nach der Niederlage gegen Kroatien eine Leistung, wie sie zur Überlebensausrüstung jeder halbwegs erfolgsträchtigen Mannschaft gehört. Virtuosität für die Dauer von neunzig Minuten nicht als einzig erstrebenswertes Ideal zu betrachten, zeugt wenigstens von Realitätssinn, wie er in noch höherem Maße nötig ist, um gegen Portugal zu bestehen. Die Deutschen kramten reflexartig alte Methoden hervor, die mit hoher Wahrscheinlichkeit eher zum Erfolg führen werden als der Versuch, eine Spielkultur zu demonstrieren, die die Mannschaft noch nicht hinreichend verinnerlicht hat. Das Team zeigte nicht mehr und nicht weniger als robustes Handwerkzeug. Es tat, was notwendig war."
Andreas Lesch ("Financial Times Deutschland"): "Die deutschen Spieler haben einen Stil gezeigt, der mit den fußballerischen Idealen ihres Bundestrainers nicht das Geringste zu tun hat. Sie sind ganz und gar unlöwianisch aufgetreten. Aber sie haben das nicht mit böser Absicht getan. Sie können zurzeit nicht anders. Sie sind schon froh, wenn sie ein harmloses Gegnerlein wie Österreich überhaupt bezwingen. Sie haben sich nicht als Erlebnisfußballer, sondern als Ergebnisfußballer definiert. Unter Löw, der mit Feuereifer über Vertikalpässe, Ballannahme im Höchsttempo und offensive Brillanz doziert, gibt die Nationalmannschaft sich plötzlich so altdeutsch wie in längst überwunden geglaubten Zeiten. Sie will nicht glänzen, sondern gewinnen."
Die Alpha-Tiere Ballack und Frings geraten in den Blickpunkt. Lesch zieht ihre Dominanz im Team in Zweifel, solange sie nicht durch Leistung gedeckt ist: "Das deutsche Spiel hakt und ruckelt, es fließt nicht. Es basiert maßgeblich auf der Leistung der beiden Führungskräfte Frings und Ballack. Frings näherte sich gegen Österreich bedrohlich dem inoffiziellen Fehlpassweltrekord, er spielte nahezu jeden Ball in den mitspielerfreien Raum. Er agierte so schwach, dass Ballack sich zu selten nach vorn traute. Beide meckern auffällig oft ihre Mitspieler an. Wenn aber Frings schlechte Laune mit Altherrenkickerei kombiniert und Ballack kaum zum Torschuss kommt, dann wird die Fixierung des Teams auf dieses Duo zum Problem."
Auch Philipp Selldorf ("Süddeutsche Zeitung")
muss daran denken, wenn er sich Michael Ballacks Tor in Zeitlupe ansieht: "Im Fußball können Tore sprechen, und dieses Tor besagte, dass der Chef sich der Pflicht bewusst ist, dass er das Besondere zum Erfolg beitragen muss. Mit Nebenmann Frings hatte Ballack während des Kroatien-Spiels die übrigen Spieler verbal ziemlich herumgescheucht. Die herrische Art der Bosse, die zurzeit ein Autoritätsmonopol besetzen, hat nicht allen gepasst, wie Ballack selbst andeutete, als er aus der internen Mannschaftssitzung berichtete (‚Fußball ist nicht immer Harmonie'). Offenbar wurden Einsprüche gegen die Doppel-Herrscher laut, aber geschadet hat das nicht."
Michael Ashelm ("Frankfurter Allgemeine Zeitung")
stört sich an den Vertragsverhandlungen zwischen Mario Gomez und Bayern München: "Gomez macht es seinen Kritikern derzeit leicht. Zur Ladehemmung auf dem Rasen kommen die Spekulationen, wohin es ihn bald hintreiben könnte. Diese Diskussion kann ihm nicht gefallen. ‚Sein Marktwert fällt', schreibt das spanische Sportblatt ‚Marca' hämisch. Der Stuttgarter soll mit dem FC Barcelona verhandeln. Den viel größeren Wirbel lösen allerdings die Gerüchte über den Kontakt mit dem FC Bayern aus. Karl-Heinz Rummenigge bestätigte, dass Gomez ‚ein Thema' sei. Die täglichen Meldungen von der Wechselbörse sollen schon für atmosphärische Störungen innerhalb der Nationalmannschaft gesorgt haben. Gomez' Teamkollegen Podolski und Klose könnten sich durch die Gerüchte verunsichert fühlen, weil es indirekt ihre Zukunft bei den Bayern betrifft. Der Mitspieler Gomez ist plötzlich noch mehr ein Rivale. Diese Konfliktsituation und das sportliche Leiden auf dem Platz haben ihn nun mit der vollen Wucht erwischt."
Lesen Sie im zweiten Teil die Pressestimmen über die anderen Teams.
Teil 2
Italien gelingt der erste Sieg im letzten Vorrundenspiel und damit die Viertelfinalqualifikation - auch dank Hollands "selbstlosem" Sieg. Schweden und Russland, zwei sehr unterschiedliche Mannschaften, machen den letzten Viertelfinalteilnehmer heute unter sich aus.
Flurin Clalüna ("Neue Zürcher Zeitung")
schließt nach dem 2:0-Sieg gegen Frankreich hinter den Italienern die Türen: "Irgendwann rauschte er vorbei, der letzte Euro-Zug und die italienischen Fußballer vermochten gerade noch auf den hintersten Wagen mit der roten Laterne aufzuspringen. Er fährt sie nach Wien zum Viertelfinal. Den Italienern gelang der gewünschte Leistungssprung im richtigen Moment, im entscheidenden Spiel, als sie nicht mehr weiter nach hinten ausweichen konnten, weil der Rücken an der Wand anstieß. In diesen Momenten war ihnen wieder eingefallen, wie man italienisch verteidigt und dem Gegner fast gar nichts zugesteht. Diese Abdichtung war wichtiger als die gelungenen Spielzüge, denn die hatten die Italiener auch gegen Rumänien schon gezeigt. Diesmal funktionierte vieles. Sie spielten mit einem Masterplan im Hinterkopf. So wie man es sich eigentlich vom Weltmeister gewohnt ist. In einigen Szenen war Pirlo, den die Zeitungen aus der Mannschaft schreiben wollten, wie unsichtbar verkabelt mit dem Stürmer Toni. (…) Die Franzosen der Gegenwart waren satt und uninspiriert. Es gelang ihnen überhaupt nicht, wenigstens in einem EM-Spiel die Ehre einer älter werdenden Spielergeneration zu retten."
Christoph Biermann ("Spiegel Online")
kommt das alles bekannt vor: "Irgendwie erinnern die Italiener mit ihrer Mischung aus Qualität und Gerumpel an deutsche Mannschaften der Vergangenheit, die plötzlich in Endspielen auftauchten und niemand wusste, wie sie da eigentlich hingekommen waren." Hendrik Ternieden (Spiegel Online) zählt Luca Tonis Fahrkarten: "Was ist mit Tormaschine Toni geschehen? Der Angreifer spielt stark, er ist immer in Bewegung, erarbeitet sich eine Chance nach der anderen - und trifft das Tor nicht. Hätte er bei der EM die gleiche Trefferquote wie im Verein bei Bayern München - er würde die Torjägerliste mit geschätzten elf Treffern anführen."
Daniel Theweleit ("Berliner Zeitung")
beobachtet Marco van Basten bei einer gelungenen Gratwanderung, bei der mehr auf dem Spiel stand als drei Punkte, nämlich sein Ansehen: "Natürlich ist es eine verführerische Gelegenheit gewesen, mit einer Niederlage zwei Titelaspiranten und potenzielle Halbfinalgegner mit großem Namen aus dem Turnier zu befördern. Doch das hätte eine Lawine der Kritik ausgelöst. Schon im Stadion, vor allem aber in den Medien. So etwas verdirbt schnell die Stimmung. Außerdem ist es kaum vorstellbar, dass die holländische Stammformation über ein ganzes Turnier so überzeugend spielt wie in den ersten beiden Partien. Solch einen Sturmlauf bis ins Finale ohne schwächere Momente hat es seit Peles Zeiten nicht gegeben. Deshalb war diese Lösung mit einer engagierten B-Elf ein kluger Schachzug. Gegen die Rumänen reichte auch eine mittelmäßige Leistung, um das Gesicht zu wahren. Denn die Osteuropäer agierten viel zu vorsichtig, wirkten irgendwie gehemmt von ihrer enormen Chance, die Sensation zu schaffen."
Ronald Reng ("Süddeutsche Zeitung")
meint, dass Schweden von seiner Rückständigkeit profitiere: "Der Fußball, das globale Spiel, erfand in den letzten Jahren einen Allwetterstil, mit dem Teams, die individuell nicht überragend besetzt sind, trotzdem gegen Bessere bestehen können: In der eigenen Hälfte mit zwei eng aneinander gerückten Abwehr- und Mittelfeldlinien verteidigen, im Zentrum des Spiels nur zerstören und über die Flügel dann ab und an nach vorne fliehen. Es ist der Stil der Biederkeit, und sein Welterfolg lässt sich als Parabel auf die Globalisierung lesen: Nicht das elitär Wagemutige setzt sich durch, sondern das plump Einfache, das Sicherheitsdenken. Bei dieser EM nun versuchen erstaunlich viele Mannschaften aus dem globalen Stil wieder auszubrechen - Schweden dagegen hat, nach einer enttäuschenden WM 2006, mit diesem Stil zu einer bemerkenswerten Sicherheit zurückgefunden. Man kann die Schweden verachten für die Ödnis, die ihr Spiel verbreitet. Man sollte sie jedoch - bis zu einem gewissen Grad - bewundern, für das, was sie aus ihren Ressourcen machen."
Elisabeth Schlammerl ("Frankfurter Allgemeine Zeitung")
ergänzt: "Die Herren aus dem Dreikronenteam sind in die Jahre gekommen, ebenso ihre Spielweise. Schweden ist eher darauf ausgerichtet, Niederlagen zu vermeiden, als Spiele zu gewinnen - trotz des herausragenden Stürmers Zlatan Ibrahimovic spielt es selten erfrischenden Offensivfußball. Hinten kaufen Recken wie Mellberg oder Hansson den gegnerischen Angreifern oft genug den Schneid ab, selbst die quirligen Spanier hatten ihre liebe Mühe mit der höchst disziplinierten Defensive. Und vorne trifft Ibrahimovic. Das schwedische Angriffsspiel ist zugeschnitten auf den Stürmer von Inter Mailand - und abhängig von ihm."
Die
Neue Zürcher Zeitung
beleuchtet Stärken, Schwächen und Ambitionen Russlands: "Guus Hiddink ist kein Verwalter oder Defensiv-Puritaner - er gilt als Verfechter des Offensivspiels, des kreativen Gedankens. Es sind genau diese Voraussetzungen, die ihn zum idealen Trainer des russischen Teams machen. Denn die Tage, als auf dem Terrain der früheren Sowjetunion Systemtreue und Ordnungssinn die gefragtesten Qualitäten waren, sind vorbei. Das wurde gegen Spanien und Griechenland deutlich. Die Russen beeindruckten durch ihr schnelles, technisch versiertes Vorwärtsspiel, gleichzeitig machten sie sich aber auch einer gewissen Naivität schuldig. Denn gegen die routinierten und abgebrühten Spanier stolperten sie über die eigenen Füße und liefen dem Gegner ins offene Messer. (…) Ein Land mit 140 Millionen Einwohnern wird sich nie mit einem Mittelfeldplatz zufrieden geben."