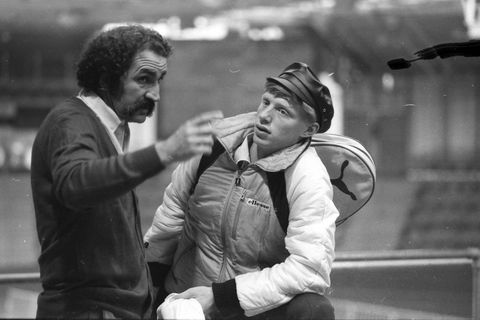Der Wind weht kühl, treibt den würzigen Geruch der Marihuana- Joints herbei, die sich über den Köpfen der Zuschauer in voluminöse Rauchwolken auflösen. Noch eine halbe Stunde nach Anpfiff des Länderspiels Südafrika gegen Sambia trudeln Fans ins spärlich besetzte Newlands-Stadion, Kapstadt, weil sie unterwegs mal wieder mit dem Minitaxi hängen geblieben sind. So haben sie wenigstens die bittersten Momente verpasst, eine Demütigung: drei Gegentore in 20 Minuten. Die südafrikanischen Spieler irren umher, als hätten sie sich auch ein paar Züge Gras gegönnt.
Auf einem Großbildschirm ist ab und zu das Gesicht ihres Trainers Carlos Alberto Parreira in Nahaufnahme eingeblendet. Der Brasilianer schaut so Mitleid erregend drein, dass man ihn am liebsten in den Arm nehmen möchte. Dem Meistercoach kommt die monströse Aufgabe zu, aus dieser Combo eine Mannschaft zu formen, die Südafrika bei der WM 2010 im eigenen Land zu glorreichen Siegen führt.
Cheforganisator Danny Jordaan, 56, hatte Parreira höchstpersönlich bearbeitet, den Job zu übernehmen. Jordaans Ambitionen sind nicht bescheiden. "Wir werden die beste Weltmeisterschaft veranstalten, die es je gegeben hat", sagt er vor dem Spiel. Die erste Fußball-WM auf afrikanischem Boden soll endlich andere Nachrichten vom schwarzen Kontinent um die Welt schicken, keine Bilder von Krieg, Aids und Elend. "Es ist eine historische Chance", sagt Jordaan. "Es geht darum, unser Image zu ändern. Und zwar nicht nur das unseres Landes, sondern das von ganz Afrika."
Wer sich außerhalb der Innenstadt bewegt, ist selbst schuld
Der erste Festakt aber ist gerade gründlich missglückt. Die pompöse Auslosung der Qualifikationsgruppen in Durban wurde vom Mord an dem früheren österreichischen Fußballprofi Peter Burgstaller überschattet, der vergangene Woche hinter dem elektrischen Zaun eines Golfplatzes erschossen und ausgeraubt worden war. Plötzlich begriff die Welt, dass sich die kühnen Versprechen in einen Albtraum verwandeln könnten, dass die Probleme der Armutskriminalität sich in den zwei Jahren bis zur WM nicht mehr lösen lassen. Nur verdrängen. Und leugnen.
Dass bei 52 Morden täglich vom Tod des Beckenbauer-Bekannten im Lande des Gastgebers kaum jemand Notiz genommen hat, verstärkt das Unbehagen. "Alles lief nach Plan, wir sind sehr zufrieden", sagte Polizeichef Vishnu Naidoo danach. Der Tote? Kein Thema. Schließlich sei der Österreicher nicht in der Innenstadt gestorben, die für die Zeremonie in einen Hochsicherheitstrakt verwandelt worden war. Wer sich außerhalb bewegt, ist selbst schuld. Hauptsache, die Funktionäre überleben. OK-Boss Jordaan äußerte sich vorsichtshalber gar nicht.
Jetzt, im VIP-Bereich des Newlands- Stadions, trägt er eine finstere Miene. Der ehemalige Aktivist des African National Congress hatte zehn Jahre gekämpft, um das Spektakel nach Südafrika zu holen. Doch die Elf macht nicht den Eindruck, als wisse sie, dass sie bald ihr Land in Euphorie versetzen soll - und eine politische Aufgabe meistern. "Hier war Krieg zwischen Weiß und Schwarz", sagt Jordaan. "Mandela hat uns vereint. Jetzt haben wir keinen Mandela mehr. Jetzt haben wir die WM, und sie gibt uns die gleiche Energie, die uns früher Mandela gab. Es geht um den Aufbau der gemeinsamen Nation, um die Zukunft dieses Landes."
Südafrika hätte diese Energie bitter nötig. Denn auch fast 14 Jahre nach Ende der Apartheid lebt noch immer über die Hälfte der Bevölkerung in großer Armut, ist Südafrika geteilt in Arm und Reich, in Schwarz und Weiß. Auch an diesem Abend im Newlands-Stadion ist vom viel beschworenen Miteinander der Rassen wenig zu spüren. Gestern noch, beim Rugby-Match, war die Menge weiß. So wie früher, in den alten Tagen, als Fußballspiele in diesem Stadion verboten und farbige Zuschauer nur auf Stehplätzen geduldet waren. Heute stechen nur ein paar weiße Gesichter aus der schwarzen Menge heraus. Aber es sind weniger als Spieler auf dem Feld. Die Ehrenlogen der Rugby-Fans, wo gestern Champagner floss, sind fest verrammelt. Rugby ist weiß. Fußball ist schwarz.
Eine Woche im Monat kommt Herr Schmidt
Nirgendwo im Land wird dies deutlicher als hier in Kapstadt. "Ein Fußballteam besteht aus elf Spielern", steht auf Plakatwänden, mit denen dem weißen Teil der Bevölkerung das Spiel erklärt werden soll. Damit die afrikanischen Organisatoren wiederum verstehen, wie der Weltfußballverband, die Fifa, ihren Wanderzirkus zu gestalten gedenkt, hat die Züricher Zentrale ihre hochkarätigste Fachkraft abgeordnet: Horst R. Schmidt, langjähriger Generalsekretär des DFB, der Mann, der die WM in Deutschland zur Perfektion führte. Eine Woche im Monat kommt der 66-Jährige ans Kap, um Jordaan und seine Helfer bis zum Eröffnungsspiel am 11. Juni 2010 zu begleiten. Er spricht von Zeitleisten, von Abgabefristen und Fluchträumen, wenn er seine Aufgabe beschreibt. "Das ist eine riesige Verantwortung", sagt Schmidt. "Der Fifa geht es um Kontinuität. Das Ziel Nummer eins ist es, eine Veranstaltung erster Klasse abzuliefern."
Eigene Stromaggregate wurden für die Stadien zur Bedingung gemacht. Niemals sollen die Lichter ausgehen, auch nicht, wenn draußen wie so oft ein Stromausfall das Leben lahmlegt. Hier soll es eine WM in Afrika geben, keine afrikanische WM.
Vor der Baustelle des neuen Kapstadter Stadions in Green Point tosen die Wellen des Atlantischen Ozeans, dahinter erhebt sich der Tafelberg. Ein Ort, wie geschaffen für das Fernsehen. Schon 95 Prozent der Übertragungsrechte sind verkauft, für die Rekordsumme von knapp 1,5 Milliarden Euro. Die Sponsoren müssen mehr denn je bezahlen, um die Strahlkraft der WM für den Weltmarkt zu nutzen. In Südafrika selbst, wo sich für McDonald’s nur 100 Filialen rentieren, ist nicht viel zu holen.
Höchstens für die, die eh gute Geschäfte machen. "Die Welt wird auf uns blicken", sagt Jordaan. Die WM werde Investoren ins Land bringen und Arbeitsplätze schaffen, den Tourismus weiter ankurbeln. Als wäre er Darsteller in einem Spot für seine eigene WM-Werbemaschinerie, lässt sich Jordaan für die zweite Scheibe Toast einen frischen Teller und ein neues Messer bringen. "Die Welt wird sehen, dass sich bei uns gut Urlaub machen lässt, dass die Weine schmecken und das Essen auch. Vielleicht sogar besser als in Berlin." Ganz so, als sei das für Fans aus dem Ausland das wichtigste Problem.
Jordaan hat die besten PR-Profis des Landes in sein Team geholt. Gemeinsam empfangen sie im Hauptquartier des Fußballverbandes Journalisten aus aller Welt, einige auf Kosten des Staates per Businessclass eingeflogen. Ihre Botschaft: Südafrika kümmert sich mit der geballten Staatsmacht. Acht Minister, fast das halbe Kabinett, ist in Jordaans Komitee versammelt. Fast vier Milliarden Euro sind für den Ausbau von Straßen, Zugverbindungen, Flughäfen und Stadien bewilligt.
"Die Schwarzen waren so lange von der Regierungsverantwortung ausgeschlossen, dass sie nun wie besessen sind von der Idee, der Welt zu zeigen, dass sie in der Lage sind, ein Land zu regieren", sagt Sampie Terreblanche, ein emeritierter Professor der Universität Stellenbosch, der einst in geheimen Zirkeln das Ende der Apartheid mit herbeigeführt hat. Das Wirtschaftswachstum liegt bei stolzen fünf Prozent.
Das beste Know-how - aber reicht das?
Aber es komme nichts an bei den Armen. Er ist 74, seine Stimme zittert vor Erregung über die historische Chance, er sagt es so laut, als ob es die ganze Welt hören solle: "Eine rasend schnell reich gewordene schwarze Elite hat sich gemein gemacht mit einer weißen Elite, die ihre Privilegien in die neue Zeit gerettet hat. Die große Masse haben sie dabei vergessen. Jetzt werden gigantische Erwartungen geweckt, die nicht erfüllt werden. Es wird auch diesmal nichts nach unten sickern."
Bei Jordaans Vorträgen flimmern Zahlen über die Leinwand, die schwindlig machen. 450.000 WM Touristen, 3,3 Millionen Tickets, fünf grundsanierte und fünf neue Stadien. Fragen nach nicht existierendem Nahverkehr wischt er weg. "Wir werden 400 Busse kaufen." Kriminalität? "Kein Grund zur Sorge", sagt er. Die Polizei plant Patrouillen an Überlandstraßen, mobile Wachen, Schnellgerichte. Bei Ligaspielen proben sie bereits, die Fans dazu zu erziehen, sich nur auf die Plätze zu setzen, deren Nummer auch auf ihrem Ticket steht. Sie wollen sogar Public Viewing ermöglichen. Würde das klappen, wäre das eine Sensation in dem Land mit der statistisch höchsten Mordrate der Welt. In dem jeder, der ein Auto hat, von einer mit Mauern und Elektrodraht gesicherten Trutzburg zur nächsten fährt und in dem nach 20 Uhr kein Taxi mehr in ein Township zu bekommen ist. "Wir haben den Vorteil, dass wir wissen, wohin die Fans sich bewegen", sagt Superintendent Vishnu Naidoo, der für die Sicherheit Verantwortliche. Aus Apartheidszeiten hat die Polizei Erfahrung bei der Überwachung großer Demonstrationen. Naidoos Lächeln ist sanft, sein Körper gestählt. Und seine Hoffnung groß, dass sich Südafrikas Kriminelle wegen der Polizeipräsenz während der WM anständig benehmen und für fünf Wochen eine Auszeit nehmen vom Alltag.
Große Sprüche hier - miese Stimmung dort
Dem ist OK-Chef Danny Jordaan längst entrückt. Mit Delegationen von Funktionären lässt er sich samt Polizei-Eskorte im Mercedes von Baustelle zu Baustelle chauffieren. In Beckenbauer-Manier jettet er von Kontinent zu Kontinent, um sich Tipps zu holen. Natürlich soll bei seiner WM alles größer und besser werden als 2006. "Man wird sogar die Spiele live auf Handys verfolgen können", frohlockt er. Bei Jordaan hört sich das an, als sei das Handy- TV von seinen Leuten erfunden worden.
Der Testbetrieb läuft, es kommen auch News, man kann jetzt schon fast täglich Bilder von Streiks beim Stadionbau sehen, von Demonstrationen in den Townships, Straßenschlachten mit der Polizei. Und vermehrt kritische Berichte über den Trainer Parreira. Man glaubt gern an Wunder in Afrika. Aber an die Magie des brasilianischen Hexenmeisters, der für 200.000 Euro Monatssalär ein bezauberndes Team formen soll, glauben nur wenige noch.
Beim Interview in einem tristen Johannesburger Hotel sitzt Parreira, 64, tief im Sessel versunken. "Der Druck, bei der WM Erfolg zu haben, ist so groß wie der Druck, in Brasilien Weltmeister zu werden", sagt er. Derzeit rangiert sein Team auf Platz 77 der Weltrangliste, in Afrika auf Position 17, hinter Kongo und Äquatorial-Guinea. Längst vorbei sind die Tage, als die Mannschaft den Afrika-Cup gewann, Deutschen und Brasilianern ein Remis abrang. Das war 1996, zwei Jahre nach dem Ende der Apartheid, im allgemeinen Freudentaumel.
Die Fans hatten dem Team damals den Namen "Bafana Bafana" verliehen, "die Jungs, die das Unmögliche schaffen". Das Unmögliche scheint in weite Ferne gerückt. Der Trainer selbst mahnt zu Geduld. "Wir haben noch Zeit", sagt er. "Wir sind die einzige Mannschaft, die schon qualifiziert ist." Doch manchmal ist er kurz davor, Länderspiele abzusagen, weil die lokalen Klubs ihre Spieler nicht freigeben. Die jüngsten sind auch schon 23. "Es kommt einfach nichts nach. Es gibt keine Entwicklung an der Basis", sagt Parreira und rutscht noch tiefer in seinen Sessel.
Dem Nachwuchs fehlt die Motivation
In Südafrika kann an öffentlichen Schulen nicht ernsthaft von Sportunterricht gesprochen werden, von Leistungszentren ganz zu schweigen. "Vielen Kindern fehlt die Motivation, überhaupt auf die Schule zu gehen", sagt Lucas Radebe, Bafana-Kapitän der WM 1998 und 2002. "Viele sagen sich: Mein schwarzer Bruder wird mir schon irgendwo einen Job besorgen." Wer doch auf Fußball setze, stehe alleine da. "Keiner der früheren Spieler wird vom Verband einbezogen", sagt Radebe. 13 Trainer in 13 Jahren hat das Nationalteam verschlissen. Nationalspieler, die im Ausland ihr Geld verdienen, haben bei Parreiras Vorgängern auf Einladungen gar nicht mehr reagiert. Deswegen trägt der nun demonstrativ auch abends den Trainingsanzug in der Hotellobby. "Es ist eine Ehre, für Südafrika zu spielen", trichtert er seinen Jungs ein. Und hofft, dass es die Südafrikaner wieder als Ehre empfinden, sie anzufeuern. Derzeit sind es manchmal nicht mehr als 1000.
Nicht einmal ehemalige Spieler wie die Fußballlegende Maria Maria Laoma zieht es in die Arena. "Was soll ich da? Der Funke springt heute nicht mehr über", sagt er. Sie nennen ihn immer noch General, weil er zu Zeiten der Apartheid Spielmacher der Black Eleven war, der illegalen Nationalmannschaft der Schwarzen. Sie hat kein einziges Länderspiel bestritten. Die Freifläche unter den Hochspannungsleitungen hinter seinem Haus in Soweto hat er auf eigene Kosten planieren lassen und geschweißte Tore hingestellt. Hier spielen die Kinder aus der Nachbarschaft, trainiert er seine Mannschaft, die Computer-Stars. Er macht das, um die Jungs von der Straße zu holen. "Alles basiert auf Privatinitiative. Vom Staat und vom Verband kommt nichts. Dabei gibt es keine Zukunft, wenn du nicht in die Jugend investierst", sagt der 57-Jährige.
Es klingt unfassbar, aber der General hört sich wehmütig an, wenn er zurückdenkt an die Zeiten der verordneten Rassentrennung. Damals, als Kicken für viele die einzige Möglichkeit war, aus der Hoffnungslosigkeit des Alltags zu entfliehen, war Fußball nicht nur Sport. Er war auch Ersatz für Theater. "Und es war die erste Religion", sagt der General, der sonntags als Laienpriester in der Kirche predigt. Die Religion heute? "Schnell reich werden", sagt er und zeigt wie zum Trotz Tricks am Ball, die es bei der WM wohl nie zu sehen gibt. "Dafür gab es Szenenapplaus. Das war fast so wichtig wie richtige Tore", sagt er. "Das ist der Fußball, der uns in Soweto heilig ist, hier ist seine Heimat."
Die Religion heute? Schnell reich werden
Bestenfalls drei Klubs der hiesigen Liga pflegen dieses kunstvolle Spiel, die Kaizer Chiefs, die Pirates, die Sundowns. Wenn die gegeneinander antreten, sind die Stadien voll, steht das ganze Land still. Aber bei Bafana? Da muss mehr passieren, als dass die WM-Planer für die Einheimischen vermeintlich günstige Tickets für 14 Euro anbieten, von denen noch keiner weiß, wie sie an den richtigen Mann kommen und nicht an Millionäre. In den Townships gibt es keine Hütte mit Internetanschluss. "Und die Weißen gehen nicht ins Stadion", sagt der General. "Sie haben immer noch Angst vor den Schwarzen."
In der Verbandszentrale in Johannesburg sitzt der Fifa-Gesandte Horst R. Schmidt in seinem Büro. Es ist der Tag nach dem Match, er gewährt Luke Alfred von der heimischen "Sunday Times" ein Interview. Schmidt soll erklären, weshalb er sich diese Aufgabe antut, die ihn manchmal den letzten Nerv kostet. Wenn Termine nicht eingehalten werden, Sitzungen 15 Minuten vor Beginn abgesagt werden. "Ich bin stolz, dabei zu sein. Es gibt hier ein riesiges Entwicklungspotenzial, ich will der Fußballfamilie was zurückgeben. Das ist mein Leben." Schmidt erzählt von Deutschland, wo 20 Millionen Euro aus dem WM-Gewinn zum größten Teil in Bolzplätze investiert wurden. Der Reporter notiert ungläubig. "Herr Schmidt ist ein ungeheuer freundlicher Mann", sagt Alfred danach. "Aber er kommt mir vor, als wäre er von einem anderen Stern. Ich weiß nicht, was ich meinen Lesern mitteilen soll."
An Altruismus ist hier keiner gewöhnt, eher an Korruption und Bereicherung. Es regt sich niemand darüber auf, dass sich OK-Boss Jordaan und andere Funktionäre als Fifa-Prämie eine Million Euro in die Tasche gesteckt haben sollen. Auch nicht, dass die Stadien nach der WM kaum für Fußball genutzt werden dürften, der Sport kann die Arenen nicht unterhalten. Das kann nur Rugby.
Draußen, auf dem Bauzaun, hinter dem das FNB-Stadion errichtet wird, flirren die mannshohen blauen Ziffern einer Digitaluhr, die auf einem übergroßen Fußball thront. Sie zählt die Tage bis zum Anpfiff. Jetzt sind es noch 917. Auf dem Schild daneben steht: "The world is watching us." Vermutlich ist dies das Beste, was dem Land passieren kann.