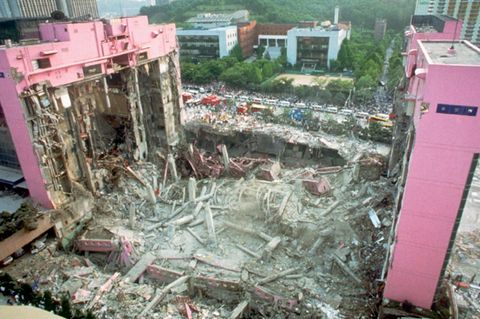Es war bis zu diesem 24. September 1988 das schnellste 100 Meter-Rennen der Leichtathletik-Geschichte. Das 100-Meter-Finale bei den Spielen von Seoul 1988 gewann der Kanadier Ben Johnson vor Carl Lewis (USA) und Linford Christie (Großbritannien). Die Siegerzeit von 9,79 Sekunden war damals ein Fabelweltrekord und gehört bis heute zu den schnellsten Zeiten, die jemals über diese Distanz gelaufen wurden. Der Haken: Johnson wurde nach dem Finale die Einnahme von Stanozol, eines synthetischen Steroids, nachgewiesen er musste die Goldmedaille abgeben, der Weltrekord wurde aberkannt.
Erst Jahre später wurde bekannt, dass Carl Lewis, der als Zweitplatzierter nachträglich Gold erhielt, schon bei den US-Trials auf drei(!) Substanzen positiv getestet worden war und nur aufgrund eines "Freispruchs" wegen "versehentlicher Einnahme" durch den US-Verband antreten konnte. Lewis, der eine weitere Goldmedaille gewann, hätte nach den Regeln nicht an den Spielen teilnehmen dürfen. Bis auf den Amerikaner Calvin Smith (ursprünglich Vierter) sind alle Teilnehmer dieses Rennens im Laufe ihrer Karriere positiv getestet worden - Grund genug für Experten, vom "schmutzigsten Rennen der Leichtathletik-Geschichte" zu sprechen.
Doping gibt es, seit es Sport gibt, und die Olympischen Spiele als weltgrößtes Sportereignis standen immer besonders im Fokus, sowohl der Betrüger, wie auch der Doping Fahnder. Seoul 1988 war wohl in vielen Disziplinen ein besonderer Höhepunkt des "medizinisch geförderten Sports" und es war vor allem wohl das bis dahin größte Signal an die Öffentlichkeit: Nie zuvor war so ein bekannter Sportler bei einem so bedeutenden Rennen positiv getestet worden - zumal das Duell von Ben Johnson gegen Carl Lewis zu dem Zweikampf der Spiele hochstilisiert worden war und deshalb maximale globale Aufmerksamkeit erhalten hatte.
Alle Rekorde der DDR sind fragwürdig
Der heutige Stand der Forschung über die Dopingszene der achtziger und neunziger Jahre lässt natürlich viele Rückschlüsse zu, die weit über dieses Rennen hinausgehen. So gibt es heute Erkenntnisse, die mit höchster Wahrscheinlichkeit vermuten lassen, dass nahezu alle Weltrekorde und Spitzenleistungen im DDR-Sportsystem unter Verwendung unerlaubter Substanzen zustande gekommen sind, die heute noch (zumindest offiziell) anerkannten Weltrekorde der achtziger Jahre der DDR-Leichtathleten sind ebenso fragwürdig wie die sechs Goldmedaillen der DDR-Schwimmerin und ZDF-Sportmoderatorin (!) Kristin Otto, deren Mannschaftsarzt und Trainer später rechtskräftig wegen Dopings verurteilt wurden.
Besonders spektakulär an diesem Doping-Höhepunkt der Sportgeschichte 1988 war zweifellos der bis heute bestehende Fabelweltrekord von 10,49 Sekunden, den die Sprinterin Florence Griffith-Joyner über 100 Meter schon bei den US-Trials aufstellte und dem sie dann zwei Monate die Goldmedaille in Seoul folgen ließ, wo sie auch die 200-Meter-Distanz gewann und dabei ebenfalls einen Weltrekord aufstellte. Schon damals war sie von heftigen Dopinggerüchten umgeben, eine ganze Reihe von Spuren führen in die direkte Umgebung der schon 1998 im Alter von 38 Jahren verstorbenen Sprinterin. Ähnliches gilt auch für ihre ebenso erfolgreiche Schwägerin Jackie Joyner-Kersee, die in Seoul den - ebenfalls bis heute gültigen - Weltrekord im Siebenkampf aufstellte und die Goldmedaille im Weitsprung gewann.
Ben Johnson stellte sich nur dämlicher an
Seoul war also wirklich "One Moment In Time", wie Whitney Houston im damaligen Olympia-Hit sang, in der Fülle von fragwürdigen Weltrekorden und Medaillen hatte sich Ben Johnson nur besonders dämlich angestellt und sich als einziger erwischen lassen - außerdem wurden die US-Sportler wohl auch besser durch Ärzte und Funktionäre "beschützt" als der Kanadier.
Wie ungehemmt in der Leichtathletik auch seitdem weiter gedopt wurde, enthüllte der Skandal um das kalifornische Doping-Labor Balco und deren Kunden um Olympiasiegerin Marion Jones und den Sprinter Tim Montgomery. Im Zuge der Ermittlungen konnte der überragenden Leichtathletin und populärsten amerikanischen Sportlerin der Jahrtausendwende die jahrelange und systematische Einnahme des Steroids THG und von EPO nachgewiesen werden. Nach langem Prozess legte Jones 2007 ein Geständnis ab und erklärte ihren Rücktritt vom Leistungssport. Ironie am Rande: Die Goldmedaille über 100 Meter müsste theoretisch die Griechin Ekaterina Thanou erhalten - ebenfalls eine Kundin von Balco, die 2004 in die Schlagzeilen geriet, als sie sich mit einem vorgetäuschten Motorradunfall einer Dopingkontrolle entziehen wollte und deshalb von den Spielen in ihrer Heimat ausgeschlossen wurde.
Das weitere Schicksal von Marion Jones, der dreifachen Olympiasiegerin von Sydney, ist vielleicht das deutlichste Symbol für eine veränderte Großwetterlage in Bezug auf Doping. Die Frau, die auf dem Titelblatt von Newsweek im September 2000 mit "Marion Jones: Superwoman" gefeiert wurde, hat aufgrund mehrerer Meineide bei Doping-Verfahren im April eine sechsmonatige Haftstrafe angetreten und wird die Sommerspiele von Peking in einer amerikanischen Gefängniszelle verfolgen müssen - ein tiefer Fall für den Superstar.