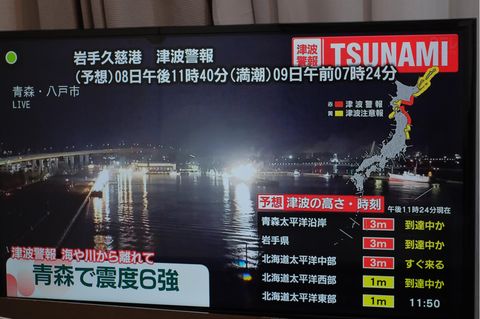Man riecht die Anstrengung nicht, nur das Öl. Das Öl legt sich über den Schweiß. Aber der Schmerz dringt durch. Man hört ihn. Er ist ein Knacken und ein Schmatzen zugleich. Als würde die Schädeldecke bersten, wenn die zwei Köpfe aufeinanderkrachen, getrieben von sechs Zentnern Fleisch und Kraft.
Schließlich wird der Schmerz ein Stöhnen, das zum Ächzen wird und bald zum Wimmern. Diesmal ist es ein Zwerg, hundert Kilo leicht, der versucht, einen Berg zu verschieben. Sein Atem wird flacher, der Kopf röter, weiter, weiter, eines Tages muss die Kraft doch reichen. Der Große stemmt sich nur entgegen, er packt ihn am Nacken, drückt ihn hinunter. Dieser Bursche soll lernen, den Schwerpunkt tief zu halten, um fester zu stehen. Und lernen, wo oben und unten ist und dass unten dort ist, wo der Zwerg ist.
Der Große schleift ihn hinter sich her. Zehn Sekunden, zwanzig. Eine Minute, zwei. Schleudert ihn aus dem Ring. Der Junge japst im Sand, einer tritt ihn, der Fuß zeichnet ein Mal in den dreckigen Rücken. Das Haar rutscht aus dem Band, der Zopf hängt wie ein toter Vogel vom Kopf. Irgendwann wird er stark und das Haar sehr lang sein. Er muss es hier nur lange genug aushalten.
Leid macht stark. Seit Jahrhunderten gilt das. Das ist eine Weisheit des Sumo. Das ist das Problem, sagt Musashimaru.
"Den meisten Japanern fehlt heute der Kampfesmut", sagt er. Er rollt den Satz aus der Tiefe seiner 238 Kilogramm, er donnert ihn von der Bank hinab, auf den Fragenden, der am Boden sitzt, im Musashigawa-Ringstall, an diesem Ort, wo alles wie vor hundert Jahren scheint, wo viele über die Gegenwart klagen, die von der Welt dort draußen regiert wird.
Musashimaru ist ein Mann, dem Sumo am Herzen liegt. Aber manche sagen, mit Männern wie ihm habe der Untergang begonnen: mit den Ausländern. Vor 17 Jahren kam Fiamalu Penitani aus Hawaii, wurde Ringer, wurde schwerer und stärker, wurde zu Musashimaru, walzte die Gegner weg, damals fast ausschließlich Japaner, stieg in der Hierarchie des Sumo auf, die streng und klar ist wie alles in diesem Sport, wie alles früher in Japan, ein paar Dutzend Ränge, und an der Spitze stehen die Yokozunas: die Allerstärksten.
"Ich wollte schon immer ein Star werden", sagt Musashimaru, in den faltigen Ringen seines Halses sammelt sich der Schweiß eines Sommertags. "Ich entdeckte Sumo und ging nach Tokio. Es ist der American Dream", sagt er, der 67. Yokozuna. "Und so war es ja früher auch in Japan: Wenn du vom Land in die Großstadt kamst, wolltest du ein Star werden." Zu Musashimarus Hochzeiten hatten vier Ringer zugleich den Titel des Yokozuna tragen dürfen: zwei Japaner und zwei Hawaiianer. Es war ein Wettstreit der Kulturen, der das Volk fesselte.
Im Hintergrund fegen ein paar Ringer den Sand des Dohyos, der Kampffläche, der Morgen ist noch jung, aber hier beginnt das Tagwerk um halb fünf, wenn selbst die Vögel noch zu müde zum Pfeifen sind. Die niederen Ränge müssen im Beya leben, im Ringstall, sie kochen, waschen, putzen, sie dienen den höheren, so wie es immer schon war. Musashimaru ist nun Trainer im Musashigawa-Beya. Nach seinem Rücktritt als Yokozuna wurde ihm der Zopf abgeschnitten, auch das ist Tradition. Er sagt, es war eine Erleichterung. "Ich musste immer gewinnen, um meinem Titel gerecht zu werden. Alles blickte auf mich. Die Verantwortung ist riesig als Yokozuna."
Derzeit gibt es nur einen Yokozuna: Asashoryu, den Mongolen.
Die Höhle des Ungeheuers ist ein grauer Betonkasten in der Unterstadt Tokios. Ständig walzt ein Kämpfer in der Hocke wie eine Raupe um den Ring. Alles ist Schmerz und Kraft, zwischendurch immer ein Klock, wenn Köpfe auf Schultern prallen oder Köpfe auf Köpfe. Das Training besteht zumeist aus Kämpfen. Der Sieger bleibt im Ring für den nächsten Gegner. Die Grundregeln sind einfach: Wer die Grenzen des Rings übertritt oder mit einem anderen Körperteil als der Fußsohle den Boden berührt, hat verloren. Die Technik ist komplex, 82 Sieggriffe gibt es. Vor dem Kampf belauern sich die Ringer, sie müssen erahnen, welchen der Gegner anwendet, welchen er von ihnen erwartet. Es ist nicht so, dass dicker immer besser ist. 200 rollenden Kilos ist schwer zu widerstehen, aber ein schneller Schritt zur Seite, ein Schlag auf den Rücken, und schon rast der andere durch, erst die nächste Wand kann ihn bremsen.
In kaum einem Sport wird so hart trainiert wie im Sumo. Am Boden dehnt sich jemand, selbst die Schwersten sind extrem beweglich, beherrschen den Spagat. Im Hintergrund ein monotones Klopfen wie das Pendel einer alten Standuhr, die Hände eines Riesen krachen gegen einen aufgestellten Baumstamm, mit Armen schwer wie das Holz, links, rechts, links, rechts. Kritiker sagen, im Sumo werde trainiert wie im Mittelalter. Traditionalisten sagen: Es hat die Alten schon stark gemacht. Immerhin sind regelmäßige medizinische Kontrollen eingeführt worden. Vor allem für jene, die vom Sport zurücktreten. Heute ist die Lebenserwartung der Ringer zwar noch immer niedriger als im Durchschnitt der Japaner. Aber früher starben viele schon mit 50. Sie fraßen weiter, aber trainierten nicht mehr, und ihre Organe, fett und krank, konnten den mächtigen Leib irgendwann nicht mehr versorgen.
Nur die Anweisungen der Trainer am Rande des Ringes sind zu hören, es sind leise Worte. Dann kommt der Yokozuna. Die Ringer blicken ihn an, versteckt, was, wenn sein Blick sie trifft? Asashoryu, in der Mongolei geboren, ist nicht der Größte, nur 1 Meter 84, nicht der Schwerste, nur 148 Kilo. Aber er ist der Beste, der Erste, der alle sechs Sumo-Turniere eines Jahres gewann, 2005. Und er ist nicht bekannt dafür, gnädig mit seinen Lehrlingen umzuspringen. Gnade schwächt, es ist eine Beleidigung, nicht hart zu trainieren, und die Schwachen wachsen an der Härte der Starken, das ist die Philosophie.
Asashoryu murmelt einem Jungen etwas zu. "Hai", sagt der. Geht in die Ecke, nimmt den Bambusstock, hält ihn mit beiden Händen vor sich, knallt sich den Stock zweimal gegen den Schädel. Stellt ihn zurück. Sagt: "Arigato." "Arigato" heißt danke. "Hai" heißt ja. Die einzigen Worte, die ein Novize sagt. "Du schiebst wie ein Schwächling" - hai. "Kehre den Ring" - hai. "Nimm dir den Stock" - arigato.
Die Zuschauer des Sumo schwinden schon seit einiger Zeit, es wird immer schwieriger, talentierten Nachwuchs zu finden. Und jetzt haben sie auch noch das Problem Asashoryu. Der Wettbewerb ist der Reiz des Sports - doch wo bleibt der, wenn immer derselbe gewinnt? Sumo ist ein Stück Japan. Doch was gibt es Schlimmeres, als wenn ein Heiligtum von Ausländern dominiert wird? Sumo ist Tradition, und die lebt von Regeln. Doch was, wenn der Beste sich nicht um sie schert?
Asashoryu, der nach Siegen unglaublicherweise die Faust streckte. Gegner an den Haaren zerrte, Schiedsrichter kritisierte, Trauerfeiern schwänzte, sich außerhalb des Ringes prügelte, sich nachts mit dem Meister stritt, bis die Nachbarn die Polizei riefen - Asashoryu ist die Pest. Aber er ist stärker als alle Japaner.
Der Duft von Hähnchen mischt sich unter den Geruch des Öls. Nach dem Duschen setzt sich Asashoryu auf die Tatamimatte, ausgerollt von den niederen Rängen, sie dürfen erst essen, wenn die hohen fertig sind, sie müssen sie bedienen, sie reichen Asashoryu Trauben, bringen Gebratenes und den Chankonabe, den Sumo-Eintopf. Asashoryu ruht wie Nero, nur die Weiber fehlen.
"Mir ist egal, ob ich als Yokozuna Ausländer oder Japaner bin", sagt er. "Wichtig ist, dass die Kinder sehen, dass Sumo Spaß macht. Deshalb konnte ich so stark werden." Er kennt keine Vorsicht in der Wahl der Worte. "Die japanischen Sumo-Ringer sind heute ziemlich schwach. Das finde ich bedauerlich." Gern erklärt er den Japanern, dass es ihnen nicht geschadet hätte, auf dem Pferd durch die Mongolei zu reiten. Es sind Beleidigungen, doch wer will einem widersprechen, der von den letzten 23 Turnieren 17 gewann? Ein wenig Hoffnung auf Konkurrenz gibt es. Zwei andere Ringer könnten bald zu Yokozunas ernannt werden: Hakuho und Kotooshu. Ein Mongole und ein Bulgare. Männer aus Ringernationen - und aus ärmeren Ländern. Männer, die bereit sind, für Wohlstand zu leiden. Früher waren es oft die jüngsten Söhne aus armen japanischen Bauernfamilien, die in die Sumo-Ställe gingen, um der Familie nicht zur Last zu fallen.
"Die Japaner sind heute zu wohlhabend, ihnen fehlt das Herz. Ich habe als Kind nur davon geträumt zu kämpfen. Mein Vater war Ringer", sagt Asashoryu mit dunkler Stimme. "Die Welt des Sumo ist streng, das muss man aushalten." An seiner Wange hängt eine Nudel, der Yokozuna hat gekleckert, sofort huscht einer herbei, eine Serviette zwischen wulstigen Fingern, um mit Respekt und Achtung die Nudel von der Wange des mächtigsten Sumotori zu picken.
Sieben persönliche Diener hat Asashoryu. Die ihm den Rücken waschen, ihn in der Öffentlichkeit begleiten als Bodyguards. Er ist ein Symbol. Es gibt eine Zeremonie, bei der Eltern Ringern Babys in die Hand drücken: Welches am lautesten schreit, wird einmal groß und stark sein.
Asashoryu ist ein Star, besitzt einen Mercedes, einen Lexus und einen Hummer-Geländewagen. Er verdient rund eine Million Euro im Jahr, Prämien, Preisgelder und Werbung. Von den mehr als 700 Ringern in den 54 Ringställen bekommen nur die rund 70 Ringer ab dem Rang eines Juryo ein Gehalt. Und die wenigsten schaffen es so weit. Die anderen werden oft Köche, oder der Ringverband besorgt ihnen Jobs. Bei den Turnieren haben viele Security-Leute die gleichen wuchtigen Körper wie die Aktiven, die gleichen Kohlblattohren, in Kämpfen so oft zerfetzt, dass sie wie Geschwüre an ihrem Schädel hängen. Eine große Familie, wer als Ringer aufhört, findet immer noch ein Plätzchen in dieser Sumo-Welt, irgendeines, irgendwo.
Asashoryu steht auf. Er wird nach Hause gefahren. Er schäkert noch ein bisschen, ruft auf Deutsch "Achtung" und "Hände hoch", das kennt er aus Kriegsfilmen, die er in der Mongolei sah. Er ist ein Showman, in Europa würde man ihn lieben, aber viele Sumo-Funktionäre klagen darüber, dass er sein Amt nicht ehre. Doch was ist schon Ehre?
"Heute tragen die Jungen draußen sogar gefärbte Haare", sagt Tokonaka, seit 27 Jahren Sumo-Friseur, ein eigener Beruf mit eigenen Rängen. "Sie interessieren sich nicht für Ehre. Sie kennen keine Hierarchien mehr. Die Jungen sprechen die Älteren in der Umgangssprache an, sie wissen nicht, wie man sich zu verbeugen hat." Vor ihm sitzen die Ringer, er pflügt seinen Kamm durch ihr Haar, bis zu 400 Euro kosten seine Kämme. Knotet es zum Haarwulst, eine Tradition noch aus der Edo-Zeit, als nur Samurai einen Zopf tragen durften. Oft weinen sich die Jungen bei ihm aus. Rund ein Drittel verlasse heute in den ersten Monaten den Stall, sagt er. Dabei sei doch alles sanfter geworden. Früher stand man schon um zwei Uhr auf. Und die Ringer heute haben Fernseher im Beya, Videospiele und Heftchen mit nackten Frauen. "Aber es gibt hier noch Ehre, Hierarchie und Tradition. Das gibt Halt", sagt er. "In unserer Gesellschaft ist ja so viel im Umbruch."
Die Japaner reden von der "Sumo-Welt", einem Universum für sich. Aber sie lebt von Sponsoren, Zuschauern und Jugendlichen, die bereit sind, in diese Welt einzutauchen. "Wir entwickeln uns weiter", sagt Takasago, der Meister des Beyas in seinem Büro beim Sumo-Verband. "Ich selbst wurde stärker, weil ich geschlagen wurde. Aber heute möchte ich mit Worten lehren." Takasago ist auch Geschäftsführer des Verbandes. "Ja, es kommen weniger Zuschauer. Die Konjunktur spielt mit rein. Aber wir kümmern uns um besseren Service. Essen servieren. Geschenke verteilen." Es klingt nicht nach großen Schritten.
Die Turniere sind nur an wenigen Tagen ausverkauft. Sechs gibt es pro Jahr. Sie erstrecken sich über 15 Tage, sodass jeder Ringer 15 Kämpfe bestreitet. Der mit den meisten Siegen gewinnt den Kaiserpokal des jeweiligen Turniers. Es sind für Marketingexperten sonderbare Probleme, mit denen der Sport ringt: dass wochentags die Kämpfe nur zwischen 8 und 18 Uhr stattfinden. Dass der Verband seine Tickets oft nicht über Agenturen verkauft. Dass er Sumo zur olympischen Disziplin machen will, aber in der Regel nur einen Ausländer pro Beya zulässt. Der Verband ist eine Familie, lauter ehemalige Ringer, die von Traditionen schwärmen und mit dem Lauf der Zeit hadern. "Eines Tages haben wir wieder einen japanischen Yokozuna, und Sumo wird wieder beliebter", sagt Takasago, Anzug, Krawatte, der Hemdkragen um den Hals gezwängt. Morgens im Beya hatte er nach der Dusche noch das Pooh-der-Bär-Handtuch um die Hüften geschlungen. Er schien sich wohler zu fühlen.
Zum Training war er gleichgültig zu seinem Stuhl geschritten, blickte nicht auf jene im Dreck, die im Chor tiefer Stimmen "Guten Tag" raunten. Einer eilte herbei, stülpte ihm weiße Schühchen über. Der Meister schlug die Zeitung auf, schlürfte Tee, blickte nicht auf, kein einziges Mal. Nur zwischendurch rollte er irgendwas die Kehle hoch und spuckte es in den Sand, in dem sich die Ringer wälzten. Er war einfach nur da.