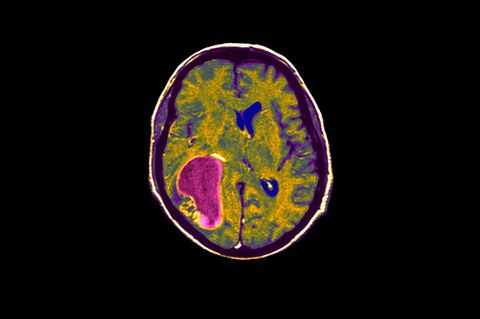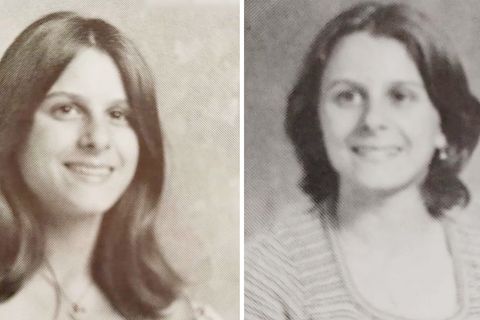Angenommen, Sie sind ein CNN Reporter in Bagdad. Und wie das Schicksal es will, sind Sie der erste Journalist der Welt, der mit eigenen Augen sieht: Saddam Hussein ist tot. Sofort kramen Sie Ihr Handy unter der kugelsicheren Weste hervor. Wen rufen Sie an? US-Präsident George W. Bush? Falsch. Dann bekommen Sie allenfalls einen Orden aus Blech. Die CNN-Zentrale in Atlanta? Auch falsch. Sie werden befördert, aber Sie müssen weiter für Ihren Lebensunterhalt arbeiten. Viel schlauer ist, Ihren Börsenmakler anzuwählen und "Kaufen, kaufen, kaufen" ins Telefon zu rufen. Ein paar Minuten später sind Sie steinreich. Denn nach der Nachricht vom Tod des Diktators werden an der Wall Street die Aktienkurse in die Höhe jagen wie Patriot-Raketen.
Nicht mehr die Analyse des ökonomischen Erfolgs von Unternehmen bestimmt die Aktienkurse. Seit Kriegsbeginn folgt der Dow Jones exakt dem von CNN verkündeten Zwischenstand auf dem Schlachtfeld. Auf dem Parkett starren die Händler auf die Fernsehbilder. Kapitulierende Iraker, brennende Paläste - das treibt die Kurse nach oben. Zeigt das Fernsehen jedoch gefangene Amerikaner oder abgeschossene Hubschrauber, dann verliert die amerikanische Wirtschaft schnell mal ein paar Milliarden Dollar an Wert. Krieg und Wirtschaft sind untrennbar miteinander verschmolzen. Sicher: Die USA, die stärkste Militärmacht in der Geschichte des Globus, werden die irakische Armee besiegen - früher oder später. Aber wird das auch ein Triumph für die größte Wirtschaftsmacht in der Geschichte der Menschheit?
Die Weltmacht
USA ist abhängig vom Rest der Welt. Was sie zur Sicherung ihres Lebensstandards braucht, muss sie einführen: Rohstoffe, Intelligenz und vor allem Geld. Kein Mensch verbraucht so viel Energie und damit Brennstoffe wie der amerikanische Mensch. Für die US-Ökonomie ist es daher wichtig, dass vor allem Öl in ausreichender Menge und zu günstigen Preisen eingekauft werden kann. In der globalen Wirtschaft ist inzwischen jedoch ein anderer Rohstoff noch bedeutsamer geworden: Intelligenz. Seit dem Ende des Kalten Krieges kommen die klügsten Köpfe der gesamten Welt in das Einwanderungsland USA, um dort zu studieren, zu forschen, zu arbeiten. Immer weniger Amerikaner jedoch studieren Natur- oder Ingenieurwissenschaften. Die Eliteuniversitäten und das Silicon Valley, das Zentrum der Informationstechnologie, sind bevölkert von Asiaten. Beim Softwareentwickler Sun Microsystems forderten die amerikanischen Mitarbeiter kürzlich bereits eine Art Amerikaner-Beauftragten, weil sie von den vielen Indern diskriminiert würden.
Noch mehr
als alles andere braucht die US-Wirtschaft allerdings das Geld der Welt. Seit vielen Jahren schon führen Amerikaner erheblich mehr Güter ein als aus. Sie kaufen also mehr, als sie verkaufen. Die Differenz hat einen Wert von 500 Milliarden Dollar im Jahr. Wer zahlt das? Nicht die Amerikaner, sondern der Rest der Welt. Regierungen, Unternehmen, Banken und ganz normale Menschen überall auf der Welt investieren ihr Geld mit Vorliebe in Dollars, amerikanischen Immobilien und vor allem in Aktien. 80 Prozent der gesamten Ersparnisse der Erde werden in den USA angelegt.
Ohne den ununterbrochenen Zustrom von Öl, Intelligenz und Geld aus dem Ausland kann Amerika seinen Lebensstandard nicht annähernd halten. Weltmacht USA - ökonomisch betrachtet bedeutet das: Die Welt hat Macht über die USA. Alleingänge kann es allenfalls militärisch geben. In der globalisierten Wirtschaft nicht. Wird die Welt auch in Zukunft uneingeschränkte Solidarität mit der amerikanischen Wirtschaft zeigen? Das hängt von zwei Faktoren ab: den nackten Zahlen - und der Stimmung. An beiden Fronten könnten die Entwicklungen kaum deprimierender sein.
"Das Vertrauen
in unser Land ist auf dem niedrigsten Stand in der Geschichte", schrieb Ex-Präsident Jimmy Carter wenige Tage vor Kriegsbeginn in der "New York Times". Inzwischen ist das Ansehen weiter abgestürzt. Auch in Deutschland: Mitte 2002 hatten 61 Prozent eine gute Meinung von Amerika, heute sind es 25. Weltweit demonstrieren Menschen gegen Amerika. Früher wurde bei solchen Anlässen gern die Stars-and-Stripes-Flagge verbrannt. Heute attackieren Pakistani, Deutsche, Franzosen, Koreaner oder Japaner die Logos von Coca-Cola oder McDonald's: Ikonen der amerikanischen Wirtschaft und Symbole für den mit Abstand erfolgreichsten Exportschlager der US-Wirtschaft: den American way of life.
US-Industrieprodukte
sind dagegen auf dem Weltmarkt nicht besonders erfolgreich. Bestes Beispiel sind die Autos. Das meistverkaufte US-Fahrzeug ist seit 20 Jahren der Ford F-Series, ein Pick-up mit jahrzehntealter Technik, der so durstig ist, dass man ihn mit laufendem Motor nicht voll tanken kann. In Europa ist er unverkäuflich. Und Ford droht, im Jahr seines 100. Jubiläums, die Pleite. Erfolgreich ist die amerikanische Wirtschaft mit Marketingprodukten: Nike, Coca-Cola, Marlboro und Entertainmentware aus Hollywood. Diese Markenartikel verkaufen das Image von Freiheit und Abenteuer, den amerikanischen Lebensstil - sie verkaufen die Marke USA. Wie wichtig auch Washington diese Markenpolitik ist, zeigte Außenminister Colin Powell, indem er Charlotte Beers als Staatssekretärin anheuerte, eine Spitzenmanagerin für Markenwerbung. "Wir verkaufen ein Produkt", sagt Powell. "Wir brauchen jemanden, der die amerikanische Außenpolitik neu als Marke lanciert." Der Alleingang beim Krieg gegen den Irak hat der Marke USA einen gigantischen Schaden zugefügt. Mit Langzeitwirkung. Denn die neue weltweite Protestbewegung wird getragen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, von Menschen in einem Alter also, in dem sich Markenvorlieben für den Rest des Lebens prägen. Markenabneigungen auch.
Die US-Regierung
wendet Marketingmethoden nicht nur auf die USA, sondern auch auf den Irak-Krieg an. Andrew Card, Stabschef im Weißen Haus, bezeichnet den Krieg als "Produkt", das verkauft werden müsse. Beim Produktmanagement des Krieges hat die Bush-Regierung komplett versagt. Nun muss die Welt mit ansehen, wie das Weiße Haus auch die Marke USA langfristig schädigt. Eine Katastrophe für die Stimmungswirtschaft des Landes.
Ist die Stimmung schon im Keller, so nähern sich die nackten Zahlen der US-Wirtschaft dem Erdmittelpunkt. 500 Milliarden Dollar brauchen die USA jedes Jahr von der Welt, 1,37 Milliarden jeden Tag, auch samstags und sonntags. In den neunziger Jahren haben die Anleger der Welt gern ihr Geld in die USA geschaufelt, weil dort die höchsten Renditen erzielt werden konnten. Die Wirtschaft wuchs in einem atemberaubenden Tempo, weil die Informationstechnologie große Gewinne versprach und die damalige US-Regierung unter Präsident Bill Clinton ein kleines Wunder vollbrachte. Unter seinen Vorgängern waren die Vereinigten Staaten nahezu hoffnungslos verschuldet. Durch Reformen und drastische Kürzungen des Militärhaushaltes erreichte Clinton nicht nur einen ausgeglichenen Haushalt, sondern erwirtschaftete sogar einen Überschuss.
Vorbei.
Während die US-Wirtschaft in den neunziger Jahren internationale Anleger mit Wachstumsraten von über fünf Prozent locken konnte, betrug das Wachstum Ende vergangenen Jahres nur noch 1,4 Prozent. Die übersteigerten Hoffnungen in die Informationstechnologie sind zerplatzt. Die Skandale um Enron und Worldcom haben das Vertrauen der Anleger erschüttert. Es gibt immer weniger Gründe, sein Geld in den USA anzulegen.
Den schwersten Klotz
hat US-Präsident Bush der Wirtschaft seines Landes ans Bein gebunden: Schulden. Er hat den Verteidigungshaushalt nahezu explodieren lassen. Rüstung ist, ökonomisch gesehen, keine Investition, sondern purer Konsum, eine Art Subvention einer Branche. Wie bei uns die Kohle-Subventionen. Die Milliarden arbeiten nicht, sondern werden buchstäblich verbrannt. Für das kommende Jahr schätzt die Investmentbank Goldman Sachs das US-Defizit auf 5,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Zum Vergleich: Den Euroländern erlauben die Maastricht-Kriterien maximal drei Prozent.
Bei dieser Berechnung
des Defizits sind die Kriegskosten noch nicht dabei. Werden sie einbezogen, prognostizieren viele Ökonomen bereits ein Minus von bis zu neun Prozent. Viel hängt davon ab, wie teuer Krieg und Wiederaufbau am Golf werden. Sicher ist, dass kein Wissenschaftler von den 75 Milliarden Dollar ausgeht, die Präsident Bush offiziell veranschlagt. Ihre Schätzungen bewegen sich zwischen 700 Milliarden und 3,5 Billionen Dollar. Egal, wie gigantisch die Kosten sein werden, um sie bezahlen zu können, müssen die USA noch mehr Schulden machen. Mehr Schulden bedeuten sofort noch mehr Zinsen. Die muss der Steuerzahler aufbringen. Also mehr Steuern. Wer mehr Steuern zahlt, kann weniger kaufen. Das bewirkt mehr Arbeitslose, die dann noch weniger kaufen. Und so weiter. Die Lawine rollt.
Amerika ist nicht nur die größte Militärmacht und die größte Wirtschaftsmacht aller Zeiten. Es ist auch der größte Schuldner. Öffentliche und private Haushalte der USA sind zusammen mit der gigantischen Summe von 30 Billionen Dollar verschuldet. So viel erwirtschaftet die ganze Welt in einem Jahr. Amerikaner kaufen fast alles auf Pump. Das funktioniert, solange man in der Zukunft - wenn die Zahlungen fällig werden - mehr Geld zur Verfügung hat als heute. In den boomenden neunziger Jahren ging das gut. Doch in Krisenzeiten setzt diese Art des Wirtschaftens eine Spirale nach unten in Gang. Entweder die Käufer können ihre Schulden nicht zurückzahlen und die Unternehmen bekommen ihr Geld nicht. Oder die Kunden werden vorsichtiger und kaufen weniger. Beides ist Gift für die Konjunktur.
Amerika hat sich
heillos übernommen. Die einzige alles dominierende Weltmacht zu sein ist teuer. Die USA können sich ihre Dominanz schlicht nicht leisten. Steht das amerikanische Imperium, auf dem Höhepunkt seiner Macht, vor dem Ende? "Alle großen Imperien endeten mit dem Zerfall ihrer Währung und einem großen Schuldenberg", sagt Börsenguru Marc Faber. In den USA wird bereits seit einigen Jahren offen über das Ende der Großmacht USA debattiert. Der Historiker Paul Kennedy von der Universität Yale hat nach dem Grund für den Fall großer Mächte geforscht und die "imperiale Überdehnung" als Todesursache der meisten Imperien ausgemacht. Heute sieht er die Weltmacht USA vor einer "Überdehnung".
Der Harvard-Politologe
Joseph Nye ist überzeugt, dass man ein Weltreich nicht mit militärischen Mitteln zusammenhalten kann. Das würde zu teuer. Viel wichtiger als das Militär sei "soft power", sanfte Macht, "also die Fähigkeit, Ziele durch Überzeugungsarbeit zu erreichen statt durch Zwang". Die Welt muss ihrer Weltmacht freiwillig folgen, sonst wird das Imperium untergehen wie das Römische Reich oder das Britische Empire.
Alles hoffnungslos?
Die Volkswirtschaften des alten Europa und Japans haben sich in den vergangenen Jahrzehnten dadurch ausgezeichnet, erkannte Probleme nicht bewältigen zu können. Selbst dann nicht, wenn alle Schwierigkeiten detailliert und unbestreitbar analysiert wurden und die Lösungen fertig ausgearbeitet vorliegen. Anders die USA. Die entscheidende Fähigkeit der Vereinigten Staaten im vergangenen Jahrhundert war die Fähigkeit zur Korrektur. Und die weitsichtigsten, fundiertesten und vor allem einflussreichsten Kritiker der aktuellen US-Machtpolitik kommen nicht aus Europa, sondern aus den Vereinigten Staaten selbst.