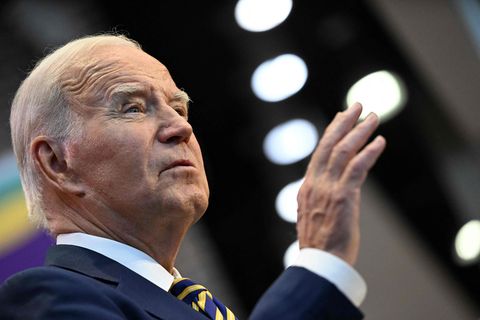Zugegeben, das Ding geht nicht gerade ab wie die sprichwörtliche Feuerwehr, aber immerhin kann er Chevrolet Sequel Concept Car im Verkehr gut mithalten – erstaunlich gut sogar für ein Auto, bei dem handwarmer Wasserdampf aus dem Auspuff kommt. "Das ist das Auto der Zukunft", behauptete steif und fest Byron McCormick, Chef der Fuel-Cell-Technologie beim Autoriesen General Motors, und damit könnte der gute Mann recht haben, Wasserstoff, der Sprit des Sequels, dürfte langfristig die beste Ersatz für Benzin als Energiequelle sein. Alle großen Hersteller, von Mercedes Benz bis hin zu Honda und Toyota, arbeiten auf den Einsatz des umweltfreundlichen, weil emissions-freien Antriebsmittels hin. Im Gegensatz zu – sagen wir mal - BMW vertrauen die Detroiter jedoch auf gasförmiges Hydrogen und feuern damit drei Elektromotoren an, zwei davon in den Hinterrädern. Die Münchner hingegen verwenden flüssigen Wasserstoff in einem stark modifizierten 12-Zylinder-Motor, der in "normalen" Siebenern stink-normales Benzin schluckt. "Mit dem Sequel beweisen wir", sagte General Motors Vice Chairman Bob Lutz zu stern.de, "dass wir führend sind in umweltfreundlichen Autotechnologien."
GM kann auch High-Tech
Der Hydrogen-Elektro-Hybrid (so die offizielle GM-Terminologie) ist jedoch nicht die einzige Revolution, die der sonst eher hüftlahme Autoriese General Motors in den Sequel steckte: das recht zivil daherkommende Fahrzeug fährt mit hochmoderner Drive-by-Wire Technik. Das heißt, es gibt weder Lenksäule, noch eine analoge Verbindung des Gaspedals zum Motor. Und auch das Bremsen wird – vollkommen hydraulik-frei – vom Computer gesteuert. Damit fährt es sich überraschend gut. Auf den Strassen des Camp Pendleton Militärlagers der US Marines, die unter anderem dafür zu sorgen hatten, dass keiner der Journalisten auf dumme Ideen kommt, konnte ich eine kleine, recht unaufregende 20-Meilen Runde mit dem Sequel drehen. Und siehe da: Bis auf eine etwas sperrige Lenkung (eine Kinderkrankheit, wie mir ein GM-Techniker versicherte) lässt sich die Revolution ganz konventionell durch die Gegend kutschieren. Die Beschleunigung ist zwar nicht atemberaubend, aber da Elektromotoren eine grade und oft steile Drehmomentkurve haben, ist die Beschleunigung im Alltagsverkehr durchaus kompatibel. Auf dem Papier bringen allein die zwei Motoren in den Hinterrädern mehr als 1600 Newtonmeter auf den Asphalt. In Wirklichkeit verhindert das enorme Gewicht des Sequels jedoch Kopfabreißende Beschleunigungswerte. Die Höchstgeschwindigkeit soll bei runden 150 km/h liegen, was auf Grund der strikten Einhaltung der amerikanischen StVO durch die Marines leider nicht auszuprobieren war. Die Reichweite des Sequels gibt GM optimistisch mit über 450 Kilometern an, aber auch diese Aussage war nicht zu überprüfen. Die Bremsen regulieren den Bremsdruck entsprechend der Reaktion des Fahrers, und ja, sie stoppen das tonnenschwere Fahrzeug souverän ab. Im Inneren ist reichlich Platz, selbst wenn man bedenkt, dass die Passagiere auf der Rücksitzbank ungewohnt hoch sitzen (auf drei Wasserstoff-Tanks und einem Elektromotor, der im Tunnel zwischen und unter dem Rücksitz positioniert ist). Aus dem ungewohnt geformten Auspuffschlitzen strömt warme Luft, die laut einem GM-Mitarbeiter auch ganz gut dazu taugt, sich vor der morgendlichen Fahrt ins Büro die Haare zu föhnen. Abgesehen von einigen leicht futuristisch anmutenden Instrumenten und dem nähmaschinenähnlichen Surren, das das Motorgeräusch ersetzt, könnte man also durchaus meinen, nichts Neues aus Detroit. Und wie ein Umstürzler sieht der Sequel– im Gegensatz zu früheren Versionen von Fuel Cell Concept Cars – auch nicht aus: unter der kurzen Motorhaube finden sich grade mal ein paar Steuerungselemente und die monströse Klimaanlage. Nur die überdimensionalen Kühllufteinlässe an der Frontpartie und entsprechende Auslässe im Heck weisen darauf hin, dass sich etwas tut im Land der amerikanischen Fortbewegungsmittel. "Wir wollen keine Hemmschwelle aufbauen", erklärt Bob Lutz die zurückhaltende Optik. "Das Auto muss aussehen wie jedes andere auch."
Handverlerlesene Mini-Serie
Das ist den Chevrolet-Leuten mit dem Equinox Fuel Cell bestens gelungen, dem zweiten wasserstoffangetriebenen Modell, das General Motors im kalifornischen Dana Point vorstellte. Im Gegensatz zur Concept-Studie des Sequel wird der Equinox tatsächlich in Serie gehen, wenn auch nur in eine extrem kleine: 100 Stück der Hydrogen-SUVs werden Ende 2007 an interessierte Amerikaner in Los Angeles, New York und Washington verleasen, um die Alltagstauglichkeit des neuen Antriebs zu testen. Die Leasing-Raten sollen denen eines regulären SUVs entsprechen, und das obwohl in der Industrie geschätzt wird, dass die Herstellung eines straßentauglichen Hydrogen-Hybrids deutlich mehr als eine Million Dollar pro Stück kosten dürfte. Wie im Sequel treibt die wasserstoffbetriebene Fuel Cell Elektromotoren an. Der Equinox jedoch – äußerlich nur auf den zweiten Blick vom normalen Modell zu unterscheiden, wenn man denn auf die spinnerte Bemalung verzichtet – kommt deutlich konventioneller daher als selbst der Sequel. Der Equinox verzichtet auf Drive-by-Wire Technologie, was hauptsächlich mit der Angst der Amerikaner vor Millionen-Klagen bei Ausfällen der Elektronik zu tun hat, denn mit technologischen Hürden, wie mir ein GM-Techniker hinter vorgehaltener Hand mitteilte.
Das Hindenburg-Syndrom
Womit wir beim Thema der Sicherheit wären. Die Vorstellung auf 700bar gasförmigen Wasserstoff zu sitzen, erzeugt nicht bei allen Konsumenten kuscheliges Wohlgefühl. Aber offensichtlich ist für die Chevrolet-Ingenieure die Sicherheit kein Problem mehr. Die Tanks haben selbst einen direkten 80km/h-Aufprall ohne Leck überstanden und hielten extremster Belastung stand. Und auch das Problem von Wasserstoffaustritt beim Tanken sei schon seit geraumer Zeit gelöst. Da kommt die Frage auf, wo das Tanken denn stattfinden solle.
Rechtzeitig zur Einführung des Equinox will die Benzinfirma Shell dreizehn Tankstellen in den drei Ballungsräumen installiert haben, an denen Wasserstoff getankt werden kann, zu Kosten, die dem eines Liters Benzin entspricht. Wenn Treibstoffpreis und erwarteter Verbrauch durchkalkuliert sind, könnte man die geplanten 300 Kilometer Reichweite (die Equinox-Fuel Cell ist eine Entwicklungsgeneration hinter der des Sequels in Leistung und Reichweite) für etwa die Hälfte der Kosten fahren, die bei herkömmlichen Benzinmotoren entstehen. Allerdings nicht so lang: die Lebensdauer des Equinox Fuel Cell – und die entsprechende Länge des Leasings-Vertrags – liegt bei grade mal zweieinhalb Jahren und 50.000 Meilen.