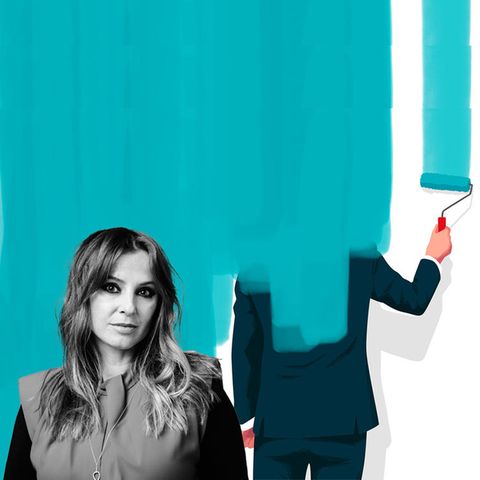Oft heißt es: Wir müssen reden. Paare müssen reden, logo, wobei die meisten Paare, die ich kenne, sich nach ihrer Paartherapie getrennt haben. Immer öfter denke ich, hätten sie doch nur weniger geredet.
Seit einigen Jahren müssen auch Bürgerinnen und Bürger reden, als seien sie Paare, schließlich geht es um nichts Geringeres als die große Dame Demokratie! Man muss also heute mit Rechten reden, sonst ist man schon fast ein Linksextremist. Vor sechs Jahren initiierte "Die Zeit" die Kampagne "Deutschland spricht!", bei der Menschen wie auf Tinder zusammenfanden, nur nicht, um Körperflüssigkeiten auszutauschen, sondern politische Weltanschauungen. Man fordert uns fortwährend auf zum intellektuellen Geschlechtsverkehr. Allein dieser Anspruch: Deutschland spricht!
Auch die Bundesregierung setzt auf Dialog, wenn es Bilder von Bürgernähe braucht. Selbst die katholische Kirche, auf deren Ignoranz gegenüber Trends sonst Verlass ist, lud während der Weltsynode in Rom Luisa Neubauer ein, um über das Klima zu reden. Wann wurde das Reden zum Allheilmittel erklärt? Wer hat belegt, dass diese ständige Aufeinanderloslasserei von vermeintlichen Gegensätzlichkeiten ein Gewinn für die Demokratie ist? Wo ist der Traum hin, friedlich nebeneinanderher zu leben?
"Ach, hätten wir doch einfach nicht geredet!"
Jeder sagt heute vermeintlich selbstkritisch "in meiner Blase". Die Blasen wurden zum Problem erklärt, als wären wir alle eingeschlossen in seifenblasenartigen Lebenswelten. Ich erinnere mich, wie in der siebten Klasse das Schulfach Politik eingeführt wurde und mein von mir bis heute verehrter Politiklehrer fragte, wie wir die Gruppe junger Punker erklären würden, die vor unserem Schulgebäude saß und nicht mit uns im Klassenraum. Er malte Kreise an die Tafel, Identitäten wohl – gut, malen konnte er nicht. Er erzählte von Peergroups, von sozialen Gruppen, denen sich ein Individuum zugehörig fühlt. Die Punker fühlten sich uns nicht zugehörig, heute würde das eine Blase genannt. Eigentlich ließen wir sie in Ruhe und sie uns. Viele Punks machten ziemlich geile Musik, weshalb man manchmal auf Partys mit ihnen zu tun hatte. Die Wege kreuzten sich kurz, und man ließ sich wieder in Ruhe, das Normalste der Welt.
Vermutlich hätte es die Modedesignerin Vivienne Westwood nie gegeben, wenn man sie ständig eingeladen hätte, sich mit anderen Blasen zu unterhalten. Alles Punkige an ihr wäre weggelabert worden, oder sie hätte keine Zeit für ihr Design gehabt.
Mir geht das zunehmend auf die Nerven, dass wir uns aufeinander loslassen, als hätten wir nicht eben auch das Recht, uns vorwiegend dort einzurichten, wo wir uns wohlfühlen. Ein Alltag ohne Durchmischung ist ohnehin unmöglich, es sei denn, ich hätte einen Fahrer, einen Privatdoc etc. Verwaltungen mischen sich ständig ins Dasein ihrer Bürger ein, weil man diesen ominösen Zusammenhalt sucht. Vielleicht hielten wir lose besser zusammen, statt uns ständig redend zueinander zu zwingen.
Manche behaupten, in den sozialen Medien lebe man völlig in seiner Blase. Dabei treffe ich dort auf Leute, die ich sonst nie kennengelernt hätte. Ich hätte mich etwa nie länger zu Barbourjackenträgern gestellt, war nicht meine Peergroup. Heute würde man mir meine Neigung, Menschen aus dem Weg zu gehen, schon als Diskriminierung auslegen. Im Netz hetzen die Algorithmen schonungslos politische Gegner aufeinander. Man debattiert, wie es heißt, dabei unkt man eher hohl herum. Meistens denke ich am Ende: Ach, hätten wir doch einfach nicht geredet! Die Demokratie gäbe es sicher immer noch.