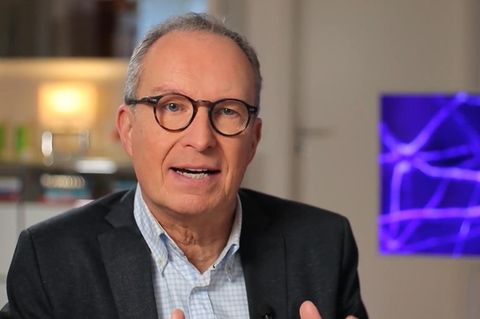Beim Fußballspielen ging Kerim Ucar schnell die Puste aus, er fühlte sich oft müde und schlapp, konnte sich in der Schule nicht mehr konzentrieren. So konnte es nicht mehr weitergehen, es musste etwas geschehen.
Und die Ursachen für seine Misere waren ja bekannt: Seit seiner Geburt leidet Kerim Ucar unter einer Kugelzellanämie. Bei dieser seltenen Erbkrankheit ist die Hülle der roten Blutkörperchen defekt. Sie nehmen eine kugelige Form an und werden von der Milz, die dabei immer dicker wird, vorzeitig aussortiert. Schon als Kind und Jugendlicher, so erinnert sich seine Mutter, habe er sich mehrerer Blutransfusionen unterziehen müssen.
Die Krankheit ist nicht heilbar, deswegen greifen die Ärzte oft zu einer radikalen Therapie: Sie entfernen die Milz fast vollständig. Ohne das Organ geht es den Kranken besser, weil die roten Blutkörperchen länger überleben. Mit neun Jahren war Kerim deshalb schon einmal die Milz zu 98 Prozent herausgenommen worden. "Danach ging es ihm deutliche besser", erzählt seine Mutter Durna Ucar.
Doch nun war das Organ nachgewachsen. Also musste der 18-jährige Oberschüler erneut unters Messer. Die Operation im Klinikum Bremen-Mitte fand am 5. Oktober 2017 statt. Um 13.07 Uhr setzte Oberarzt Doktor E. den ersten Schnitt. Zwei Ärztinnen, ein OP-Pfleger und eine OP-Schwester attestierten ihm.
Im Bauchraum stieß der Chirurg, wie er später im Protokoll notierte, auf "reichlich Verwachsungen". Der Arzt tat sich schwer, die Milz eindeutig zu identifizieren. Er verließ den Operationstisch und telefonierte mit einem Kollegen, der vor dem Eingriff den Bauchraum mit bildgebenden Verfahren untersucht hatte. Dann ging Doktor E. zurück zu Kerim, suchte in dessen Bauchhöhle weiter nach der Milz. Als er meinte, sie gefunden zu haben, schnitt er das Organ heraus. Um 16.03 Uhr, nach fast genau drei Stunden, war die Operation erledigt.
Pathologie schlägt Alarm
Danach ging es dem jungen Mann schlecht. "Er musste sich übergeben, war ganz gelb und total schwach", erzählt seine Mutter. "Ein Arzt hat mich beruhigt. Er sagte, er sei zwar nicht bei der OP dabei gewesen, aber laut Krankenakte sei alles gut verlaufen." Doch auch am nächsten Tag besserte sich Kerims Zustand nicht. Mittags sei eine Ärztin erschienen. "Sie machte eine Ultraschalluntersuchung", erzählt die Mutter. "Sie wirkte sehr aufgeregt, konnte mir nicht in die Augen schauen. 'Waren Sie bei der OP dabei?', habe ich sie gefragt. Die Ärztin nickte und ist dann schnell verschwunden."
Denn inzwischen hatte die Pathologie Alarm geschlagen. Dort sollten die Ärzte das Organ nach der Entnahme untersuchen. Doch was sie ins Labor geliefert bekamen, war keine kranke Milz, sondern Kerims gesunde linke Niere.
Es gibt in Deutschland keine Statistik, die verlässlich Behandlungsfehler erfasst. Die Ärzte des "Medizinischen Dienstes des Spitzenverbandes Bund Deutscher Krankenkassen" haben 2017 rund 13.500 vermeintliche Behandlungsfehler von Kollegen begutachtet. In fast einem Viertel der Fälle stellten sie tatsächlich Kunstfehler fest. Experten schätzen, dass bis zu 40.000 Patienten pro Jahr betroffen sind. Nach einer Studie des Robert Koch Instituts machen Chirurgen die meisten Fehler.
Stundenlang saß Durna Ucar am Bett ihres Sohnes. "Kerim erbrach sich, hatte Bauch- und Kopfweh, seine Haut färbte sich gelb, er war kaum ansprechbar." Gegen 16 Uhr seien zwei Ärzte gekommen, der Klinikchef und Doktor E. "Sie führten mich in einen Raum. Auf dem Weg dorthin rasten meine Gedanken. Haben sie einen Tumor entdeckt? Hat Kerim Krebs?"
Die Ärzte sagten der Mutter, dass die Organe bei der OP verwechselt worden waren. Die Niere sei tot und könne nicht wieder eingesetzt werden. "Ich war geschockt, konnte gar nicht richtig denken", erzählt Durna Ucar. "Doktor E. hat sich mehrmals entschuldigt, dass er Milz und Niere verwechselt hat, aber eine richtige Erklärung für seinen Fehler hatte er nicht."
Die Mutter erstattete Anzeige. Seit fast anderthalb Jahren ermittelt die Staatsanwaltschaft Bremen nun gegen Doktor E. wegen fahrlässiger Körperverletzung. Zusätzlich bereitet der Marburger Rechtsanwalt Hans-Berndt Ziegler, der Ucar vertritt, eine Zivilklage vor. 200.000 Euro Schmerzensgeld und Schadenersatz will er für seinen Mandanten erstreiten.
Er hat ein Gutachten beim Medizinischen Dienst der Krankenkassen in Auftrag gegeben, das zu einem eindeutigen Ergebnis kommt: Die Verwechslung von Milz und Niere zähle zu den "Never Events", also zu den Fehlern, die nicht passieren dürften. Er hätte durch eine "sehr sorgfältige Operationstechnik und eine sehr sorgfältige anatomische Orientierung" vermieden werden können.
Doktor E., inzwischen 61 Jahre alt, gilt als erfahrener Chirurg. Als er von seinem Fehler erfuhr, habe er "völlig unter Schock gestanden", erinnert sich ein Kollege. War der Arzt überarbeitet? Kaum eine Schicht endet im Krankenhaus ohne Überstunden, und besonders belastet sind Chirurgen.
Arzt rechtfertigt sich bei der Staatsanwaltschaft
Über seinen Verteidiger hat Doktor E. der Staatsanwaltschaft mitteilen lassen, dass die Milz nicht mehr ausgesehen habe wie eine Milz. Normalerweise liegt sie hinter dem Magen oberhalb der linken Niere, bei Ucar aber sei sie hinters Herz an die Stelle der Niere gerutscht und habe mehrere dicke Venen ausgebildet. Anwalt Ziegler überzeugt das nicht. "Die Niere hat mehr Ausgänge als die Milz. Von ihr geht der Harnleiter ab, der durchtrennt wurde. Wenn der Arzt schon unsicher war, hätte er das merken müssen."
Auch die beiden Ärztinnen und die OP-Pfleger haben offenbar nichts bemerkt. Oder trauten sie sich nicht, den Oberarzt zu korrigieren? Alle verweigern die Aussage, fürchten offenbar, dass auch sie zur Rechenschaft gezogen werden könnten. Ein OP-Pfleger sagte seinen Vernehmungstermin bei der Polizei ab. Ein Vorgesetzter habe ihm geraten, sich mit einem Anwalt abzustimmen, sagte er zur Begründung. Eine Anästhesistin, die nicht bei der OP dabei war, gab zu Protokoll, dass die Stimmung auf der Station nach Entdeckung des Fehlers schlecht gewesen sei. Auf ihre Frage, was genau passiert sei, hätten die Kollegen geschwiegen.
Die Angst vor Strafe verhindert in Kliniken offenbar noch immer eine "offene Fehlerkultur", die sich die Bundesärztekammer nach Behandlungsfehlern wünscht. Dabei haftet in der Regel die Klinik, die Versicherung zahlt. Nur bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz haftet der Arzt selbst, riskiert Job und Anklage. Ob Doktor E. wirklich grob fahrlässig gehandelt hat, will die Staatsanwaltschaft nun mithilfe eines weiteren Gutachtens klären. Es ist fraglich, ob sie den Mediziner überhaupt anklagen wird.
Der Zivilprozess, den Rechtsanwalt Ziegler nun führen will, könnte allerdings Jahre dauern, der Ausgang ist ungewiss. 200.000 Euro – die Summe, die Ziegler für seinen Mandanten erstreiten will – sprach das Oberlandesgericht Hamm 2015 einer 15-Jährigen zu. Sie hatte aber nicht nur eine, sondern beide Nieren verloren, weil ihre Hausärztin sie falsch behandelt hatte. Über fünf Jahre zog sich der Prozess hin. Das Landgericht Bielefeld hatte die Klage zunächst abgewiesen. Zwar sind die Rechte von Patienten 2013 gestärkt worden. Allerdings müssen Kläger noch immer beweisen, dass sie Opfer eines ärztlichen Kunstfehlers geworden sind. Patientenverbände fordern schon seit Jahren die Umkehr der Beweislast.
Kerim Ucar: "Ich habe Angst vor der Zukunft"
Kerim Ucar ist inzwischen ein zweites Mal operiert worden. Die kranke Milz ist raus. Trotzdem geht es ihm körperlich und seelisch schlecht. Er ist zu 30 Prozent behindert. "Ich habe gern Fußball gespielt, dazu bin ich eigentlich gar nicht mehr in der Lage", sagt er. "Früher habe ich viel mit Freunden unternommen. Jetzt bin ich wesentlich zurückgezogener und mit mir allein. Ich komme kaum noch aus meinem Zimmer raus. Ich habe Angst vor der Zukunft. Ich wollte Polizist werden oder zur Bundeswehr. Das dürfte nun wohl ausgeschlossen sein. Ich habe auch Angst, dass ich irgendwann gar nicht mehr arbeiten kann." Er macht inzwischen eine Psychotherapie.
Auch seine Mutter sei "wegen der ganzen Sache" depressiv geworden, wie sie sagt, und kann derzeit nicht in ihrem Beruf als Verkäuferin arbeiten. Sie sollte zur Reha. Doch sie müsse zu Hause bleiben, um für ihren Sohn da zu sein, weil "sonst ein nicht kalkulierbares Risiko für suizidale Handlungen oder Retraumatisierung bei Herrn Ucar besteht", wie Kerims Ärztin der Krankenkasse schrieb.
"Mit einer Niere könne man prima leben, haben die Ärzte im Krankenhaus gesagt", erzählt Kerims Mutter. "Aber sollte er je eine Niere brauchen, wird er auf die Warteliste gesetzt und muss hoffen, dass er rechtzeitig eine bekommt."
Tatsächlich sind Spendernieren in Deutschland knapp, Patienten müssen sechs bis sieben Jahre auf ein Organ warten. Wer auf die Warteliste kommt, ist streng geregelt. "Die Vermittlung muss … nach Erfolgsaussicht und Dringlichkeit erfolgen und dem Grundsatz der Chancengleichheit entsprechen", heißt es in den Richtlinien. Patienten, die ohne Transplantation sterben würden, "werden bei der Organvermittlung vorrangig berücksichtigt". Es ist deshalb ausgeschlossen, dass Kerim Ucar im Ernstfall bevorzugt behandelt würde, weil er seine gesunde Niere durch den Fehler eines Arztes verloren hat. "Wir können nur hoffen, das seine Niere gesund bleibt", sagt seine Mutter. "Aber mit der Angst muss Kerim nun leben. Auch mit Geld ist das nicht wiedergutzumachen."