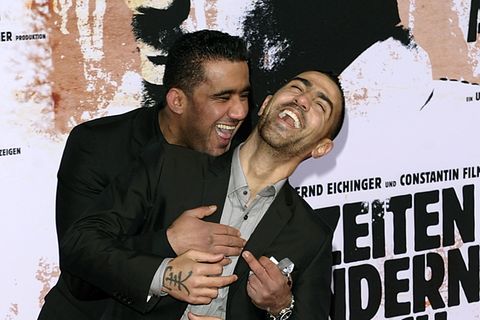In Deutschland sind Serien und Dokumentationen über Clans längst zu einem popkulturellen Phänomen geworden. Teile der Berichterstattung haben aus Geschichten über kriminelle Mitglieder arabischer Großfamilien ein boomendes Geschäftsmodell gemacht − sehr zum Leid der Mehrheit ihrer Familienmitglieder, die versuchen ein normales Leben zu führen. Zu diesen gehört auch Mohamed Chahrour, der als Musiker und Schauspieler arbeitet, wegen seines Nachnamens dennoch häufig von der Polizei festgehalten, im Straßenverkehr überprüft oder auf Drogen kontrolliert wird.
Durch die Gründung seines Berliner HipHop-Labels "Royal Bunker" gerät auch Journalist Marcus Staiger bereits Anfang der 2000er im Umfeld des Rappers Bushido in Kontakt mit Mitgliedern des Abu-Chaker-Clans. Als er einige Jahre später als Chefredakteur von Rap.de einen kritischen Text über den Rapper veröffentlich, klingelt sein Handy. Bushidos ehemaliger Manager Arafat Abu-Chaker ist am Telefon. Staiger rechnet mit einem Streit, doch die beiden verstehen sich gut.
Chahrour und Staiger haben zu dem Thema arabische Clans in Deutschland die letzten zwei Jahre recherchiert und den Podcast "Clanland" aufgenommen. Dieser möchte nicht über sondern mit arabischen Clans sprechen. Im Interview mit dem stern berichten sie von den Ergebnissen ihrer Recherche. Ein Gespräch über rassistische Stigmatisierungen, eine verfehlte Berichterstattung und das Glück, in einer Großfamilie Freunde fürs Leben zu finden.
Herr Chahrour, Sie kommen aus dem berühmten Berliner Chahrour-Clan. Wie reagieren Menschen, wenn sie Ihren Nachnamen hören?
Chahrour: Das kommt immer auf die Lebenssituation an. Ich bezeichne diese Facette meines Lebens gerne als "Fluch des Namens". In Kontakt mit der Polizei kann man sich wahrscheinlich denken, dass die Kontrollen spaßig und lang ausfallen. An meinem Ausbildungsplatz zum Einzelhandelskaufmann wurde mir nach der Probezeit gesagt: "Bist ein guter Junge, aber dein Nachname schadet unserem Image, das können wir nicht machen". Auch später, während meiner Arbeit in der Synchronbranche, wurde ich zur Seite genommen und gefragt, ob man Angst vor mir haben müsste. Manchmal kennt jemand auch Cousins von mir und freut sich, mich kennenzulernen. Es ist ein wenig als sei ich berühmt: Ist jemand freundlich oder abweisend mir gegenüber, weiß ich nie ob ich oder mein Nachname daran schuld ist.

Herr Staiger wie haben Sie reagiert, als Sie Mohameds Nachnamen das erste Mal gehört haben?
Staiger: Ich habe vor Mohamed erst mal seinen Cousin Ali kennengelernt. Wir alle drei machen Brazilian Jiu-Jitsu – beim Training habe ich die beiden das erste Mal getroffen. Der Nachname Chahrour sagte mir sofort etwas, weil ich mich mit den Großfamilien in Berlin gut auskenne. Ali dachte damals, ich sei Polizist: Ein älterer sportlicher Herr, der Kampfsport macht und viel über die Berliner Großfamilien weiß − das passte super ins Bild eines LKA-Beamten (lacht). Ich habe lange Zeit gebraucht, um ihn vom Gegenteil zu überzeugen.
Warum einen Podcast über arabische Clans, wird darüber nicht schon genug berichtet?
Staiger: Als Mohamed mich gefragt hat, ob ich Lust hätte, mit ihm ein Buch über das Thema arabische Großfamilien in Deutschland zu schreiben, habe ich sofort ja gesagt, weil ich die Perspektive spannend finde. Die Berichterstattung über arabische Clans hatte ich zuvor immer als rassistisch konnotiert wahrgenommen. Ich dachte es sei an der Zeit, endlich auch mal eine Geschichte aus der Innenansicht zu erzählen.
Was ist denn ein arabischer Clan überhaupt genau?
Chahrour: Das ist schwierig zu sagen, denn darüber ist sich auch die Wissenschaft nicht einig. Aus Sicht der arabischen Community definieren wir einen Clan über Zweige, die sich auf Großväter berufen. Ein Clan hat mindestens vier bis höchstens zwölf dieser Abstammungs-Zweige.
Staiger: Die Urväter, auf die sich diese Abstammungsfolge bezieht, sind dabei teilweise reine Fiktion.
Chahrour: Nicht immer, aber das stimmt, solche Fälle gibt es auch. Manche Clans führen sich sogar auf ein Totemtier zurück. Insgesamt geht es bei der Organisation eines Clans vor allem um Genealogie
Staiger: Ich wurde mal gefragt, ob Clanmitglieder arabischer Großfamilien nicht sowas wie Adelige sind − ein wenig ist das so! Clanmitglieder tragen einen Stammbaum mit sich herum, pflegen diesen und sind darauf natürlich auch stolz.
Herr Chahrour, wie sieht Ihr Leben als Mitglied eines arabischen Clans aus?
Chahrour: Das ist in etwa so, als wenn ich einen Deutschen fragen würde: "Hey wie sieht denn dein Leben in einer deutschen Familie aus?" Wie beschreibt man Normalität? Das ist schwierig für mich. Seit meiner Geburt vor 28 Jahren bin ich Mitglied eines Clans und ich weiß nicht, wie das Leben außerhalb eines Clans aussieht. Ich bin in einer ganz normalen Kernfamilie aufgewachsen, so wie das in einer deutschen Familie auch läuft. Na klar gibt es Unterschiede: Wir ziehen zum Beispiel erst aus, wenn wir geheiratet haben.
Staiger: Neulich hast du gesagt, dass das Aufwachsen in einem Clan für dich vor allem Geborgenheit bedeutete.
Chahrour: Aber diese Geborgenheit existiert ja auch in deutschen Familien. Denke ich an meinen Clan, dann denke ich vor allem an die Liebe, die ich dort erfahren durfte. Meine Cousins und Cousinen sind teilweise meine besten Freunde. Andererseits gibt es in meinem Clan auch Leute, mit denen ich absolut gar nichts anfangen kann und mit denen ich auch nichts zu tun haben möchte. Da denke ich mir manchmal: Also den hätte man sich echt sparen können (lacht)! Ich habe meine Familie sehr lieb, aber manchmal ist es auch anstrengend, wenn man zum dritten Mal einen Keller ausräumt, weil wieder irgendein Cousin beschlossen hat, dass seine Reifen jetzt dort an der Wand stehen müssen. Manchmal lehne ich deshalb Einladungen zum Tee ab, weil ich genau weiß, dass ich wieder irgendwas schleppen muss, wenn wir ausgetrunken haben. Das Schöne ist aber: Ich habe immer genug Leute, die mir beim Umzug helfen und brauche ich beispielsweise einen Arzt oder eine Handwerkerin, dann finde ich das oft in meiner Familie. Ein Clan bedeutet auch Geborgenheit.
Kennt man als Mitglied eines Clans alle seine Familienmitglieder?
Chahrour: Auf gar keinen Fall, nein! Allein die Nachkommen meines Großvaters sind über 100 Leute. Ich kenne nicht mal alle meine Onkel und Tanten ersten Grades. Einmal stand ich an einem Ticketschalter, als der fremde Mann vor mir sagt: "Für mich wurden Karten auf den Namen Chahrour zurückgelegt." Dann hab ich ihn erstmal begrüßt mit: "Hey Cousin, ich bin auch aus der Chahrour-Familie." Wir haben dann ganz herzlich miteinander gequatscht und uns erzählt wer unsere Eltern sind.
Wie alt waren Sie, als Ihnen der große Name Ihrer Familie bewusst wurde?
Chahrour: Da war ich sechs Jahre alt und stand umringt von anderen Kindern auf dem Pausenhof. Viele von ihnen kannten jemanden aus meiner Familie, das fand ich cool. Teilweise waren Klassenkameraden mit Cousins von mir befreundet, die sollte ich von ihnen grüßen.
Überwiegen die Vorteile oder Nachteile für den Einzelnen, der den Nachnamen einer Großfamilie trägt?
Staiger: Neulich habe ich mit einem Cousin von Arafat Abu-Chaker telefoniert, der mit Kriminalität gar nichts am Hut hat. Er hat mir erzählt hat, dass seine Töchter kein Bankkonto wegen ihres Nachnamens bekommen. In Zeiten, in denen der Bargeldgebrauch abnimmt, ist das eine Einschränkung der Existenzfähigkeit. Heute brauchst du einfach ein Bankkonto. Wohnungssuche, Arbeitsmarkt, Versicherungen − das alles wird dir erschwert, weil du ein entferntes verwandtschaftliches Verhältnis zu einem Menschen hast, der in der Presse als gefährlicher Clan-Boss gilt.
Chahrour: Die Nachteile überwiegen ganz klar.

Haben Sie dazu ein Beispiel aus Ihrem Leben?
Chahrour: Einmal wollte ich einen Besichtigungstermin für eine Wohnung vereinbaren. Als ich meinen Nachnamen sagte, haben die direkt aufgelegt mit dem Satz: "So einen wie dich wollen wir hier nicht". Der Klassiker sind Polizeikontrollen. Ich muss nur irgendwo rumstehen um eine Routinekontrolle der Polizei abzubekommen. Wenn ich dem Polizisten dann meinen Ausweis gebe, liest er meinen Namen, geht mit meinem Ausweis zu seinem Wagen und kommt mit fünf Kollegen zurück. So etwas passiert mit meinem Nachnamen häufig. Mit 14 wurde ich zusammen mit meinen Freunden kontrolliert. Meine Freunde wurden normal kontrolliert, ich wurde mal wieder wie der VIP der Gruppe behandelt, bekam die Beine auseinandergetreten, wurde an die Wand geschubst und einer haut mir die Mütze vom Kopf. Von meinen Freunden wurde keiner auf Drogen kontrolliert.
Wie nehmen Sie die Berichterstattung über arabische Clans in Deutschland wahr?
Chahrour: Tendenziös!
Staiger: Nehmen wir zum Beispiel das Interview des stern mit Bushido und seiner Frau Anna-Maria Ferchichi aus dem Jahr 2019. Da wird von "500 Mitgliedern" der Großfamilien Rammo und Al-Zein gesprochen, ohne im selben Satz darauf hinzuweisen, dass nicht alle Mitglieder dieser Familie kriminell sind. Das erweckt bei den Lesern und Leserinnen ein unglaubliches Unsicherheitsgefühl.
Chahrour: Mir hat noch nie jemand eine Tüte in die Hand gedrückt und gesagt: "Hier Cousin, nimm mal dein Anteil!" (lacht). Ich gehe als Musiker und Schauspieler ganz normal arbeiten, um mein Geld zu verdienen.
Der stern berichtete tatsächlich immer wieder in den letzten Jahren über den Fall Bushido. Im selben Jahr, in dem auch das eben erwähnten Bushido-Interview erschien, folgte ein Artikel, der sich explizit mit dem Thema arabischer Clans in Deutschland beschäftigte. Darin wird unter der Überschrift: "Abgestempelt durch den Nachnamen" die Stigmatisierung nicht-krimineller Clan-Mitglieder besprochen. Auch Ihr Podcast wird von einem öffentlich-rechtlichen Sender produziert. Wird über das Thema nicht bereits differenzierter berichtet?
Chahrour: Ich nehme keine differenziertere Berichterstattung in Deutschland wahr − ehrlich gesagt, nein. Ich habe eher das Gefühl, dass sie von Jahr zu Jahr plakativer und schlimmer wird. Etwa wenn von Frauen in arabischen Clans als "Gebärmaschinen" gesprochen wird. Sowas lese ich immer noch heutzutage, dabei dachte ich, wir wollten die Geschlechterungleichheiten abbauen! Oder auch Worte wie "Clanspross" − Mann, das klingt so schrecklich, ich bin doch ein ganz normaler Mensch.
Staiger: Es gibt sicherlich ein Bemühen der Presse, das Thema zunehmend ganzheitlicher darzustellen. Aber es gibt immer noch popkulturelle und auf YouTube stark geklickte Formate, die immer in dieselbe stigmatisierende Kerbe schlagen. Wir haben nicht das Gefühl, dass sich in der Wahrnehmung und im Tonfall, in dem über das Themas gesprochen wird, sonderlich viel bewegt hat. Es ist zu viel über Clans und zu wenig mit Clans gesprochen worden – das wollen wir mit unserem Podcast überwinden.
Warum klicken sich Dokumentationen und Artikel über arabische Großfamilien in Deutschland so gut?
Staiger: Da sind wir in unserer Recherche zu keinem genauen Ergebnis gekommen. Zum einen stellen arabische Großfamilien noch immer für viele ein Mysterium dar: Es ist ein Fremdkörper unserer Gesellschaft, etwas Geheimnisvolles, in das man selbst nicht eintauchen kann. Am Ende sind es aber auch einfach die spektakulären Bilder der Verbrechen, die von einzelnen Mitgliedern dieser Familien verübt werden, durch die das Thema im TV gut vermarktet werden kann. Es ist ein Spektakel. Kriminelle Protagonisten dieser Verbrechen bedienen diese Aufmerksamkeit auch noch, oder sie werden von Kamerateams so lange belästigt, bis sie wieder einen schlimmen Satz gesagt haben.
Über was wird Ihrer Meinung nach in Bezug auf das Thema arabische Großfamilien zu wenig gesprochen?
Staiger: Über Beispiele, bei denen die sogenannte Integration funktioniert hat. Das hat in der Mehrzahl der Fälle funktioniert, wenn die politischen Rahmenbedingungen, wie beispielsweise ein Bleiberecht, gegeben waren.
Chahrour: Statt über kriminelle Straftäter zu berichten, spricht man über die Namen der Clans, die aus Menschen bestehen, die ein ganz normales Leben führen wollen. Das Konto von Clan-Mitgliedern ist immer im Minus. Wir müssen gar nichts dafür tun, um benachteiligt zu werden.
Staiger: Das Vertrauen, das mir als Marcus Staiger entgegengebracht wird, muss sich Mohamed erstmal erarbeiten. Er gilt schnell als die Ausnahme seiner Familie.
Chahrour: Dabei wollte ich nie ein Vorzeige-Araber sein. Es gibt in meiner Familie viel positivere Beispiele als mich.
Tatsächlich gibt es aber kriminelle Strukturen in arabischen Clans – gut recherchierte Dokus über kriminelle Mitglieder arabischer Großfamilien werden millionenfach auf YouTube geklickt. Darüber muss doch berichtet werden.
Staiger: Es gibt wahnsinnig gut recherchierte Beiträge über kriminelle Strukturen in Deutschland. Niemand der in Deutschland eine Dokumentation über die italienische Mafia sieht, stellt danach ganz Italien unter Generalverdacht. Und genau so müssen wir über organisierte Kriminalität einzelner Clan-Mitglieder berichten.
Schnell fällt das Wort "Parallelgesellschaft" bei kriminellen Clan-Mitgliedern.
Chahrour: Alle Kriminellen, egal welcher Abstammung, leben in einer Parallelgesellschaft. Zeig mir einen Kriminellen, der den Staat und seine Gesetze respektiert! Deshalb spricht man auch in Bezug auf kriminelle Clan-Mitglieder davon. In diese Parallelgesellschaft fehlt mir aber der Einblick.
Gewinnt das Thema durch Serien wie "4 Blocks" eine positivere Aufmerksamkeit als in der Presse?
Chahrour: Zunächst möchte ich betonen, dass ich dort zweimal beim Casting vorgesprochen habe und als Schauspieler die Kunst dieser Serien voll und ganz respektiere und anerkenne. Ich persönlich erkenne beim Gucken sofort den fiktionalen Teil der Serien, weil ich weiß, wie es in Wirklichkeit ist. Auch der deutschen Mehrheitsgesellschaft habe ich zugetraut, dass sie das Romantisierte und Dramatisierte an dieser Serie erkennt. Dann aber bin ich auf einen langjährigen Nachbarn meines Cousins getroffen, der im Bus zu mir gesagt hat: "Ey, hast du '4 Blocks' geguckt? Das ist genauso wie in Wirklichkeit, die ziehen den Staat ab, machen was sie wollen und verarschen uns Deutsche". Ich habe ihn dann gefragt, ob das sein Ernst sei, schließlich kennt er meinen Cousin und mich seit Jahren und wir hatten nie ein Problem miteinander.
Staiger: Ich würde an dieser Stelle gerne auf den Soziologen Martin Seeliger verweisen: Um in einem Film die Figur des bösen arabischen Mannes abzubilden − wie sie in "4 Blocks" auftritt − muss die Figur des bösen arabischen Mannes erstmal existieren. An dieser Stelle ist die Frage, wer diese Figur kreiert hat. Ist sie in der Realität gefunden worden? Haben die Medien diese Figur mitgestaltet? Das ist die bekannte Frage nach dem Huhn und dem Ei. Zudem darf man nicht vergessen, dass "4 Blocks" in Berlin-Neukölln spielt. Dort landen mehr junge Menschen im Knast als in sozial besser gestellten Bezirken. Das hat etwas mit der sozio-ökonomischen Struktur der Stadtteile zu tun. Die Ursachen der Kriminalität in solchen Bezirken sind sozialer Natur − das sollte endlich anerkannt werden!
Chahrour: Spricht man durch eine Serie wie "4 Blocks" von den integrationsunwilligen libanesischen Clans und Großfamilien, dann muss man im selben Atemzug auch davon sprechen, was die deutsche Politik in den 80er Jahren bei der Ankunft der Flüchtlinge aus dem Libanon versäumt hat: Ihnen uneingeschränkten Zugang zu Bildung, Kultur und Arbeit zu ermöglichen. Das war eine Politik der Abschreckung, nicht der Integration. Integration ist keine Einbahnstraße. Lasst uns aufhören gegeneinander zu arbeiten!
Wie sollte das Thema arabische Großfamilien Ihrer Meinung nach in Zukunft in der Öffentlichkeit besprochen werden?
Staiger: Soziale Verhaltensnormen werden derzeit stark vermischt mit dem Thema Organisierte Kriminalität. Das sollte in Zukunft getrennt voneinander betrachtet werden. Für Organisierte Kriminalität gibt es die Strafverfolgungsbehörden und die funktionieren auch in Deutschland. Nicht zum Thema Organisierter Kriminalität gehört eine Berichterstattung über arabische Männer, die auf der Sonnenallee in Neukölln breitbeinig sitzen, Tee trinken oder in zweiter Reihe parken. Der Staat antwortet auf beides mit Polizeieinsätzen − sowohl gegen organisiertes Verbrechen, wie auch gegen in zweiter Reihe parkende Araber. Das geht nicht, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Das eine müssen wir mit der Polizei klären, das andere müssen wir gesellschaftlich verhandeln. In der Berichterstattung muss das genauso getrennt verhandelt werden. In der arabischen Community gibt es viele unterschiedliche Individuen mit sehr unterschiedlichen Wünschen und Träumen − diese Diversität muss in Deutschland endlich anerkannt werden!
Chahrour: Was oft vergessen wird: Viele Mitglieder der arabischen Community sind richtig große Fans von Deutschland. Die Leute aus meiner Familie, die damals aus dem Libanon kamen, sind nach Deutschland gekommen, weil sie dieses Land schätzten. Die lieben dieses Land, bis sie die Zeitung aufschlagen. Ihre Beziehung zu Deutschland ist bis heute eine unerwiderte Liebe.