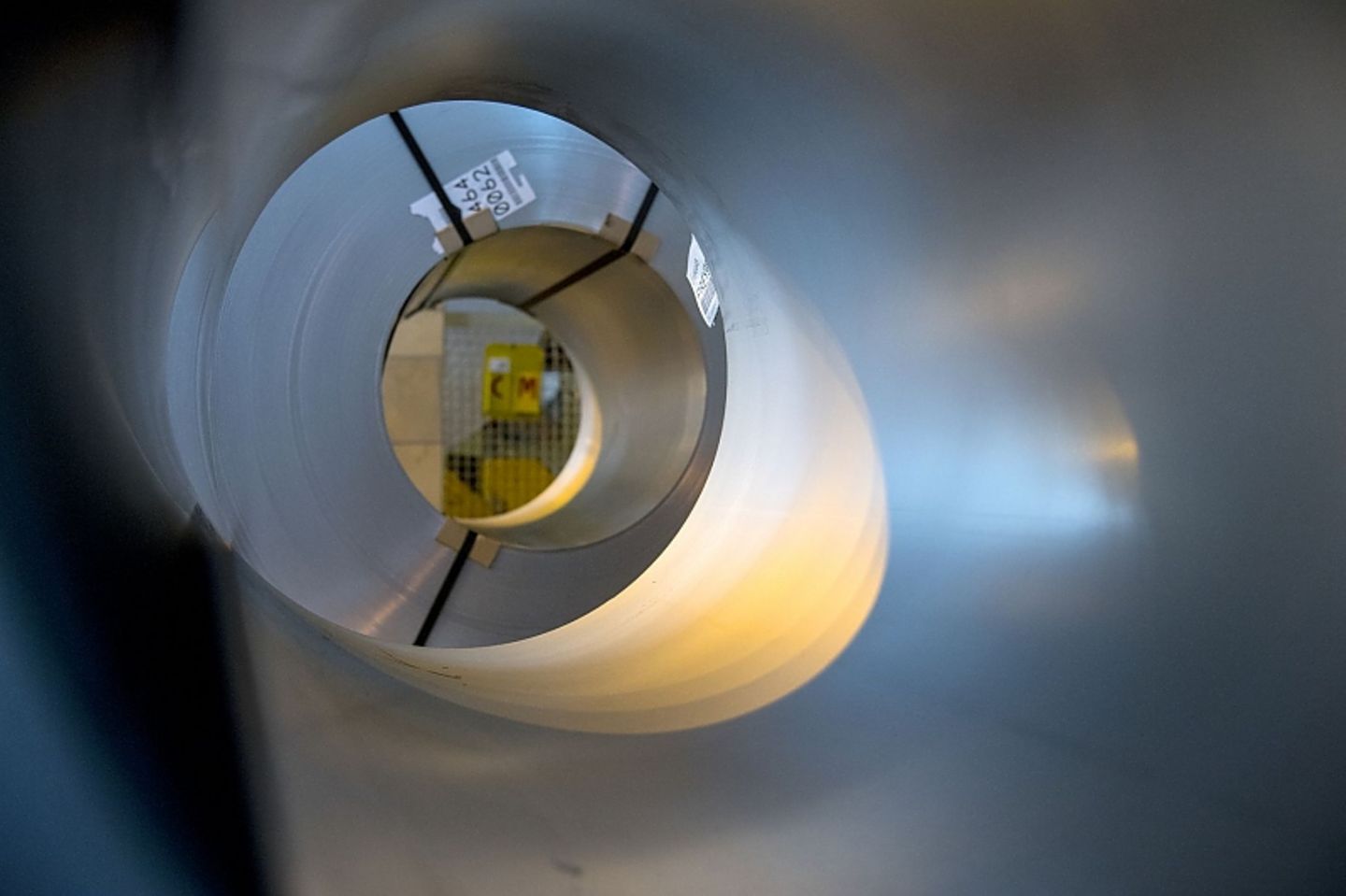"Pflanzenbasierte Agrokraftstoffe sind noch klimaschädlicher als bisher bekannt". So heißt es in einer aktuellen Studie des ifeu-Instituts. Grund dafür ist demnach der "enorme Flächenbedarf".
Derzeit seien über 1,2 Millionen Hektar Agrarflächen Welt für den Anbau von Raps, Getreide und Co. zur Produktion von Agrosprit für deutsche Diesel- und Benzinautos belegt. "Dieser immense Flächenverbrauch macht den angeblichen Klimavorteil von Agrokraftstoff gegenüber fossilem Sprit mehr als zunichte", so die Studie. Schließlich könnte sich dort auch natürliche Vegetation entwickeln, welche CO2 binde.
Deutsche Umwelthilfe fordert sofortiges Ende von Agrosprit
Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) fordert deshalb, die Förderung von Agrosprit in Deutschland und der EU sofort zu beenden. Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der DUH, sagt: "Der Anbau von Pflanzen für die Produktion von sogenannten ‚Bio-Kraftstoffen‘ schadet dem Klima und der biologischen Vielfalt. Viel Platz für Raps- und Getreideanbau für den Tank – allein in Deutschland sind dafür fast 500.000 Hektar Fläche belegt – bedeutet letztlich weniger Platz für natürliche Ökosysteme, die CO2 binden und vielfältige Lebensräume bieten." Ackerland müsse für die naturverträgliche Nahrungsmittelproduktion priorisiert und geeignete Flächen, wie etwa entwässerte Moore, konsequent für Renaturierung zur Verfügung gestellt werden.
Eine EU-Vorschrift sieht vor, dass Diesel und Benzin einen bestimmten Prozentsatz an CO2-ärmeren Kraftstoffen enthalten müssen. Das ist momentan vor allem der Agrosprit, auch als Biokraftstoff bezeichnet. Deutschland hat deshalb die Treibhausgasminderungsquote (THG-Quote) eingeführt, wonach Mineralölkonzerne zurzeit eine Quote von sechs Prozent erfüllen müssen. Das können sie durch Kraftstoff, dem sie zum Beispiel pflanzliche Anteile beimischen. Diese ist zuletzt zu Beginn des Jahres 2022 angestiegen und soll bis 2030 auf 25 Prozent steigen.
Der Studie zufolge könnten jedoch durch eine alternative Nutzung der jetzigen Anbauflächen, wie etwa durch Wald, über einen Zeitraum von 30 Jahren pro Jahr durchschnittlich 16,4 Millionen Tonnen CO2 aus der Atmosphäre gebunden werden. Das seien 7,2 Millionen Tonnen CO2 mehr, als die Nutzung von Agrokraftstoffen in Deutschland, die laut amtlichen Angaben im Jahr 2020 eingespart wurden.
Ein sofortiger Ausstieg aus Agrosprit in Deutschland als auch weltweit würde zu einer Flächenentlastung führen. Schließlich ließe sich erneuerbare Antriebsenergie für Fahrzeuge auch durch andere erneuerbare Energieträger herstellen. Für die gleiche Kilometerleistung benötige die Erzeugung von Solarstrom für Elektrofahrzeuge 97 Prozent weniger Fläche als die Produktion von Agrosprit für Verbrennerfahrzeuge, schreiben die Studienautoren.
Die gesamte Agrokraftstoffpolitik sei "eine fundamentale Fehlkalkulation"
Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH, bezeichnet die gesamte Agrokraftstoffpolitik der vergangenen 15 Jahre als "eine fundamentale Fehlkalkulation". "Weder Agrosprit noch andere sogenannte 'alternative' Kraftstoffe machen Verbrenner-Autos klimafreundlich." Er fordert schließlich eine verbindliche Festlegung des EU-weiten Verbrenner-Aus‘ bis spätestens 2030.
Horst Fehrenbach, Fachbereichsleiter des ifeu-Instituts in Heidelberg, ergänzt: "In Deutschland und weltweit sind riesige Flächen für den Anbau von Agrokraftstoffen belegt. Würde man diese Flächen der Natur überlassen anstatt intensive Landwirtschaft zu betreiben, wäre dem Klimaschutz deutlich mehr gedient als durch den Ersatz von fossilem Sprit."
Der DUH zufolge macht Agrosprit aus Raps, Getreide und Palmöl derzeit den mit Abstand größten Anteil an nichtfossiler Energie im Verkehr aus. Da die Anbauflächen für Agrokraftstoffe mit dem Nahrungsmittelanbau konkurrieren, gelten seit Kurzem Beschränkungen für Agrosprit. Darüber hinaus werde der Einsatz von Palmöldiesel schrittweise beendet, in Deutschland bereits 2023. Diese Maßnahmen würden jedoch nicht ausreichen. Denn Agrosprit sei verbunden mit hohen CO2-Opportunitätskosten, also die CO2-Menge, die durch die Regeneration von natürlicher Vegetation gebunden werden könnte, wenn keine Pflanzen für Agrokraftstoff angebaut würden.
Quellen: Deutsche Umwelthilfe, Printausgabe "TAZ"