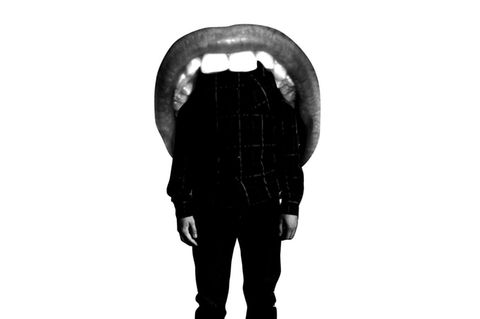Herr Weber, Sie vertreten als Anwalt Opfer von Verbrechen. Was, wenn eine Kindermörderin oder ein gewalttätiger Ehemann von Ihnen verteidigt werden möchten?
Ich würde ablehnen. Das passiert auch öfter. Zum einen möchte ich das nicht mehr. Zum anderen wäre ich vermutlich auch kein guter Verteidiger für sie. Denn meine Sichtweise ist inzwischen so sehr die der Geschädigten, dass ich mich gar nicht mehr umstellen könnte. Auch deshalb lasse ich die Finger von solchen Mandaten.
Ist es Ihnen wichtig, auf der „richtigen“ Seite zu stehen?
Es gibt kein Richtig oder Falsch. Die Verteidigung von Angeklagten ist ein genauso wichtiges Element unseres Rechtsstaats.
In wie vielen Prozessen saßen Sie inzwischen als Anwalt der Nebenkläger und Nebenklägerinnen?
In mehreren Hundert.
Was genau bedeutet die Möglichkeit der Nebenklage in unserem Rechtssystem?
Mit einer Nebenklage können Geschädigte oder Hinterbliebene von Verbrechensopfern aktiv am Gerichtsprozess teilnehmen, über ihre Zeugenrolle hinaus. Historisch betrachtet haben sich die „Neben“-Kläger, wie das Wort schon sagt, lediglich dem anklagenden Staatsanwalt angeschlossen. Heute sind sie mit eigenen Rechten und Möglichkeiten ausgestattet: Nebenkläger können Akteneinsicht nehmen, was meist über den Anwalt geschieht. Sie dürfen zudem durchgehend anwesend sein während der Gerichtsverhandlung. Auch dann, wenn die Öffentlichkeit ausgeschlossen wird – wie beispielsweise in Jugendverfahren oder bei Sexualdelikten.

Zur Person
Roland Weber, 55, ist einer der bekanntesten Nebenklage-Spezialisten Deutschlands. Als Anwalt hat er unzählige Opfer von Gewaltverbrechen und Hinterbliebene in Strafprozessen vertreten. Seit 2012 arbeitet er zudem ehrenamtlich als Opferbeauftragter des Landes Berlin. Bundesweit war er der Erste in dieser Position. Die beiden Arbeitsbereiche trennt Weber strikt: Wer zu ihm als Opferbeauftragtem kommt, den vertritt er später nicht vor Gericht.
Gibt es noch mehr Rechte?
Ja, sie haben das Recht, Fragen zu stellen, und können eigene Beweisanträge einbringen. Und sie haben die Möglichkeit, einen eigenen Schlussvortrag zu halten und selbstständig eine Strafe für den Angeklagten zu beantragen, völlig losgelöst von dem, was der Staatsanwalt fordert. Meist macht auch das ihr Anwalt für sie. Der im Übrigen ein Fachanwalt für Strafrecht sein sollte. Ich halte es für dramatisch schlimm für die Opfer, wenn Anwälte, die vom Strafrecht keine Ahnung haben, denken, sie machen den Fall mal eben mit.
Wann entstand Ihr Interesse für die Opferseite?
Schon innerhalb meiner ersten beiden Jahre als Anwalt. Also vor gut 20 Jahren. Ich vertrat damals sechs junge Leute, es waren Geschwister, deren Eltern von einem Einbrecher getötet worden waren. Ein Fall, der mich sehr bewegt hat. Der Einbrecher war hinter der 17-jährigen Tochter her, wollte sie offenbar vergewaltigen. Er hat gesehen, wie sie in das Haus gegangen ist. Er ist wie eine Spinne die Hauswand hochgeklettert, durch eines der Fenster, das auf Kipp stand, ins Haus eingedrungen, wodurch die Eltern wach geworden sind. Er hat beide erstochen und ist dann geflüchtet. Allerdings wurde später eine Kippe gefunden, er hatte zuvor vor dem Haus noch eine geraucht und so DNA-Spuren hinterlassen.
Wie bereiten Sie Ihre Mandanten, die als Nebenkläger einem Prozess beiwohnen, auf die Verhandlung vor?
Den Kindern brauche ich nicht viel zu erzählen, sie will ich gar nicht in der Verhandlung haben. Den Erwachsenen erkläre ich zunächst den Ablauf. Oft fertige ich eine Skizze an, damit sie sehen, wer wo sitzt. Ich habe sogar aus Holz einen Miniaturgerichtssaal gebaut und Modelleisenbahn-Figuren dazu gekauft, Playmobil fand ich zu kindisch. Das Modell steht inzwischen aber im Schrank, weil einige der Erwachsenen gar nicht mehr aufgehört haben, damit zu spielen.
Wollen denn all Ihre Mandaten im Prozess dabei sein?
Nein, einige sagen von vornherein, dass sie das nicht wollen. Andere wiederum wollen unbedingt die ganze Zeit dabei sein. Und die dritte Gruppe ist unentschlossen und quält sich mit dieser Frage. Ich sage dann: Sie können es sich an jedem Tag neu überlegen, an jedem Tag neu entscheiden. Sie wissen, ich sitze für Sie im Gerichtssaal und berichte Ihnen alles. Einzig für Ihre Zeugenaussage müssen Sie vor Gericht erscheinen.
Eine Ihrer Mandantinnen saß fast zwei Jahre im Prozess gegen das Folter-Paar aus Höxter. Ihre Tochter Annika war in dessen Fänge geraten. Warum hat sie sich das angetan?
Zunächst wollte sie eigentlich nur die Menschen sehen, die ihre Tochter gequält und gefoltert haben. Und nach drei Tagen meinte sie, das Verfahren sei doch interessant für sie, sie könne sich durch die Aussagen noch einmal anders in die Gedankenwelt ihrer verstorbenen Tochter hineinversetzen, verstehen, was sie bewogen hat, zu diesem Paar zu ziehen. Die Teilnahme am Prozess wurde sehr wichtig für sie, um den Verlust der Tochter aufzuarbeiten und zu verkraften.

Raten Sie manchmal Mandanten, sich den Prozess nicht anzutun, trotz Nebenklage?
Bei Erwachsenen liegt die Entscheidung nicht bei mir. Sie sind autonom, und ich will niemanden entmündigen.
In welchem Ihrer Fälle haben Angehörige gar nicht am Prozess teilgenommen?
Der Vater eines toten 16-Jährigen zum Beispiel wollte sich die Verhandlung nicht einen Tag lang antun. Ein Kneipier hatte mit dem Schüler ein Tequila-Wetttrinken veranstaltet, sich selbst aber vor allem Wasser eingeschenkt. Der Junge fiel mit 4,4 Promille Alkohol im Blut ins Koma und starb.
Und wie war das im Fall des Berliner Arztes Fritz von Weizsäcker? Sie vertraten die Familie, nachdem ein psychisch Gestörter den Sohn des früheren Bundespräsidenten getötet hatte.
Diese Mandanten sind ebenfalls nie auch nur eine Stunde im Gerichtssaal gewesen. Sie wollten nicht dabei sein, aber maximal viel über den Täter und sein Motiv wissen. Ich habe sie meist nach jedem Verhandlungstermin sofort angerufen. Manchmal war es nur ein zehnminütiges Telefonat, manchmal waren es lange Gespräche.

Mal angenommen, die Eltern eines ermordeten Kindes kommen zu Ihnen in die Kanzlei. Über was sprechen Sie?
Der Anfang ist immer gleich. Oft ist die Tat erst eine oder zwei Wochen her, und sie wollen wissen: Wie geht es weiter? Was sind die nächsten Schritte? Im Fall eines Tötungsdelikts geht es meist um die Bestattung. Wann wird der Leichnam freigegeben? Kann ich mein totes Kind noch einmal sehen – trotz Obduktion?
Versuchen Sie dann, ihnen das auszureden?
Das steht mir als Anwalt nicht zu, das würde zu weit gehen.
Spätestens kurz vor der Anklageerhebung bekommen Sie die Akte. Sie kann ein sehr harter Lesestoff sein, mit Bildern vom Tatort, von den Opfern und der Obduktion. Was machen Sie, wenn Ihre Mandanten die Akte trotzdem sehen wollen?
Da muss man vernünftig beraten. Eigentlich würde ich ihnen das gern ersparen. Wenn sie sich die Akte trotzdem unbedingt anschauen wollen, gebe ich oft erst einmal nur einen Aktenteil mit, ohne das Obduktionsprotokoll, und sage: Lesen Sie sich mal ein. Im Raum steht immer die Frage: Wie ist ihre psychische Verfassung? Was können sie verkraften?
Trotz aller Zugeständnisse an die Opfer: Es geht in Strafprozessen vor allem um den Täter, um dessen Tat und Schuldfähigkeit. Haben Sie das Gefühl, dass die Interessen der Nebenkläger manchmal zu kurz kommen?
Dieses Gefühl habe ich nicht. Der Instrumentenkasten ist inzwischen riesig. Wer sich als Nebenkläger einbringen will, kann das tun – und zwar sehr viel besser als in den meisten anderen Rechtsordnungen. Und das ist auch wichtig für viele Geschädigte, sie wollen aus ihrer passiven Rolle heraus. Es hilft ihnen, wenn sie merken, sie sind wieder handlungsfähig. Das ist einer der wichtigen Aspekte der Nebenklage.
Seit wann können Opfer vor Gericht mehr sein als nur Zeugen?
In dieser modernen Form gibt es die Nebenklage seit 1986. Damals wurde ein entsprechendes Gesetz formuliert, die Nebenklage als „Mittel des Opferschutzes“ anerkannt. Es wurde seither mehrfach im Sinne der Nebenkläger ergänzt und geändert.
In welchen Fällen ist eine Nebenklage möglich und in welchen nicht?
Der Gesetzgeber geht inzwischen sehr weit: immer dann, wenn jemand in seinen persönlichen Rechten verletzt wurde, insbesondere im Zusammenhang mit der körperlichen Integrität. Also bei Körperverletzungsdelikten, Mord, Totschlag, Sexualdelikten. Ebenso bei erpresserischem Menschenraub und Geiselnahme. Auch bei Stalking ist eine Nebenklage zulässig sowie nach einigen sogenannten Fahrlässigkeitstaten, etwa nach einer fahrlässigen Tötung durch einen Verkehrsunfall. Schwieriger ist es bei Eigentums- und Vermögensverletzungsdelikten. Da besteht die Möglichkeit nur, wenn das Opfer besondere Gründe, etwa einen schweren Schaden, darlegen kann.
Wenn das Opfer durch die Tat getötet wurde: Wer von den Hinterbliebenen hat das Recht auf Nebenklage?
Der Ehegatte und die Ehegattin oder auch eingetragene Lebenspartner. Ebenso Kinder, Geschwister und Eltern. Die Großeltern schon nicht mehr.
Können sich Nebenkläger vor Gericht auch selbst vertreten?
Ja, ich hatte gerade solch einen Fall. Ich vertrat eine Frau, deren heranwachsender Sohn getötet wurde. Und der leibliche Vater – die Eltern sind getrennt – kam ohne Anwalt zum Prozess. Aber das passiert selten, in den schweren Fällen wären die meisten ohne juristische Kenntnisse wahrscheinlich überfordert.
Wo wird der Antrag auf Nebenklage gestellt?
Bei Gericht. Oder aber schon im Ermittlungsverfahren bei der Staatsanwaltschaft. Man kann sich dem Verfahren in jedem Stadium anschließen.
Wie hoch ist der Anteil der Gerichtsverfahren mit Nebenklägern?
Bei Tötungsdelikten ist die Nebenklage heute der Regelfall. In meiner Anfangszeit war sie noch die Ausnahme. Relativ oft gibt es zudem Nebenkläger bei Sexualdelikten. Trotzdem ist die Anzahl der Nebenklagen insgesamt niedrig, was daran liegt, dass die größte Gruppe, die Opfer gefährlicher Körperverletzungen, in der Regel ihre Anwaltskosten selbst übernehmen müssen. Anders als bei sogenannten „besonders schwerwiegenden Straftaten“ zahlt der Staat in diesen Fällen nur unter bestimmten Voraussetzungen. Ein weiterer Grund: Viele Betroffene kennen ihre Rechte nicht. Selbst wenn sie unmittelbar nach der Tat von der Polizei darüber informiert werden – in dieser Schocksituation kommt das bei vielen nicht an. In den Niederlanden wird deshalb schon länger erfolgreich aktiv auf Geschädigte zugegangen. Wir haben im Herbst in Teilen Berlins ein Pilotprojekt gestartet, das in dieselbe Richtung zielt.
Über die Nebenklage hinaus haben die Opfer noch weitere rechtliche Möglichkeiten. Was besagt das Opferentschädigungsgesetz?
Es ist das wichtigste Gesetz, es regelt den Anspruch auf staatliche Leistungen. Sie reichen sehr viel weiter als die der gesetzlichen Krankenkassen. Die Opfer können Berufsschadensausgleich bis hin zu Rentenleistungen bekommen. Ich rate grundsätzlich dazu, einen entsprechenden Antrag zu stellen. Daneben besteht die Möglichkeit, sich beim Täter Schmerzensgeld zu holen – falls Geld da ist. Unter bestimmten Voraussetzungen können die zivilrechtlichen Ansprüche sogar schon innerhalb des Strafverfahrens geltend gemacht werden, ohne zeitaufwendigen Zivilprozess im Anschluss. Man nennt das Adhäsionsverfahren.
Ist das Schmerzensgeld in der Regel ausreichend hoch?
Es ist bei uns bescheiden im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Nicht nur, wenn man sich die USA anschaut, sondern auch im Vergleich zu Großbritannien oder Italien. Aber man muss das in der Gesamtheit sehen: Wir haben auch noch das Opferentschädigungsgesetz, Deutschland zahlt im Bedarfsfall bis ans Lebensende.
Welche Fähigkeiten muss ein guter Nebenklage-Anwalt haben?
Er muss vor allem gut zuhören können, um ein Gespür dafür zu bekommen, was die Opfer oder deren Angehörige wollen. Sie befinden sich in einer Ausnahmesituation und können ihre Wünsche selten klar formulieren. Und natürlich ist Sensibilität im Umgang mit den Mandanten wichtig. Wenn ich aber merke, jemand ist besonders belastet, versuche ich, andere Hilfen mit an Bord zu nehmen. Ein guter Opferanwalt hat ein Netzwerk an Therapeuten und psychosozialen Prozessbegleitern.
Verbrechensopfer und Hinterbliebene klagen oft, dass Menschen nicht normal mit ihnen umgehen können und sie deshalb zunehmend isoliert seien. Erleben das Ihre Mandanten auch?
Gerade Eltern getöteter Kinder erzählen mir das immer wieder. Eine solche Überforderung des sozialen Umfelds gibt es in Zusammenhang mit Tötungsdelikten häufiger. Ich versuche deshalb, sie im Gespräch nicht künstlich in Watte zu packen. Das heißt: keine Überviktimisierung, keine Bevormundung.
„Ein guter Opferanwalt hat ein Netzwerk an Therapeuten“
Müssen Sie als Anwalt in jedem Fall eine professionelle Distanz wahren?
Nein, ich bin keine Maschine. Aber es geht nicht so weit, dass ich mitweine. So nahe lasse ich die Dinge nicht an mich heran, denn dann würde womöglich die Qualität meiner Arbeit leiden. Das ist bei einem Arzt, der mit schwer Krebskranken auf der Palliativstation zu tun hat, nicht anders. Man braucht eine gewisse professionelle Distanz.
Ordnet ein Gericht bei besonders schutzwürdigen Opfern auch manchmal einen Anwalt oder eine Anwältin von sich aus bei?
Bei Kindern wird das inzwischen häufig gemacht. Das hängt damit zusammen, dass immer öfter Video-Vernehmungen stattfinden, um die jungen Opfer zu schützen. Und dafür wird ihnen dann ein Rechtsbeistand zur Seite gestellt. Meist ist es eine Anwältin.

Um was geht es den Nebenklägern vor allem? Dass der Täter eine möglichst hohe Strafe bekommt? Um Genugtuung?
Es ist keine homogene Gruppe. Die Interessen sind unterschiedlich. Der kleinste gemeinsame Nenner ist die Aufklärung des Sachverhalts: Was ist wie passiert? Und warum? Und danach scheiden sich die Geister. Einige wollen die Sicherungsverwahrung für den Täter, damit er das, was er ihnen angetan hat, niemand anderem mehr an-tun kann. Anderen ist nur wichtig, dass der Angeklagte überhaupt irgendeine Strafe bekommt. Oder sie interessiert nur der Schadensersatz. Wiederum anderen geht es nur darum, durch das Urteil bestätigt zu bekommen, dass ihnen etwas angetan wurde.
Leiden Ihre Mandanten, wenn das Urteil aus ihrer Sicht zu milde ausfällt?
Das Strafmaß muss zumindest nachvollziehbar sein für sie. Und ich hatte schon Fälle, in denen es das nicht war. Das führt dann bei den Betroffenen zu großer Verbitterung. Ich habe vor einem Jahr einen alten Herrn vertreten – er war in den Achtzigern –, dem ein Straßenräuber mit der Faust so massiv auf beide Augen geschlagen hatte, dass der Mann erblindete. Der Täter hat sich im Prozess schnell reuig gezeigt. Das Gericht hat dann alle strafmildernden Aspekte für den Täter überproportional berücksichtigt. Dass er selbst schon über 50 war, ein Alkoholproblem und kein Geld hatte, nicht vorbestraft, nie auffällig war und dann offensichtlich an dem Tag die Nerven verloren hatte. Es kam zu einer sehr milden Strafe, drei Jahre, was bei der betroffenen Familie zu großer Verbitterung geführt hat, auch weil der Vater ins Pflegeheim musste und um die Lebensfreude gebracht wurde.
Haben Ihre Mandanten oft Rachefantasien?
Manchmal, was ich nachvollziehen kann. Aber es war bislang noch nie so, dass ich mir Sorgen machen musste.
Haben Menschen, die schwere Gewalt erfahren haben, das Recht, zu sagen, sie möchten ihre Zeugenaussage nicht im Gerichtssaal, sondern in einem getrennten Raum machen?
Bei Erwachsenen müssen Sie schon sehr genau darlegen, weshalb ein schwerwiegender Nachteil für deren Gesundheit drohen würde, wenn er oder sie die Zeugenaussage im Gerichtssaal machen müsste. Das ist auch richtig so. Sonst würde das tatsächlich zu einem Wunschkonzert werden. Und es gibt gute Gründe für eine mündliche Hauptverhandlung: Man will von den Menschen auch einen Eindruck bekommen.
Haben Sie schon erlebt, dass Opfer unter Angst ausgesagt haben?
Immer wieder. In zwei Dritteln der Erstgespräche werde ich gefragt: Taucht meine Adresse in der Akte auf? Diese Angst ist mal berechtigt, mal weniger. Aber sie ist da. Andere Länder tragen dem längst Rechnung. In Großbritannien ist die private Anschrift der Zeugen zum Beispiel immer in einer Sonderakte. Ich wäre sehr dafür, es in Deutschland auch so zu handhaben.
Täter haben das Recht, zu schweigen – und tun das oft. Stößt hier die Nebenklage an ihre Grenzen?
Es ist tatsächlich der schwierigste Punkt. Meist ist es für mich absehbar, und ich bereite meine Mandanten frühzeitig darauf vor, dass sie womöglich keine Antworten bekommen werden – zum Beispiel auf die für sie so wichtige Frage nach dem Motiv. Damit die Enttäuschung am Ende nicht zu groß ist.
Einige Täter entschuldigen sich. Wollen Opfer oder deren Angehörige solche Entschuldigungen überhaupt hören?
Das hängt von der Art und dem Umfang der Verletzungen und den Folgen für sie ab. Und wann die Entschuldigung kommt: Bei denen, die sie ernst meinen, kommt sie meistens sehr früh. Wenn sie am Ende kommt, hat sie wohl meist nur taktische Gründe. Und dann wollen meine Mandanten sie sicher nicht hören.
„Ich gehe nicht zu Trauerfeiern, ich bin nicht Teil der Familie“
Was, wenn der Täter überhaupt keine Reue zeigt – wie im Fall von Hanna K., einer Berliner Abiturientin, die auf dem Heimweg nach einem Vergewaltigungsversuch getötet wurde?
Für ihre Familie wäre dieser unfassbare Schicksalsschlag nicht kleiner geworden, wenn der Täter sich in irgendeiner Form reuig gezeigt hätte. In diesem Fall war es tatsächlich egal. Es war so unvorstellbar, was da passiert war: Hanna durfte an diesem Abend erstmals lange wegbleiben. Die Eltern hatten alles richtig gemacht, es war organisiert, dass sie jemand nach Hause bringt. Und dann klappte es mit der Mitfahrgelegenheit nicht, und Hanna nahm die U-Bahn. Und der Täter, ein 31-jähriger Arbeitsloser, fuhr mit und verfolgte sie.
Trauen sich Ihre Mandanten, im Prozess selbst Fragen zu stellen?
Einige ja. Manchmal stellen sie Fragen, die richtig gut sind. Gerade bei Beziehungsdelikten haben die Betroffenen nämlich das entscheidende Hintergrundwissen, das dem Staatsanwalt fehlt. Bei anderen ist es besser, sie flüstern mir ihre Fragen ins Ohr, und ich gieße sie in die Juristen-Sprache.
Wollen im Schlussplädoyer viele selbst die ihnen wichtigen Punkte vortragen?
Zum Teil wollen sie das. Manchmal teilen wir das auch auf: Ich halte zum rechtlichen Teil einen Vortrag. Und anschließend sprechen sie. Oft erzählen sie dann von dem Menschen, den sie verloren haben. Letztes Jahr habe ich eine Familie vertreten, deren Sohn nach einem Streit um Nichtigkeiten von einem Bekannten getötet worden war. Der Vater sprach fast eine Viertelstunde über seinen toten Jungen. Weil er zuvor den Eindruck gewonnen hatte, dass das Gericht sich zu wenig mit seinem Sohn befasst hatte.
Wie geht es den Opfern und Hinterbliebenen nach Prozessende?
Gerade nach Tötungsdelikten erlebe ich regelmäßig, dass die Angehörigen nach Abschluss des Verfahrens in ein Loch fallen. Deshalb ist aus meiner Sicht wichtig, dass diese Menschen frühzeitig therapeutische Hilfe bekommen.
Wurden Sie von Mandanten schon mal zu einer Trauerfeier eingeladen?
Ich wurde schon häufiger eingeladen, aber normalerweise gehe ich nicht hin. Ich bin nicht Teil der Familie. Ich er-innere nur ein einziges Mal – nach dem Tod von Jonny K. Der junge Mann war 2012 in der Nähe des Berliner Alexanderplatzes mit Schlägen und Tritten malträtiert worden. Er kannte die Täter nicht, wollte nur einen Streit schlichten. Der Fall hatte bundesweit Aufsehen erregt. Ich habe damals die Schwester vertreten. Ich bin gemeinsam mit dem Justizsenator zur Trauerfeier gegangen, der damals regierende Bürgermeister Klaus Wowereit, der Innensenator und der Präsident des Abgeordnetenhauses waren ebenfalls dort.
Sie begleiten Opfer und Angehörige oftmals über Monate oder noch länger. Reißt der Kontakt nach dem Urteil immer sofort ab?
Es gab vier oder fünf Kontakte über die vielen Jahre, die darüber hinaus bestanden. Es ist die Ausnahme. Der Normalfall sieht so aus, dass ich von den Leuten spätestens dann, wenn die Schadensersatzansprüche geregelt sind, nichts mehr höre. Und das ist gut so. Ich wollte sie in einer schwierigen Phase unterstützen. Aber ich möchte nicht ihr Lebensbegleiter sein.