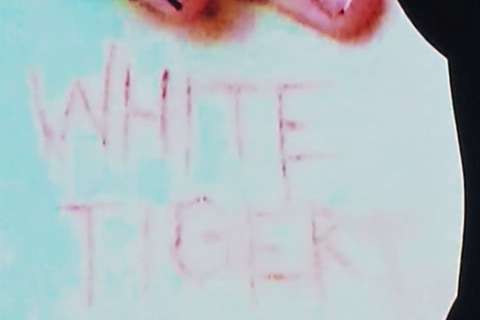Wer in Hamburg an Umweltgefahren denkt, dem fallen Orkane und Sturmfluten ein. Kaum jemand käme auf die Idee, dass auch im Boden der Hansestadt Probleme lauern. Dabei ragt dort ein riesiges Salzgebirge auf. Tausende Meter hoch, steiler als die Alpen - und das ist nach Erkenntnissen von Geowissenschaftlern nicht ganz unbedenklich: Wäscht Sickerwasser Höhlen in das teilweise nur wenige Meter unter der Erde liegende Material, kann dieses nachgeben. Bodenabsackungen und sogar kleine Erdbeben sind die Folge. Mehrfach hat die Metropole an der Elbe dies schon erlebt.
"Es gab in Hamburg früher Einsturzbeben, und es wird sie vielleicht wieder geben", sagt Geologie-Professor Claus-Dieter Reuther von der Universität Hamburg. Er und seine Kollegen erforschen das Salzmassiv unter der Stadt derzeit mit verschiedenen, in Deutschland teils noch weitgehend unbekannten Erkundungsverfahren. "Hamburg - a dynamic Underground" (HADU) heißt das Projekt, mit dem das geologische Gefahrenpotenzial besser eingeschätzt und die Grundlagenforschung vorangetrieben werden soll.
Unruhige unterirdische Salzformationen sind im Norden weit verbreitet.
Das vom Bundesforschungsministerium geförderte Vorhaben, an dem auch das Potsdamer Geoforschungszentrum sowie Informatiker der Hamburger Universität beteiligt sind, dient zunächst der Erkundung potenziell unruhiger unterirdischer Salzformationen. Die sind in Norddeutschland weit verbreitet. Vor Millionen Jahren lagerten sich dort am Boden urzeitlicher Meere mächtige Schichten sogenanntes Zechsteinsalz ab. Dieses wurde anschließend durch Gestein überdeckt, kam mit der Zeit aber an einigen Stellen wieder an die Oberfläche. In Hamburgs Westen zieht sie sich ein solches Gebiet vom Elbufer aus in einem breiten Streifen an der Autobahn 7 entlang nach Norden.
Die dort von Regen- und Grundwasser in das leicht lösliche Material gespülten Spalten brechen langsam ein. Mitunter geben sie auch plötzlich nach - und lösen im näheren Umkreis erdbebenartige Erschütterungen aus. Etwa 30 solche "Erdfälle" haben Forscher in Stadtteilen wie Groß-Flottbek und Bahrenfeld schon gefunden, rund 20 Beben in den vergangenen 100 Jahren gezählt. Das vorerst letzte ereignete sich im April 2000. Die Erschütterungen sind zwar zu schwach, um Gebäude zu gefährden. Risse in Hauswänden und Straßen entstehen aber durchaus. "Hamburg wird nicht eines Tages in einem riesigen Krater verschwinden", betont Georisiken-Experte Reuther. "Aber es gibt Auswirkungen auf die Infrastruktur."
"In einem Erdfallgebiet würde ich lieber nicht bauen."
Auch das Geologische Landesamt interessiert sich deshalb für die Ergebnisse der Forscher. Denn längst liegen noch nicht zu allen Teilen des Salzgebirges verlässliche Erkenntnisse vor. "Wie die Oberfläche der Formation im Untergrund aussieht, weiß man in der Tat nicht so genau", sagt Amtsleiterin Renate Taugs. Finden die Geowissenschaftler neue Hinweise auf instabile Zonen, sollen diese in Risikokataster für Behörden und Bauherren einfließen. "Denn eins ist klar: In einem Erdfallgebiet würde ich lieber nicht bauen", meint Jürgen Ehlers, Geologe des Hamburger Landesamts. Zumindest müsse man dort spezielle Vorkehrungen für den Gebäudeschutz treffen.
Die Forscher erhoffen sich von dem bis Mitte 2008 laufenden Projekt zusätzlich Fortschritte bei der geologischen Messtechnik. Denn innovativ ist ihr Vorhaben vor allem wegen der Kombination bekannter Untersuchungsmethoden wie dem Bodenradar mit einem in Deutschland bislang kaum verwendeten Verfahren. Die Technik mit dem Namen "Ambient Vibrations" nutzt das "Grundrauschen" von Großstädten, um daraus ein dreidimensionales Bild des tieferen Untergrunds zu gewinnen. Der Trick: Verschiedene Bodenschichten verzögern die durch Verkehr und Industrie entstehenden seismischen Wellen unterschiedlich stark. Das lässt sich aufzeichnen und computergestützt analysieren. Damit löst die Methode ein Problem, das die Bodenanalyse in Ballungszentren bislang erschwerte. Denn die dafür benötigten seismischen Wellen mussten durch Sprengungen erzeugt werden - ein Verfahren, das sich in bebautem Gebiet kaum anwenden lässt. Indem sie auf Erschütterungen der Stadt zurückgreifen, haben Forscher nun eine schonende Alternative. Diese lässt sich zudem ohne großen Aufwand einsetzen. In Hamburg sind gerade einmal zwei Studenten damit beschäftigt, die Messungen vorzunehmen. "Das ist eine sehr günstige Methode", erläutert der an dem Projekt beteiligte Geophysiker Torsten Dahm. Und deshalb, so hoffen die Experten, lässt sich diese überall vermarkten, wo Hohlräume unter bebautem Gebiet für Probleme sorgen.
Sebastian Bronst/DPA