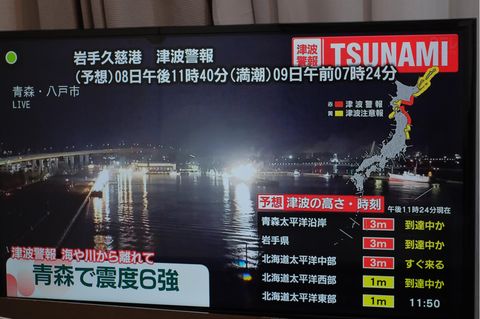Es ist paradox: Ausgerechnet eine Abschussquote soll dabei helfen, den Wal weltweit zu schützen. In Agadir in Marokko beginnt am heutigen Montag eine der wichtigsten Sitzungen der Internationalen Walfangkommission (IWC). Dabei beraten Vertreter aus 88 Mitgliedländern darüber, ob das seit 1986 geltende Walfangverbot aufgehoben und erstmals Fangquoten für die drei Walfangnationen Norwegen, Island und Japan eingeführt werden sollen.
Denn trotz des 1986 vom IWC erlassenen Fangverbotes jagen diese weiterhin die Meeressäuger, auch in den Schutzgebieten der Antarktis. Über 33.500 Tiere haben Walfänger in den vergangenen 24 Jahren abgeschossen - trotz des Moratoriums, gegen das die beiden skandinavischen Länder Widerspruch eingelegt haben. Japan nutzt ein Schlupfloch in dem bestehenden Verbot, denn der Walfang zu wissenschaftlichen Zwecken ist weiterhin erlaubt. Doch die gefangenen Wale dürften eher in Sushi-Bars landen als in Laboratorien.
Um den Streit zwischen Walfängern und Walgegnern zu beenden und wieder Bewegung in die Debatte zu bringen, hat IWC-Chef Cristian Maquieira nun ein Kompromisspapier vorgelegt. Demnach soll das kommerzielle Fangverbot für die Meeressäuger für zehn Jahre aufgehoben werden, gleichzeitig würden erstmals Fangquoten erlassen. Das bestehende Verbot würde damit zwar gelockert, im Gegenzug müssten Norwegen, Island und Japan allerdings unter Aufsicht der IWC Wale jagen - und ihre Fangquote kontrollieren lassen. Die im Kompromiss angepeilten Quoten sind niedriger als die Zahl der bis zu 2000 Wale, die derzeit jährlich getötet werden. Befürworter gehen davon aus, dass so in den kommenden zehn Jahren 5000 Wale gerettet werden. Für den Kompromiss benötigt der IWC 66 von 88 Stimmen.
Jagd in Naturschutzgebieten erlaubt
Doch die Chancen für eine Einigung stehen schlecht, die Fronten sind verhärtet. Walschützer bemängeln, dass mit der Quote auch Wale abgeschossen werden dürften, die auf der Roten Liste stehen, wie der stark gefährdete Finnwal. "Auch die Seiwale dürfen demnach in den kommenden zehn Jahren getötet werden", sagt Volker Homes von der Umweltschutzorganisation WWF. "Für diese Arten müsste es eine Nullquote geben." Zudem befürchtet er, dass auch andere Länder wie Südkorea wieder Wale fangen wollen, wenn das Verbot fällt. Nach einem Aufweichen des Verbotes könnte der kommerzielle Walfang dann wieder im vollen Umfang beginnen.
Für die Umweltschutzorganisation WWF ist daher klar: "So wie der Kompromiss im Moment aussieht, ist er nicht gut", sagt Homes. Die Quoten seien nicht wissenschaftlich anhand der Restbestände ermittelt, sondern willkürlich von der Politik festgesetzt. Auch der Fang in Naturschutzgebieten gehöre verboten.
Japan sind die geplanten Fangquoten zu gering
Der deutsche Bundestag und Australien sind ebenfalls gegen den Kompromiss, auch die USA haben Bedenken angemeldet. "Das Papier hat zwar einige brauchbare Ansätze, aber es ist nicht zustimmungsfähig für uns", sagt der Leiter der deutschen Delegation, Gert Lindemann, der ebenfalls den noch erlaubten Fang in Naturschutzgebieten kritisiert. "Der Walfang muss stärker als geplant reduziert und der kommerzielle Fang ganz beendet werden", sagt er. Auch von den Walfangländern kommt Gegenwind: Island wendet sich gegen das im Kompromisspapier vorgesehene Handelsverbot für Walfleisch. Japan sind die genannten Fangquoten zu gering und Norwegen sieht "viele ungelöste Punkte".
"Es wäre besser, sich noch ein Jahr Zeit zu geben, um dann auf dem nächsten Treffen einen sinnvollen Kompromiss auszuhandeln", meint daher Homes. Meeresbiologin Petra Deimer, die wissenschaftliches Mitglied der deutschen Delegation ist, sieht das anders. Die Zeit dränge. "Momentan drohen die Japaner damit, ein neues Fangschiff zu bauen. Und wenn sie das tun, dann muss das auch erstmal wieder einige Jahre in die Antarktis fahren, damit es sich wenigstens ein bisschen rentiert." Daher müsse vor dem Bau des Schiffs die Bremse gezogen werden, sagt sie.
Doch ob dies klappt, wird immer fragwürdiger: Schon am ersten Tag kam es auf der Tagung zu einem Eklat. Verhandlungsführer Anthony Liverpool, der Botschafter des Staates Antigua und Barbuda in Japan, soll von der Walfangnation Japan bestochen worden sein. Nach Recherchen der britischen Zeitung "Sunday Times" hat Japan ihm die Reise nach und das Luxushotel in Agadir bezahlt. "Wenn die IWC-Staaten diesen Vorsitzenden weiter dulden, dann dulden sie eine korrupte Walfangkommission. Die IWC verliert damit ihre Glaubwürdigkeit", sagte Sandra Altherr von der Tierschutzorganisation Pro Wildlife.