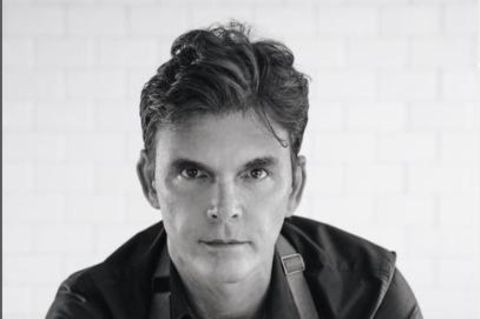Er war vielleicht der Letzte, der ihnen zuwinkte. Den Terroristen. Und ihren Opfern. Chester "Chet" MacDonald war an jenem Dienstag in aller Frühe augestanden. Es war noch stockfinster, als er den kleinen Hafen in Winthrop mit seinem Bötchen verließ. Die Flut zog sich bereits zurück, und Chet wollte schnell hinüber kommen zu jenem Feld, das Logans Landebahn umschließt. Er ankerte im knietiefen Wasser, griff nach der Schlickgabel, dem Stahleimer und dem Netz und watete dorthin, wo nur noch ein feuchter Film den schweren Sand überzog.
Als es dämmerte, begann Chet zu graben. Er wollte die Zeit voll nutzen, die die Ebbe ihm ließ, jene sechs Stunden. Er bückte sich, stieß die kurzstielige Gabel tief in den nassen Grund. Dann hob er das triefende, schwere Erdreich aus, klaubte die Muscheln, die "Clams", aus dem Loch und dem aufgeworfenen Schlick - und warf seine Ernte in den Eimer. Das machte er wieder und wieder. Wie seit Jahrzehnten. Es war der 11. September 2001. Chet war damals 69.
Etwas später, es war schon hell, rollten die ersten Passagiermaschinen der Startbahn entgegen. Eine nach der anderen. Wie riesige, schlaftrunkene Vögel. Wie jeden Morgen. Hin und wieder hielt Chet inne, richtete sich auf und winkte. Erkennen konnte er niemanden in den schlanken Leibern der Maschinen. Aber er wußte: Die Piloten, die Passagiere, sie würden ihn sehen, sobald sie aus den Cockpits und den kleinen Fenstern lugten, um sich von der Stadt zu verabschieden. Bye, bye, Boston. Bye, bye, du Muschelgräber. Es war wie immer.
"Wir durften 14 Monate lang nicht zurückkehren"
Erst um kurz nach neun bemerkte Chet, dass dieser Tag anders sein würde als all die anderen. Es war die Ruhe, die ihn aufschreckte. Über den Flughafen hatte sich eine seltsame Stille gelegt. Der Lärm war verstummt, der typische Geruch von Kerosin und verbranntem Gummi war verweht. Keine Maschine startete, keine landete. Chet wurde unruhig. "Um neun Uhr", erzählt der alte Mann mit den Hosenträgern heute, "war irgend etwas anders als sonst am Flughafen Logan." Aber noch machte er sich keine Sorgen. Chet grub weiter, Gabel um Gabel. Erst am späten Vormittag erfuhr der Korea-Veteran von den Anschlägen. Terroristen hatten zwei jener Flieger, die am Morgen von seiner Landebahn aus gestartet waren, entführt und in die Türme des World Trade Centers in New York gestürzt. Chet hatte ihnen noch zugewunken. Tätern und Opfern. Am späten Vormittag kam das Wasser zurück.
Chet nahm die Gabel, den Bastsack mit den Muscheln, den Eimer und fuhr mit seinem Motorbötchen in den malerischen, kleinen Hafen Winthrops zurück. An jenem Vormittag hatte sich seine Heimat verändert. Es war ein anderes Amerika, in dem Chet nun anlegte.
Am 12. September 2001 erhielt Chet Besuch vom neuen Amerika. Als die Polizisten kamen, grub er wieder im Schlick. Die anderen Muschelgräber, die anderen Jungs, waren nicht weit. Sie, die Muschelgräber, müssten gehen, sagten die Polizisten. Sofort. Sonst würde man auf sie schießen. Sie seien jetzt eine Gefahr für die innere Sicherheit der Vereinigten Staaten, hieß es. Die Muschelgräber wollten nicht, dass man auf sie schoss. Sie gehorchten. Sie gingen - und kehrten 14 Monate lang nicht zurück. 14 Monate, die fast ihre Existenz vernichtet hätten. Aber nur fast.
Amerika wieder entdecken, die Serie
Wie hat sich Amerika seit dem 11. September 2001 verändert? Welche Spuren hat der "Krieg gegen den Terror" in jenem Land hinterlassen, das wie kaum ein anderes für Demokratie und politische Freiheit steht? stern.de-Mitarbeiter Florian Güßgen berichtet drei Wochen lang regelmäßig von seiner persönlichen Wiederentdeckung Amerikas - aus Boston im liberalen Bundesstaat Massachusetts, aus Springfield im konservativen Missouri und aus Washington, D.C. und New York City. Unterstützt wird er dabei durch eine Fellowship des American Council on Germany mit Sitz in New York.
100 bis 120 Dollar am Tag
Die Muschelgräber von Boston leisten harte, körperliche Arbeit. Sie arbeiten gebückt, fast sechs Stunden lang. Im Sommer, wenn die Sonne gnadenlos sticht, kühlt sie das Meereswasser. Das ist angenehm, besonders an jenen brütenden Tagen, an denen die Feuerwehr drüben in der Stadt, drüben in Boston, die Menschen mit Spritzwasser abkühlen muss. Im Sommer hat das Muschelgraben fast etwas von Urlaub. Im Winter ist die Arbeit dagegen eine scheinbar nie endende Qual. Wenn das Eis im Hafen bisweilen das Auslaufen behindert, ist sie fast unerträglich. Dann müssen die Muschelgräber sich in gefütterte, wasserdichte Plastikhosen zwängen. Hin und wieder pinkeln sie sogar in die Plastikhandschuhe, um diese über die klammen Finger ziehen zu können. Um zu ihren Erntefeldern zu kommen, schieben sie ihre Boote dann über das Eis. Und das alles für 100 Dollar am Tag, vielleicht für 120 Dollar, wenn es gut geht. Die Muschelgräber sagen, das sei gut verdientes Geld.
Dreißig, vierzig Männer sind es, die in Boston, der Hauptstadt Neuenglands an der nordöstlichen Atlantikküste der USA, vom Clam Digging leben. Insgesamt fünf Schlickfelder dürfen sie ausbeuten. Die Muscheln, nach denen sie graben, haben dunkle Schalen und ein zartes, weißes Fleisch. Sie sind die Grundlage für eine kulinarische Spezialität Bostons, für die "Clam Chowder", eine helle, sämige Suppe. Vor allem im Sommer, wenn die Touristen nach Neuengland kommen, ist die Nachfrage nach den Muscheln groß. Dann steigen die Preise. Dabei ist jenes Schlickfeld, das die Rollbahn des Flughafens Logan umgibt, für die Muschelgräber das ertragreichste. Das kommt daher, weil Logan auf einer künstlichen Landzunge mitten in Bostons Hafenbucht liegt. Zwei Flüsse münden hier in den Atlantik, der Mystic River aus dem Norden und der Charles Rivers aus dem Süden. Kleintiere, Muscheln, Fische lieben dieses nahrhafte Gewässer. Sie gedeihen prächtig.
Die Muschelgräber sind Arbeiter, "blue-collar-worker", wie das hier heißt. Manche, wie der Rentner Chet, graben, weil sie ein Zubrot verdienen wollen, weil sie ihre "Frau hin und wieder zum Essen" ausführen wollen. Für andere, wie den 34-jährigen John Dennehy, ist das Muschelgraben ein zweites berufliches Standbein. Die meisten, wie der 29-Jährige JJ, leben nur von dieser harten Arbeit. Für fast alle ist Muschelgraben nicht nur ein Job. Es ist eine Tradition, eine kleine Kultur. Sie sind stolz auf das, was sie tun.
"Es ist meine Leidenschaft"
Einmal Muschelgräber, immer Muschelgräber. Der rüstige, selbsbewusste Chet, der an diesem heißen Sommertag im August seine roten Hosenträger trägt, erzählt, dass sein Großvater hier gegraben hat. Und sein Vater. Und auch das Kraftpaket John Dennehy kann sich nicht an ein Leben ohne Muschelgraben erinnern. Er war acht, als sein Vater ihn das erste Mal mitnahm. Der Vater war eigentlich Arbeiter im Hafen, ein "Longshore Man." Aber wann immer es ging, grub der alte Dennehy nach Muscheln. Ehrliches Geld war das, gut verdientes Geld. John machte es ihm nach. Exzessiv. Muschelgraben bringt Geld, und Geld bringt den sozialen Aufstieg. Hauptberuflich arbeitet John als Wärter in einem Frauengefängnis westlich von Boston. Aber das reicht nicht. Am Wochenende fährt er im Knast Doppelschichten, um unter der Woche mehr Zeit zu haben. Hin und wieder löscht er dann im Hafen Containerschiffe. Aber vor allem fährt der Mann aus dem Arbeiterviertel Revere so oft es eben irgend geht nach Winthrop, um nach Muscheln zu graben. "Das ist meine Leidenschaft", schmettert John fröhlich. Er ist Optimist.
"Ich bin ein Underdog", erklärt er. Er müsse eben härter arbeiten als andere, unermüdlicher, schuften, um nach oben zu kommen. So ist das Leben. Das ist ok. Und John hat es schon weit gebracht. Seine zwei kleinen Kinder müssen nicht in der Nähe des Hafens aufwachsen. John hat ein Haus in einem schicken Vorort gekauft. Dort gibt es gute Schulen, im schicken Wohnzimmer steht ein Fernseher mit Flachbildschirm. Für diesen Luxus, für diese Statussymbole, gräbt John. Dafür füllt er Eimer um Eimer mit schwarzen Muscheln. Voller Stolz. Dafür nimmt er in Kauf, dass er seine schöne, junge Frau nur selten sieht.
Anderen Muschelgräbern ist Johns Eifer nicht ganz geheuer. Der junge JJ etwa verknüpft die Ackerei nicht mit großen Worten. Für ihn ist das Graben schiere Notwendigkeit. Er hasst die Kälte im Winter, die sengende Hitze im Sommer. Aber er findet einfach keinen anderen Job. "Wenn ich könnte", sagt JJ, der gelernte Maler, "würde ich etwas anderes machen". Als er anfing, war er 17. Das ist zwölf Jahre her.
Es sind Geschichten der Hoffnung, der Enttäuschung, der schieren Not, die die Muschelgräber von Boston mit der täglichen Quälerei im Schlick verknüpfen. Es sind viele verschiedene Schicksale, die hier zusammenlaufen. Zwischen 30 und 40 Schicksale. Der 11. September 2001 traf sie alle gleichermaßen. Wie ein Keulenschlag, der drohte, alles zunichte zu machen: Chets Zubrot, Johns Träume, JJs Existenz. Binnen weniger Stunden hatten sich die kauzigen Underdogs in den Augen des verwundeten Staates zu einer potenziellen Bedrohung für Amerika entwickelt - zumindest in den Augen der Sicherheitsexperten des nahen Flughafens. Die Flughafen-Betreiber der Massachusetts Port Authority (Massport) waren nervös, panisch. Nichts, gar nichts, ließen sie unversucht, um den Ruch des Terroristen-Flughafens los zu werden. Auf Logans Wasserseite schufen sie auch eine Sicherheitszone, ein mit weißen, länglichen Bojen markiertes No-Go-Area. Weshalb sollte man da die Muschelgräber einlassen? Wer konnte denn garantieren, dass nicht einer dieser Clowns plötzlich eine Rakete abfeuerte? Auf ein voll besetztes Flugzeug etwa. Oder den Kontrollturm. Massport ging auf Nummer sicher.
"Ich kenne jeden, der hier etwas zu suchen hat"
Die Muschelgräber fühlten sich betrogen, nicht nur um ihre wirtschaftliche Existenz, auch um ihr Selbstverständnis. Waren sie nicht besonders geübte Wächter? Waren es nicht Muschelgräber gewesen, die im Zweiten Weltkrieg nach feindlichen Fliegern und Schiffen Ausschau gehalten hatten? Was sollte dieses Misstrauen? "Ich kenne den Hafen wie kein zweiter," erklärt Chet. "Ich kenne jeden, wirklich jeden, der hier etwas zu suchen hat - oder eben nicht." Die Muschelgräber seien von jeher die Augen und Ohren des Flughafens gewesen, sagt auch John Dennehy. Und nicht nur das. "Wir sind bereit, unsere Leben dafür aufs Spiel zu setzen, um zu verhindern, dass irgendjemand zu Unrecht die Landebahn des Flughafens betritt." Die Muschelgräber sind keine Linken. Das waren sie nie. Sie sind treue Amerikaner, zumeist Republikaner. Vermutlich hatten sie alle George W. Bush zum Präsidenten gewählt. Nun wollte dessen Amerika sie vertreiben. Das verstanden sie nicht.
Aber alle Beteuerungen waren vergebens. Massport wollte die Muschelgräber nicht in der Nähe der Landebahn sehen. Es wurde eng. "Schon vor dem 11. September 2001 lief das Geschäft schlecht", erinnert sich Wayne Wittala, kahlköpfiger Vietnam-Veteran, Muschelgräber und Muschel-Zwischenhändler. "Aber danach waren unsere Einbußen drastisch. Sehr drastisch." In einem guten Jahr komme er auf 18.000 Dollar. Nach den Anschlägen seien es nur noch 10.000 Dollar gewesen. Die Existenz der Muschelgräber versiegte.
"Die waren plötzlich begeistert"
Und dann begannen Chet, der Ältere, und John, der Jüngere, sich zu wehren, zu kämpfen. Für sich. Für ihre Träume. Und für die anderen. Sie schrieben unzählige Briefe. An Abgeordnete in Boston und in Washington, an die Senatoren John Kerry und Edward Kennedy, an den Gouverneur, an alle, die sie erreichen konnten. Sie mobilisierten die Medien, die Zeitungen, die Radiostationen, das Fernsehen. Pragmatisch. Zielorientiert. "Politiker bewegen sich nur durch öffentlichen Druck," sagt John. "Ohne die Medien wäre nichts gegangen." Und die Muschelgräber waren schlau: 762.500 Dollar, so rechneten sie aus, würden dem Staat insgesamt an Steuereinnahmen flöten gehen, wenn es sie nicht mehr gäbe. Auch das klang gut. Chet erzählt, seine Tochter habe die Briefe für ihn aufgesetzt.
Die Rechnung ging auf. Die Medien interessierten sich für die Rebellion der Muschelgräber, die Menschen auch. Tobte hier doch der klassische Kampf von Klein gegen Groß, von Underdogs gegen Establishment. Das ließ sich gut verkaufen, auch politisch. Nach einigen Monaten Verhandlung beschloss das Landesparlament am Beacon Hill in Boston ein Gesetz. Es erlaubte den Muschelgräbern die Rückkehr - vorausgesetzt, sie würden sich künftig an der Sicherung des Flughafens beteiligen. Die Massport-Chefs mussten einlenken. "Die waren plötzlich ganz begeistert von uns", erinnert sich Chet.
Jeder Muschelgräber erhielt nun ein Sicherheits-Training, einen Sicherheits-Ausweis und eine neongelbe Leuchtjacke. Jedes Mal, wenn sie sich dem Flughafen näherten, mussten sie sich anmelden. Würde ihnen etwas Verdächtiges auffallen, würden sie sofort die Polizei verständigen. Aus potenziellen Terroristen hatten die Behörden nun Patrioten mit Schlickgabeln gemacht, Frontkämpfer in der Auseinandersetzung mit dem internationalen Terrorismus. Das freute sie. Das machte sie stolz. Das war das Amerika, das sie liebten.
"Es ist eine Leistung, dass ich es dorthin geschafft habe"
An diesem Vormittag im August, am vermutlich heißesten Tag des Jahres 2006, steht John im Schlick der Schlangeninsel, ein paar hundert Meter vom Rollfeld des Flughafens entfernt. Er gräbt ohne Unterlass. Gebückt. Nur hin und wieder watet er bis zur Brust ins Wasser, um sich abzukühlen. Acht, neun Eimer will er heute schaffen. Er erzählt wieder von seinem Haus. Und von den Schulen. "Es ist eine ziemliche Leistung, dass ich es dorthin geschafft habe", brüstet er sich. Und dann singt er wieder ein Loblied auf das Muschelgraben. Dem habe er alles zu verdanken, sagt er. Und überhaupt. Die Freiheit zu haben, nach Muscheln zu graben, mit dieser Tätigkeit Geld zu verdienen, mit diesem Geld ein Haus zu kaufen - das sei überhaupt erst das, was es ausmache, ein Amerikaner zu sein, sagt John. Dann wirft er ein Büschel Muscheln in seinen Stahleimer.
Die Wände im Zimmer seiner zweijährigen Tochter, oben links im ersten Stock des neuen Hauses, hat John übrigens bemalen lassen. In einer grünlich-blauen Unterwasserlandschaft schweben lächelnde Meerjungfrauen mit Fischschwänzen. Sie sind von kleinen Muscheln umgeben.