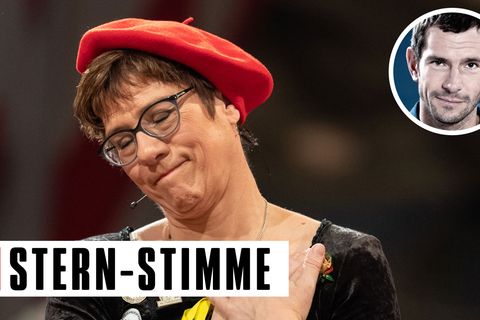Was genau im Unglücksreaktor Fukushima passiert, ist völlig unklar. Doch angesichts von möglichen Kernschmelzen in mehreren Reaktoren rechnen Experten bei einer Zerstörung der Hüllen mit dem womöglich schlimmsten GAU aller Zeiten. Doch was bedeuten Worte wie Kernschmelze und GAU? Ein kleines Glossar erklärt die wichtigsten Begriffe.
Cäsium
Das Element Cäsium kommt in geringen Mengen in der Natur vor oder entsteht bei der Kernspaltung. Natürliches Cäsium 133 ist ein goldglänzendes Metall im Gestein. Sein radioaktives Isotop, das gefährliche Cäsium 137, fällt bei der Kernspaltung an. Cäsium 137 kann über die Abluft oder das Abwasser aus Atomanlagen gelangen und wird von Tieren und Pflanzen aufgenommen. So gelangt es auch in Milch, Fleisch und Fisch. Hohe Konzentrationen von Cäsium 137 können Muskelgewebe und Nieren des Menschen schädigen. Es verteilt sich im Körper, so dass seine Strahlung den ganzen Organismus trifft. Cäsium hat eine Halbwertzeit von rund 30 Jahren.
GAU
GAU ist die Abkürzung für "größter anzunehmender Unfall". Atomkraftwerke dürfen in Deutschland nur ans Netz gehen, wenn sie mit ihrer Sicherheitstechnik für einen solchen GAU oder Auslegungsstörfall ausgerüstet sind. Die Sicherheitssysteme müssen in einem solchen Fall gewährleisten, dass die Strahlenbelastung außerhalb der Anlage die nach der Strahlenschutzverordnung geltenden Störfallgrenzwerte nicht überschreitet. Bei deutschen Kernkraftwerken mit Druckwasserreaktor wäre ein GAU beispielsweise ein Bruch der Hauptkühlmittelleitung mit massivem Kühlmittelverlust. Unfälle, die darüber hinausgehen – wie 1986 in Tschernobyl – werden mit dem Begriff "Super-Gau" umschrieben.
INES
Störfälle oder schwere Unfälle in kerntechnischen Anlagen werden mit Hilfe einer internationalen Bewertungsskala eingestuft. Diese Skala für nukleare Ereignisse heißt INES (International Nuclear Event Scale). Sie reicht von 0 (keine oder sehr geringe sicherheitstechnische Bedeutung) bis 7 (schwerste Freisetzung mit Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt in einem weiten Umfeld). Die Stufe 7 wurde bislang erst ein Mal verhängt: für den Störfall von Tschernobyl. Den Vorfall in Fukushima hat die Internationale Atomenergiebehörde IAEA mit einer 4 auf der INES-Skala bewertet, als ein "Unfall mit lokalen Folgen".
Jod
In einem Störfall kann es zu einer Belastung der Schilddrüse durch Aufnahme von radioaktivem Jod über eingeatmete Luft und die Nahrung kommen. Um das zu verhindern, werden Jod-Tabletten an die Bevölkerung verteilt: Dadurch wird die Jod-Aufnahme der Schilddrüse blockiert, sodass der Körper kein radioaktives Jod aufnehmen kann. Dies gilt besonders für Kinder, da hier der Jodstoffwechsel der Schilddrüse am größten ist.
Kernschmelze
Wenn das Kühlwasser absinkt, überhitzt der Reaktorkern, und die Brennstäbe werden beschädigt, heißt es in einer Analyse der US-Organisation "Union of Concerned Scientists". Das könnte zur Schmelze führen: Die Brennelemente werden so heiß, dass sie sich in eine glühende Masse verwandeln. Die Temperaturen steigen auf 2000 Grad, die Schmelzmasse kann sich angesichts der steigenden Radioaktivität, erhöhten Drucks durch Gase und Wasserstoff durch die Stahlwände des Reaktorgefäßes fressen. Damit würde eine große Menge Radioaktivität in dem Schutzgebäude rund um das Reaktorgefäß freigesetzt und über kurz oder lang, etwa durch den Boden, nach draußen gelangen. Möglich ist aber auch eine Explosion des Druckbehälters. Dann wäre der Fall Tschernobyl eingetreten. Nach Angaben der Grünen vergrößern sich die Risiken bei einem Freiwerden von Radioaktivität noch dadurch, dass in den Reaktoren Mischoxidbrennelemente zum Einsatz kamen, die bis zu zehnmal mehr Plutonium enthalten als normale Brennelemente.
Aufhalten lässt sich eine Kernschmelze nicht: "Dieser Prozess ist nicht mehr zu stoppen, wenn das Kühlsystem versagt hat", sagte der renommierte Physiker Lothar Hahn, der bis 2010 Geschäftsführer der Gesellschaft für Reaktorsicherheit war, zu "sueddeutsche.de". "Für den Experten ergibt sich aus den vielen Mosaiksteinchen ein sehr düsteres Gesamtbild", so Hahn.
Plutonium
Das radioaktive und hochgiftige Schwermetall Plutonium wird in Atomreaktoren als Brennstoff eingesetzt. Es kommt in der Natur nur in Spuren vor. Es entsteht aber in jedem Atomreaktor und auch bei Atomwaffentests als "Nebenprodukt" der Spaltung von Uran-Atomen. Brisant ist Plutonium vor allem, weil wenige Kilogramm zum Bau einer Atombombe genügen. Es hat eine Halbwertzeit von 24.000 Jahren. Nach dieser Zeit ist also erst die Hälfte der Radioaktivität abgeklungen. Gerät der Stoff in den Körper, kann Krebs entstehen.
Radioaktivität
Radioaktivität ist die Eigenschaft mancher Stoffe (Radionuklide), sich unter Freisetzung von Energie spontan in andere Atomkerne umzuwandeln. Diese Energie wird in Form von Alpha-, Beta- oder Gammastrahlung abgegeben. Radioaktive Stoffe kommen in geringen Konzentrationen in der Natur vor, sie sind aber auch Produkt von Kernumwandlungen in Kernreaktoren. Radioaktivität (von lateinisch radius, Strahl) kann man nicht schmecken, fühlen, sehen oder riechen, wohl aber messen. Radioaktive Strahlung kann äußerst gefährlich sein und Schäden am Erbgut und damit Krebs auslösen.
Um Radioaktivität zu messen, dienen die folgenden Einheiten:
In
Becquerel
(Bq) wird gemessen, wie aktiv eine radioaktive Substanz ist. Es geht um die Anzahl der Kerne, die sich in einer Sekunde umwandeln und dadurch einen Strahlungsimpuls abgeben. Benannt ist die Einheit nach dem Entdecker der Radioaktivität, dem französischen Physiker Antoine Henri Becquerel (1852-1908). Die Maßeinheit
Sievert
(Sv) gibt die biologische Wirkung der radioaktiven Strahlung auf Menschen, Tiere oder Pflanzen an. Sie setzt die Masse des betroffenen Objekts in Bezug zur aufgenommenen Energie. Sievert hat die früher übliche Einheit Rem seit der Katastrophe von Tschernobyl vor etwa 25 Jahren abgelöst. Namensgeber ist der schwedische Physiker Rolf Sievert (1896-1966).
Gray
(gy) misst die Intensität der Bestrahlung, wobei die Einheit das Maß der vom Gewebe absorbierten Dosis angibt. Bei einem Gy reagiert der Körper mit Fieber und Durchfall. Wird der ganze Körper einer Strahlung von mehr als 15 Gy ausgesetzt, ist der Tod so gut wie sicher. Die Einheit ist nach dem britischen Physiker Louis Harold Gray (1905-1965) benannt. Manche Quellen führen den Ursprung auch auf den englichen Naturforscher Stephen Gray (etwa 1666-1736) zurück.
Siedewasserreaktor
Im Reaktordruckbehälter sind die radioaktiven Uran-Brennstäbe permanent von Wasser umgeben, das während des Betriebs kühlt. Es macht außerdem als eine Art Bremse die bei der Kernspaltung freigesetzten Teilchen langsamer, um weitere Kernspaltungen zu ermöglichen. Der obere Teil des Wassers im Druckbehälter wird zum Sieden gebracht. Der Dampf wird über Rohre auf Turbinen geleitet, die Strom erzeugende Generatoren antreiben. Da der Wasser-Dampf-Kreislauf direkt mit dem Reaktor verbunden ist, kann bei Lecks leichter Radioaktivität entweichen.
In Deutschland gibt es elf Druckwasser- und sechs Siedereaktoren, der Wasser-Dampf-Kreislauf ist komplett getrennt vom Reaktorbehälter.
Strahlenkrankheit
Radioaktive Strahlen können Körperzellen zerstören und tödlich sein. Die Schäden hängen von der Dauer, Art und Stärke der Strahlung ab. Experten unterscheiden zwischen akuten Strahlenschäden und Spätfolgen. Bereits niedrig dosierte Strahlen können das Erbgut verändern und damit langfristig Krebs auslösen, etwa Leukämie und Schilddrüsenkrebs. Hohe Strahlendosen führen zu Fieber, Übelkeit, Verbrennungen von Haut und Mundraum, Haarausfall, inneren Blutungen und schlimmstenfalls zum Tod.
Super-GAU
Ist der GAU der "Größte anzunehmende Unfall", so geht der Super-GAU noch darüber hinaus. Es entsteht ein Szenario, bei dem stärkere Belastungen auftreten als Auslegungsstörfall. Es kommt hier zu einer Katastrophe, die nicht mehr beherrscht werden kann. Dies ist der Fall, wenn der Reaktorkern schmilzt oder der Druckbehälter birst - wie bei dem bislang größten bekanntgewordenen Unfall in einem Atomkraftwerk 1986 in Tschernobyl.
Tschernobyl
Am 26. April 2006 ereignete sich in Tschernobyl der bislang schwerste nukleare Störfall. Im Block 4 des Kernreaktors kam es zu einer Kernschmelze und Explosion. Als bisher einziges Ereignis wurde das Ereignis auf der INES-Skala mit dem Höchstwert 7 (katastrophaler Unfall) eingestuft. In der Folge waren große Mengen Cäsium entwichen und hatten halb Europa radioaktiv verseucht. Der radioaktive Niederschlag ging auch in Deutschland nieder.