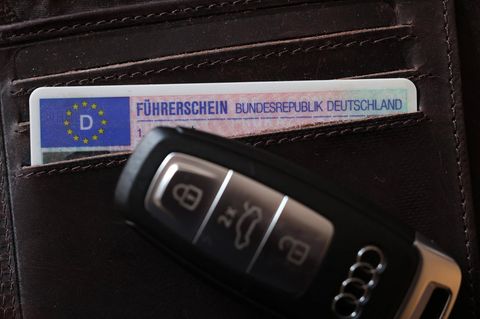Prognosen und diplomatische Floskeln prägten die letzten Tage: Der portugiesische Ministerpräsident José Socrates appellierte an die Verantwortung der Teilnehmer "für eine neue Ordnung der Welt"; die Bundesregierung in Berlin zeigte sich im Sachen Einigung "vorsichtig optimistisch"; und selbst die polnische Außenministerin Anna Fotyga, deren Land als Wackelkandidat für einen Vertragsschluss gilt, gab sich "sehr zuversichtlich". Genug gestritten, meinte auch Kommissionspräsident José Manuel Barroso: "Jetzt ist es Zeit weiterzukommen."
Die EU braucht den neuen Vertrag
Tatsächlich braucht die auf nunmehr 27 Staaten angewachsenen Gemeinschaft dringend einen Vertrag, den Vertrag, um regierbar zu bleiben. Wo heute noch Einigkeit erforderlich ist, sollen Entscheidungen in Zukunft mit Mehrheit getroffen werden können. Ein EU-Außenminister (der sich auf britischen Wunsch hin aber nur "Hoher Vertreter für Außen- und Sicherheitspolitik" nennt) soll den Auftritt der Europäischen Union im Ausland bündeln. Das EU-Parlament wie auch die nationalen Volkskammern gewinnen an Kompetenzen hinzu. Der Europäische Rat, in dem sich die Regierungschefs der Mitgliedsländer mindestens vier Mal im Jahr versammeln und die Gesetzgebung beschließen, bekommt - anders als heute - einen gewählten Präsidenten.
In den Grundzügen haben die 27 Länder diesen Regeln bereits unter deutscher EU-Präsidentschaft im Juni zugestimmt. In den vergangenen Wochen sind die Vereinbarungen nun in einen Vertragstext gegossen worden, der zwar kürzer geraten ist als der ursprüngliche - abgelehnte - Verfassungsentwurf, der wegen der vielen Sonderwünsche und Kompromisse aber schwerer verständlich ausfällt.
Sonderrechte für die Briten
Das fängt schon bei der Grundrechte-Charta an, deren logisches Arrangement zu Beginn des Vertrages durch die Briten blockiert wurde. Nun erhält sie ihre Gültigkeit über eine juristische Krücke: Die Charta wurde nicht direkt in den Vertrag aufgenommen, soll aber per Verweis in Kraft gesetzt werden. Dabei hat Großbritannien Sonderrechte für sich herausgeschlagen: Die Briten wollen nicht, dass die Charta für ihre Gerichte rechtsverbindlich wird. Auch die Polen scheren nun offensichtlich aus und folgen diesem Weg.
Die Forderung der Briten, einen Teil des EU-Rechts je nach Gusto für verbindlich oder unverbindlich zu erklären (Opt-out), ist wohl die kurioseste Passage des Vertrags. Denn Großbritannien wird nicht nur das Recht zum Ausscheren eingeräumt. Kompliziert war es auch, einen Weg zu finden, der es einer britischen Regierung ermöglicht, zu einem späteren Zeitpunkt doch wieder mitzumachen (Opt-in). Der britische Sonderweg hat auch konkrete Auswirkungen auf die Sicherheitspolitik und den Grenzschutz: Großbritannien kooperiert bislang in Polizei-Angelegenheiten mit dem Rest der EU, will sich aber bei der gemeinsamen Grenzsicherung ausklinken.
Dabei oder draußen? Auf dem Gipfel in Portugal wird dennoch nicht erwartet, dass die Briten noch einmal große Probleme machen. Die EU wird sich mit dem Opt-Out-Kompromiss in Zukunft aber noch intensiv beschäftigen müssen.
Polen bleibt unkalkulierbar
Ein unkalkulierbarerer Kandidat ist die polnische Regierung. Deren Spitze, die Brüder Jaroslaw und Lech Kaczynski, hatten sich bei dem Gipfel im Juni noch als Radikale aufgeführt. Nun schlägt zumindest Lech Kaczynski, der Präsident, mildere Töne an. Doch kann man denen trauen? Sein Bruder kämpft zu Hause gerade um Stimmen, am Sonntag wird das Parlament neu gewählt. Werden die Kaczynskis den Gipfel noch einmal für ein großes Theater nutzen? Manche im Brüssler Machtzirkel glauben das.
Dabei geht es den Polen vor allem um eine besondere Abstimmungsklausel, die so genannte Ioannina-Regel. Sie gibt einer Minderheit die Möglichkeit, eine Mehrheitsentscheidung noch einmal zu verschieben. In Lissabon dreht es sich nun darum, welcher rechtliche Rang dieser Klausel zugestanden werden soll: Wird sie als Protokoll Bestandteil des Reformvertrags, wie die Polen nun verlangen, könnte sie in Zukunft nur einstimmig wieder abgeschafft werden.
Italiener fürchten Benachteiligung
Schließlich macht Italien Ärger: Ministerpräsident Romano Prodi sieht sein Land bei der künftigen Sitzverteilung im Europäischen Parlament benachteiligt. Künftig wird die Zahl der Sitze auf 750 (heute 785) beschränkt. Die maximale Abgeordneten-Zahl pro Land soll auf 96 festgelegt werden, kleine Länder sollen mindestens sechs Sitze erhalten. Das System ist mathematisch nicht nachvollziehbar und eher politisch motiviert: Es will die kleineren Länder in der EU, die bei Entscheidungen des Europäischen Rats an Gewicht einbüssen, zumindest im Parlament etwas besser stellen, als es ihnen eigentlich zukäme. Die meisten bevölkerungsstarken Nationen verlieren dadurch Stimmen - Deutschland müsste drei Mandate abgeben, bliebe aber weiter das am stärksten vertretene Land. Italien würde mit sechs Sitzen die größten Einbußen hinnehmen müssen und fühlt sich vor allem gegenüber Frankreich im Nachteil.
Ein prekäres Projekt
Gern würden alle Beteiligten die Sitzverteilung im Parlament aus der aktuellen Diskussion verbannen und in die Zukunft verschieben. Aber 2009 finden die nächsten Wahlen zum EU-Parlament statt. Wenn dies nach neuem Wahlrecht passieren soll, muss die Frage der Sitze nun auf dem Gipfel geklärt werden. Selbst bei einer Einigung in Lissabon ist der Weg zum neuen EU-Vertrag noch weit: Er muss in allen Ländern ratifiziert werden. In Irland geschieht das sicher durch eine Volksabstimmung. In Großbritannien und Dänemark ist noch nicht klar, ob die Bevölkerung befragt werden soll. Bekommt der Reformvertrag auch nur in einem Land keine Zustimmung, ist das gesamte Vorhaben erneut gekippt.