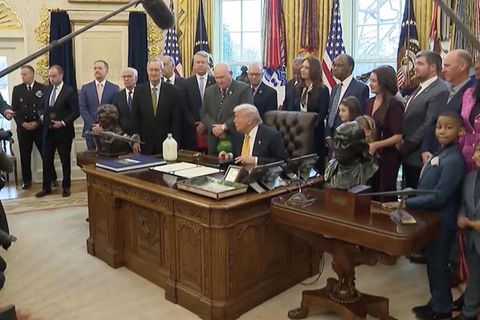Neuer Streit bahnt sich in der EU über den Wiederaufbau Iraks nach dem Golfkrieg an. Trotz ernsthafter Bemühungen um einen Konsens beim Gipfel der EU-Regierungschefs in Brüssel prallten der britische Premierminister Tony Blair und der französische Präsident Jacques Chirac mit ihren Vorstellungen am Freitag aufeinander. Während Blair ein UN-Mandat für eine Nachkriegsverwaltung Iraks forderte, lehnte Chirac ein solches Mandat ab, das „die Militärintervention rechtfertigen würde“.
Blair schlug grundsätzlich versöhnliche Töne an und drang auf eine zentrale Rolle der Europäischen Union beim Wiederaufbau Iraks. Chirac sagte, Europa sei bislang an seinen Krisen immer gewachsen und habe nie Rückschritte gemacht.
Italien beharrt auf Schuldenerlass für seine Bauern
Gleichzeitig hat Italien, ein Unterstützer des Angriffs auf den Irak, beim Brüsseler EU-Gipfel mit der umstrittenen Forderung nach einem Schuldenerlass für seine Milchbauern einen Kompromiss zur grenzüberschreitenden Zinsbesteuerung verhindert. Deshalb müssen die EU-Finanzminister so schnell wie möglich erneut über den Streit beraten, sagte Bundesfinanzminister Hans Eichel am Freitag in Brüssel. Er und Bundeskanzler Gerhard Schröder kritisierten den italienischen Kurs scharf.
Der Kanzler sagte: «Es wäre schon wichtig, dass es gelingt, die italienischen Freunde davon zu überzeugen, dass die Harmonisierung von Steuern etwas ganz anderes ist als Milch.» Beim Gipfel gelang aber ein Kompromiss zu EU-weiten Mindestsätzen für die Energiebesteuerung.
Einigung zur Zinssteuer sollte Steuerflucht bremsen
Die italienische Regierung von Ministerpräsident Silvio Berlusconi behinderte mit ihrem Vorbehalt einen - damit sachlich nicht verbundenen - Kompromiss zur Zinssteuer. Mit dieser Steuer soll die Steuerflucht in der Gemeinschaft eingedämmt werden. Nach einer Grundsatzeinigung im Januar muss das seit sechs Jahren in Brüssel mit harten Bandagen verhandelte Thema endgültig unter Dach und Fach gebracht werden.
Die wegen Überproduktion fälligen Strafzahlungen von knapp 24.000 italienischen Milcherzeugern an die EU belaufen sich auf 648 Millionen Euro. Die Regierung in Rom will diese Schulden mehrheitlich übernehmen, was nach Ansicht der EU-Kommission unzulässig ist.
Große Länder setzen sich bei der Zentralbank gegen die kleinen durch
Zugestimmt haben die Staats- und Regierungschefs den Vorschlägen der Europäischen Zentralbank (EZB) für eine Reform des EZB-Rates zugestimmt. Fraglich war vor allem die Zustimmung Finnlands. Die Reform sieht eine Rotation der Stimmrechte im EZB-Rat nach der Aufnahme weiterer Staaten in die Währungsunion vor. Dabei kämen die kleineren Staaten seltener zum Zuge als größere Länder.
Nach der Zustimmung der Staats- und Regierungschefs müssten die Pläne noch in den Mitgliedsländern von den Parlamenten ratifiziert werden. Das Europäische Parlament, das nur Anhörungsrecht hat, lehnte das Modell als zu kompliziert ab und forderte weitergehende Reformen.
Reform bereitet die EZB auf Erweiterung der Union vor
Mit der Reform soll das oberste Entscheidungsgremium der EZB auf die Erweiterung der Euro-Zone vorbereitet werden, die frühestens zwei Jahre nach der 2004 anstehenden EU-Erweiterung beginnen kann. Der EZB-Rat, dem außer sechs Direktoriumsmitgliedern alle Präsidenten der bislang zwölf nationalen Notenbanken angehören, soll dann mit bis zu 27 Mitgliedsländern noch zügig und effektiv Beschlüsse fassen können.
Die EZB schlägt dazu ein Rotationsmodell vor, das die Zahl der Stimmen für die nationalen Notenbankchefs auf 15 begrenzt, indem diese sich bei Abstimmungen abwechseln. Wie oft sie dabei zum Zuge kommen, hängt von der Wirtschaftskraft und der Stärke des Finanzsektors der jeweiligen Länder ab. Dazu werden sie in Ländergruppen eingeteilt. Die Zentralbankchefs kleiner Länder müssten häufiger aussetzen als die großer Länder.
Energiesteuern werden angeglichen
Nach langem Streit einigten sich die Finanzminister auf eine Angleichung der Energiesteuern in den 15 Mitgliedstaaten. «Das ist wichtiger Fortschritt», sagte der amtierende Vorsitzende des EU- Finanzministerrates, der griechische Ressortchef Nikos Christodoulakis.
Es geht insgesamt um höhere Mindestsätze zur Besteuerung von Benzin, Diesel und Heizöl. Neu eingeführt werden Mindestsätze für Erdgas, Kohle und Strom. In Deutschland dürfte sich jedoch praktisch nichts ändern, da die Steuersätze bereits vergleichsweise hoch liegen. Andere EU-Länder müssten ihre Sätze aber deutlich anheben. Mit den Steuern soll der Energieverbrauch und damit der Kohlendioxidausstoß in der EU deutlich gedrückt werden; damit will die Union zur Einhaltung der Klimaschutzziele von Kyoto beitragen.