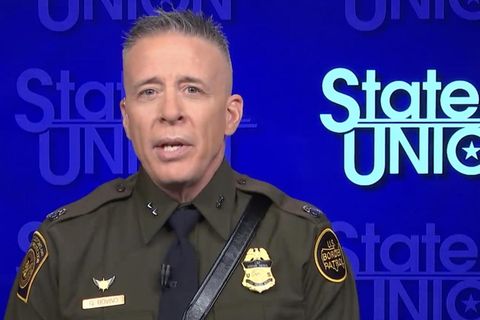Schwule und Lesben können sich in den Streitkräften der Europäischen Union offen zu ihrer Sexualität bekennen. Auch Kanada, Australien, Neuseeland und Israel haben nichts gegen Soldaten, die das eigene Geschlecht lieben. In den USA hingegen entzünden sich an "Don't ask, don't tell" ("Frage nicht, sage nichts") immer noch hitzige Diskussionen.
Nach dem umstrittenen Militärgesetz ist es schwulen und lesbischen Soldaten untersagt, sich öffentlich zu ihrer sexuellen Orientierung zu äußern, andererseits dürfen Vorgesetzte sie auch nicht danach fragen. Im Mai stimmte das US-Repräsentantenhaus für eine Aufhebung von "Don't ask, don't tell", im September wurde der entsprechende Gesetzesentwurf im Senat jedoch gestoppt. Im Oktober ordnete ein kalifornisches Bundesgericht die vorübergehende Suspendierung der Regelung an, einige Tage später setzte ein Berufungsgericht die Anordnung wieder außer Kraft. Am Freitag entschied dann der Oberste Gerichtshof, dass es vorerst bei der umstrittenen Praxis bleibt, bis das Berufungsgericht entschieden hat.
Außer in den türkischen und amerikanischen Streitkräften können Homosexuelle überall in der NATO offen dienen. In den USA wird nun darüber diskutiert, ob die Verbündeten als Vorbild dienen können.
Nicht alle sind von einer Neuregelung überzeugt, manche sehen sie gar als Gefahr. "Wenn unsere Streitkräfte Liberalisierung über die militärische Leistungsfähigkeit stellen, bezieht sich Erfolg nur noch auf soziale Ziele", sagt die Präsidentin des "Zentrums für Militärische Bereitschaft", Elaine Donnelly. "Unsere so liberalen und politisch korrekten Verbündeten sollten dem Beispiel der USA folgen - nicht andersherum."
"Die europäische Kultur ist toleranter als unsere", sagt Tony Perkins, Präsident eines konservativen Forschungsinstituts und ehemaliger Marineinfanterist.
Anders als in anderen NATO-Staaten gebe es in den US-Streitkräften viele sehr konservative und religiöse Soldaten, die nicht gemeinsam mit Homosexuellen dienen wollten, sagt der ehemalige Oberst der Marineinfanterie, Bob Maginnis. Mit der Aufhebung von "Don't ask, don't tell" würden die Streitkräfte viele Soldaten vertreiben, auf die sie nicht verzichten könnten.
Jonathan Hopkins hat an der Militärakademie West Point studiert und in Irak und Afghanistan gekämpft. Er glaubt nicht an die Homophobie der Amerikaner. "Unsere Soldaten sind Homosexuellen gegenüber toleranter als Soldaten aus anderen Ländern", sagt Hopkins. "Es sind die Generäle, die nicht zu der Aufhebung des Gesetzes bereit sind." US-Generalstabschef Mike Mullen hat sich vor dem Verteidigungsausschuss jedoch bereits gegen "Don't ask, don't tell" ausgesprochen.
Der Soziologe David Segal von der Universität von Maryland hält die Erfahrungen der Verbündeten, die Beschränkungen für Homosexuelle in den Streitkräften bereits aufgehoben haben, für lehrreich. "Alle haben erwartet, die Entscheidung würde den Zusammenhalt der Truppe untergraben und die Rekrutierung neuer Soldaten erschweren - nichts davon ist eingetreten", sagt Segal. "Unsere Streitkräfte haben sich auch schon gegen die Integration von Afroamerikanern und Frauen gesträubt. Als die Entscheidung dann einmal gefallen war, haben sie salutiert und sind der Anweisung gefolgt."